
RGL e-Book Cover©
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover©

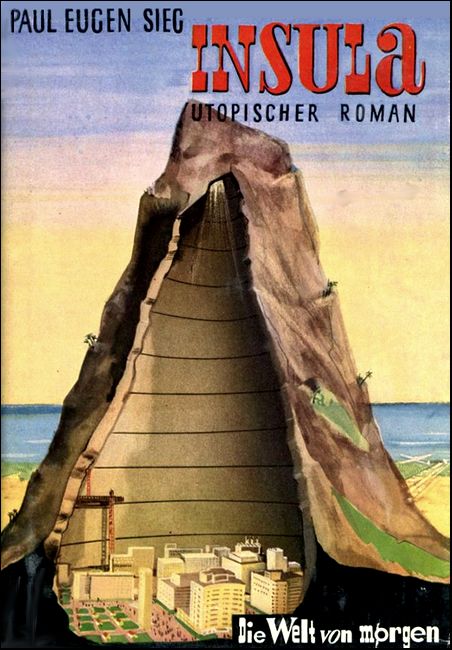
"Insula," Gebrüder Weiss Verlag, 1953

"Insula," Gebrüder Weiss Verlag, 1953
Welche Auswirkungen eine vollständig chemische Ernährung auf die menschliche Gemeinschaft haben kann, zeigt dieser originelle und in seiner Idee einmalige Zukunftsroman.
Ein Geophysiker muß auf seinem Flug nach Australien auf einer kleinen vulkanischen Insel notlanden. Bei seinen Streifzügen durch diesen scheinbar unbewohnten Flecken Erde stößt er auf eine unterirdische Stadt, die mit sämtlichen technischen Errungenschaften ausgerüstet ist. In diese Einsamkeit hat sich ein weltbekannter Forscher zurückgezogen, um ungestört seine Pläne — die synthetische Herstellung aller Lebensmittel und Getränke — zu verwirklichen. Jedes Mittel ist ihm hierzu recht. Er zwingt den notgelandeten Geologen zu längerem Aufenthalt und zur Mitarbeit. Werden die tausend Menschen, die hier versuchsweise von künstlichen Nahrungsmitteln leben, existieren können und jemals wieder ihre Freiheit erlangen? Wird es gelingen, die Menschheit vor den aggressiven Plänen dieses Fanatikers zur Erringung der Weltmacht zu schützen?
Der Verfasser vereinigt in diesem Buch hinreißende Spannung, technische Phantasie und guten Stil, Vorzüge, die seinen Roman zu einer gern gelesenen und interessanten Lektüre machen.
MARTIN DAMM bereute es nicht, seinem Bordmonteur den Laufpaß gegeben zu haben. Bei der christlichen Seefahrt wurde getrunken. Bei der Fliegerei auch! Luft und Wasser machen durstig! Das ist eine Erfahrung, und da Luft und Wasser hier in Kapstadt in reichlichem Maße zusammentrafen, schien der Durst auch allgemein größer zu sein als sonstwo. Aber verdammt noch mal! Schließlich sind Erfahrungen dazu da, daß man aus ihnen lernt und sie nutzt. Und wem schon der erste Kapweinkater nicht Warnung genug ist, dem sollte wenigstens der zweite genügen. Vor allem dann, wenn er Bordmonteur ist und einen Flug von Afrika nach Australien vor sich hat. Adalbert Krause jedoch ließ sich nicht warnen, weder vom Kapwein noch von Martin Damm. Er soff. Er soff so lange, bis er nicht mehr imstande war, sein Flugzeug zu besteigen. Da riß Martin Damm der Geduldsfaden. Einen solchen Kerl konnte er auf seinem Flug nicht gebrauchen. Dann würde er lieber allein fliegen. Also auf denn — ohne ihn, ohne Herrn Adalbert Krause! Der Kommandant wickelte die Entlassungsformalität kurz und schmerzlos ab, zwei Monteure überprüften noch einmal die Maschine, dann hob sich die Startflagge. Die Bahn war frei.
Für Martin Damm bedeutete dieser Alleinflug kein Wagnis. Ja, wenn er auf seinen betrunkenen Bordmonteur angewiesen gewesen wäre, dann hätte es eins werden können. So aber? Weiß der Kuckuck nur, was dem sonst so Biederen angekommen war, alle Warnungen in den Wind zu schlagen. Doch mochte er jetzt sehen, wie er sich wieder auf den Weg brachte. Einstweilen hatte er eine fristlose Entlassung wegen grober Pflichtversäumnis in der Tasche. Schade, war sonst ein pfiffiger Bursche gewesen. Aber Schwamm drüber! Enttäuschungen bleiben nun mal keinem erspart.
In wenigen Minuten hatte Martin Damm die afrikanische Küste hinter sich gelassen. Das Flugzeug war auf achthundert Meter Höhe gebracht, die Motoren arbeiteten, daß es eine Freude war, so hatte Damm im Augenblick nichts anderes zu tun, als sich doch noch einmal nach der Karte zu orientieren und den genauen Kurs festzusetzen. Er regelte das Selbststeuergerät ein, schaltete und war damit auf einige Stunden sein freier Herr, denn auf die Maschine brauchte er nicht weiter achtzugeben. Wozu gab es Selbststeuergeräte?
Er suchte den bequemen Sitz in der Kabine auf. Das war sonst der Platz des Bordmonteurs vor den Fernmeldeapparaturen. Ein Griff nach dem Schaltbrett. So! Erst einmal hören, wie die neusten Wetterberichte lauteten. Nach knapp einer Viertelstunde lehnte sich Martin Damm befriedigt zurück und zündete sich eine Zigarette an. Besseres Flugwetter auf der ganzen Strecke konnte er sich nicht wünschen. Jetzt war es kurz nach ein Uhr. Drei Stunden Verspätung, dank dem unliebsamen Zwischenfall, waren weiter nicht tragisch zu nehmen. Etwa zweiundzwanzig Stunden würde der Flug bis zu dem neuen großen Landeplatz an der Südwestecke Australiens, unweit Kap Leeuwin, dauern. Ohne die Motoren mit voller Kraft laufen zu lassen, könnte er bequem gegen siebzehn Uhr Ortszeit, das heißt Sonnenzeit, auf dem australischen Flughafen zur Landung ansetzen. Brennstoff befand sich übergenug in allen Reservetanks. Überdies war die Maschine um gut hundert Kilo durch das Fehlen des Monteurs und seines Handgepäcks erleichtert. Auf Schlaf allerdings würde er während der kommenden zweiundzwanzig Stunden verzichten müssen. War auch völliger Verlaß auf das Selbststeuergerät, so galt es doch, vielerlei Instrumente laufend zu überwachen und geringfügige Fehlsteuerung nach erfolgter Radiopeilung zu korrigieren.
Martin Damm stellte sein Radio auf Musik ein. Gegessen hatte er noch in Kapstadt, doch ein guter Kaffee konnte jetzt nichts schaden. Er setzte den Gedanken in die Tat um, und bald brodelte das Wasser im Elektrokocher. Behutsam füllte er den Filter, und nach wenigen Minuten duftete das schwarze Getränk in der Schale. Noch einmal ein Blick auf die Instrumente, den Höhenmesser. Alles in Ordnung. Er machte es sich in einem Armsessel bequem. Radio Kapstadt unterhielt ihn mit netter leichter Tischmusik.
Damm genoß nach Tagen der Hast und äußerster Anspannung die Einsamkeit und Ruhe als ein seltenes Geschenk. Er rauchte und sann über die Pläne nach, derentwegen er nach Adelaide flog. Plötzlich langte er in seine Aktentasche, breitete Papiere auf dem Tisch vor sich aus und vertiefte sich, die Stirn in beide Hände vergraben, in die Aufzeichnungen.
In drei Tagen fand in Adelaide der große wissenschaftliche Kongreß statt, zu dem er als bekannter Geophysiker geladen war. Ja, man darf sogar die Feststellung machen, daß sein Name in Fachkreisen Weltruf hatte. Natürlich hätte er niemals diesen Erfolg gehabt, wenn ihm nicht jener große Wurf gelungen wäre: das neuartige Instrument, eine elektrische Peilsonde, mit deren Hilfe es ohne große Vorbereitung möglich war, bis zu großer Tiefe die Lagerstätten von Mineralien und Ölen auf das genaueste zu lokalisieren und exakt anzugeben, um welche Art von Funden es sich handelte. Bis jetzt hatte Dr. Dr. Martin Damm sein Gerät noch nie aus der Hand gegeben, sondern war zu jeder in Frage kommenden Stelle auf dem weiten Erdball hingeflogen und hatte die Messungen selbst vorgenommen. Daß die Apparatur, die er benötigte, nicht umfangreich war, erwies sich für ihn als sehr vorteilhaft. So konnte er sich bei seinen Flügen mit dem kleinen zweimotorigen Langstreckenflugzeug, das einen Aktionsradius von zehntausend Kilometer hatte und das er wegen seiner Wendigkeit so liebte, begnügen. Er war dadurch um vieles unabhängiger und beweglicher.
Jedenfalls erklärt es sich auch so, daß er auf diese Weise ein äußerst routinierter Flieger geworden war, für den ein Flug, wie er ihn vorhatte, nichts Besonderes bedeutete. Wenn er überhaupt einen Bordmonteur in seine Dienste genommen hatte, so hatte er es nur getan, damit er sich nicht um Pflege und Wartung des Flugzeugs zu kümmern brauchte.
Bis zum Abend war Damm mit seinen Arbeiten beschäftigt. Dann brach er seine Tätigkeit ab. Nachdem er seine Akten verstaut und einen Overall übergestreift hatte, widmete er sich den Motoren, die er, in den Tragflächen entlangkriechend, erreichen konnte. Zwar war der Platz hier äußerst beschränkt, aber er reichte aus für das, was es allenfalls zu tun gab. Ein Blick genügte, um Martin Damm davon zu überzeugen, daß die Motoren bei richtiger Temperatur einwandfrei arbeiteten, und so kroch er auch gleich wieder den Gang zurück, um sich in der Waschkabine seines Overalls zu entledigen und zu erfrischen.
Dann bereitete er sich ein einfaches Abendessen und einen steifen Kaffee, um die Stunden des langen Wachens durchzustehen.
Auch während der Nacht verlief der Flug völlig planmäßig. Die eingehenden Wettermeldungen lauteten eine wie die andere vorzüglich, und ein leichter Rückenwind beschleunigte die Fahrt.
Ein strahlender Morgen brach an. Still wie eine gewaltige Ölfläche lag dunkel unter dem rasch dahinschießenden Metallvogel der Indische Ozean. Martin Damm saß wieder über seiner Arbeit. Er stellte die Rede für die geophysikalische Tagung in Adelaide zusammen.
Schon mehrfach hatte er den Kopf gehoben und gelauscht. Jetzt stand er auf und betrat den Führerraum. Da stimmte doch etwas nicht! Sein Blick fiel auf einen der Öldruckanzeiger. Der stand unter der Marke. Am Steuerbordmotor mußte irgend etwas nicht in Ordnung sein. Von dort her kam auch ein unangenehm klirrendes Geräusch.
Rasch war der Overall übergestreift.
Als der einsame Pilot nach etwa zehn Minuten aus dem Kriechgang hervorkam und sich aufrichtete, malten sich auf seinem Gesicht Bedenken und Sorge. Unten, aus der vermutlich gesprungenen Motorenwanne, leckte in kleinen Tropfen Öl. Das war der Befund. Pleuelstangenbruch? Das Gehäuse fühlte sich viel zu heiß an. Da half neues Öl nachfüllen nur kurze Zeit. Den Schaden zu beheben war unmöglich. Den Motor weiterlaufen lassen würde den eingetretenen Defekt nur vergrößern. Sollte er es wagen, mit einem Motor weiterzufliegen?
Martin Damm nahm auf dem Führersitz Platz und schaltete den heißgelaufenen Motor ab. Das Flugzeug legte sich auf die Seite.
Kurz war der Entschluß. Vor einer Viertelstunde hatte er eine kleine Insel überflogen. Dort mußte unter allen Umständen ein Landeplatz gefunden werden, und sei er noch so klein. Vielleicht war die Insel sogar bewohnt. Auf alle Fälle dort landen und dann drahtlos Hilfe herbeirufen!
Die Hände bedienten das Steuer. Die Maschine zog eine weite Kurve. Die Sonne stand nun im Rücken.
Schon tauchte dieser merkwürdig runde Felsendom im leichten Dunst auf. Gebe ein günstiges Geschick, daß man da landen kann! Einstweilen sah das nicht so aus. Sonst hieß es eben zu versuchen, mit einem Motor die lange noch vor ihm liegende Strecke bis Kap Leeuwin zu meistern. Die Vorstellung war höchst unbehaglich! Landen und Senden wäre schon das Richtige! Verpflegung war reichlich an Bord, um damit einige Tage durchzuhalten — länger könnte es ja nicht dauern —, bis die drahtlos herbeigerufene Hilfe ankommen würde.
Näher und näher rückte die Felseninsel. Seltsam, dieses Gebilde. Wie ein riesenhaft aufgereckter Daumen sah es aus. Im Inneren Afrikas, besonders in Angola, hatte Dr. Martin Damm ähnliche Gebilde aus Granit oder Gneis angetroffen, jedoch lange nicht so mächtig und hoch. Dieses dort mochte gut und gern an die fünfhundert Meter aus dem Meer aufragen.
In wenigen Minuten hatte Damm den Felsen erreicht und begann ihn zu umkreisen. Nirgends waren Menschen zu sehen, doch offensichtlich befand sich da unten ein kleiner künstlicher Hafen, der vermutlich als breite Rinne in den Fels hineingesprengt und zur See hinaus mit zwei Schutzmolen verlängert war. Hinter diesem Hafen breitete sich eine sanft ansteigende, fast glatte Gesteinsfläche aus, die jäh in den steil ansteigenden Felsendom überging. Groß war diese Fläche nicht. Sie konnte zum Landen verlocken. Doch der Auslauf war zu kurz.
Nein, so ging es nicht! Also Bauchlandung auf dem Wasser, dicht vor dem Hafen! Das war die vernünftigste Lösung. Eine Zeitlang schwamm die Maschine gut, das wußte Martin Damm, und wenn nicht alle Beobachtungen trogen, endete der kleine Hafen mit einer schräg auflaufenden Gleitfläche, wie sie Holzsägewerke am Rande von Gewässern zum Aufschleppen von Floßstämmen benutzen. Verlief alles programmgemäß, so konnte man den letzten Schwung der Wasserung ausnutzen, um das Flugzeug dort hinaufgleiten zu lassen. Dann war man auf dem Trockenen geborgen. Der Plan schien durchführbar. Bauchlandungen mit defekten Maschinen hatte Martin Damm während des Krieges eine gute Zahl vollbracht. Das war nichts Neues.
Im Augenblick beschäftigte ihn der Gedanke, ob er jetzt nicht erst noch einmal unter genauer Angabe seiner Position SOS funken sollte. Für den Fall, daß eine unvorhergesehene Tücke eine glatte Landung vereitelte, schien diese Maßnahme durchaus empfehlenswert. Doch dann verwarf er den Plan. Warum sollte das Vorhaben nicht gelingen? Überdies fehlten ihm die exakten Positionsangaben. Erst später konnte er sich auf der Karte vergewissern, wie diese Insel hieß.
Also herunter mit der Kiste! Die Hand fuhr zum Schaltbrett. Der defekte Motor sprang an und lief bald, wenn auch unruhig, auf hohen Touren. Zur Landung benötigte er beide Motoren. Mochte die letzte Anstrengung dem einen den Rest geben, jetzt würde er noch durchhalten.
Tiefer senkte sich das Flugzeug. Der Wind stand günstig von vorne. Die Landeklappen spreizten heraus. Die Fahrt verminderte sich rasch. Der Metallrumpf setzte sacht auf dem Wasser auf, die Motoren fielen von Touren. Hoch spritzte der Gischt. Dann war es geschafft.
Die Dünung des Ozeans machte Martin Damm zu schaffen; doch schon hatte er den kleinen Hafen erreicht. Es verhielt sich so, wie er von oben beobachtet hatte. Der Hafen lief in einer Aufschleppbahn aus. Noch einmal liefen die Motoren an, Sand knirschte unter der Bauchwölbung. Die Maschine schob sich aus dem Wasser. Noch ein verstärktes Aufheulen. Gezogen von den immer aufs neue kurz aufbrausenden Motoren, rutschte der glitzernde Leib, in seinen Fugen bebend, mit schwankenden Schwingen Meter um Meter die schräge Felsfläche hinauf.
Dann ein jähes Verstummen! Das Flugzeug ruhte, nur noch mit dem Heck in den Fluten, schräg aufwärts geneigt auf dem festen Grund, sicher und geborgen. Ein Abrutschen brauchte Martin Damm nicht zu befürchten. Der Anfang der Gleitbahn, die — einem unerwarteten Göttergeschenk gleich — die herrliche Landung ermöglichte, war zwar mit grünen, glitschigen Algengewächsen bedeckt, auf dem rauhen Felsboden jedoch, auf dem der Bug auflag, vermochte höchstens ein Wirbelsturm die Maschine zu gefährden, und danach sah es bei dem wolkenlos klaren Himmel, der über der Insel blaute, nicht aus.
›Glück muß ein Flieger haben!‹ lachte Martin Damm vor sich hin, kletterte durch die rasch geöffnete Kabinentür ins Freie. Ein Sprung von der Tragfläche, und er stand auf der Insel.
Von dem langen Sitzen steif, vertrat er sich erst einmal kurz die Beine.
Das sah hier ja recht seltsam aus. Vor längerer Zeit mußte der Hafen zum letztenmal benutzt worden sein. Ein kleiner Laufkran zeigte sichtbare Stellen von Rost, rostig waren auch die Triebräder und Lastenketten, schienen demnach ebenfalls lange nicht gebraucht worden zu sein. Jetzt erblickte Martin Damm in der Mitte der sachte ansteigenden Bahn, auf welcher er gelandet war, in den Felsen eingelassene Schienen, die zum Fuße des gewaltigen Gesteinsdomes hinaufführten. Da mußten größere Güter hinauftransportiert worden sein. Sollten hier einmal Walfänger ihre Station gehabt und die schräge Bahn benutzt haben, um die gewaltigen Tiere an Land zu ziehen? Er konnte sich nicht erinnern, gehört zu haben, daß in diesen Zonen Walfang getrieben wurde. Wer sonst aber hätte an einer solchen Anlage Interesse haben können? Seltsam nur, daß keine Reste von Häusern oder Baracken zu erblicken waren. Selbst wenn diese abgebaut worden wären, hätten die Fundamente noch sichtbar sein müssen.
Er untersuchte die Schienen. Die Spur maß etwa drei Meter. In den klaren, jetzt wieder völlig ruhigen Fluten des Hafenbassins konnte man die Gleise unter Wasser weiter verfolgen. Sollten da mit Rädern versehene Prahme benutzt worden sein, die zur Übernahme der Ladung schwimmend an die Dampfer herangebracht, dann zurück auf die Gleise und mit einem Seilzug nach oben geführt wurden? Das schien durchaus denkbar, zumal die schmalen Molen kaum Platz für die Löschung eines Frachters boten.
Merkwürdig waren diese umfangreichen technischen Anlagen auf jeden Fall! Schließlich baut man so etwas nicht ohne Zweck auf eine verlassene Felseninsel, außerhalb jeder normalen Verkehrsstraße. Der in das Urgestein geprengte Hafen, die beiden künstlich errichteten Molen, die mit viel Aufwand planierte Gleisbahn hatten ohne Zweifel ein riesiges Vermögen gekostet. In Martin Damm erwachte die verständliche Neugier, zu erfahren, wozu das alles diente.
Doch bevor er einen Erkundigungsgang aufnahm, kletterte er nochmals in sein Flugzeug. Er vergewisserte sich, daß die Sende- und Empfangsapparatur in Ordnung war, und prüfte eingehend die Karte. Die kleine Insel war, wie erwartet, nicht eingezeichnet. Nun, der Name besagte zunächst ohnehin nichts. Viel wichtiger war es, festzustellen, was diese Insel für Geheimnisse in sich barg, denn einige Zeit würde er sich hier auf jeden Fall aufhalten müssen. Darum begnügte er sich mit einem kleinen Frühstück, steckte Pfeife und Tabak zu sich und turnte aus der Kabinentür auf die Flügel hinaus.
Er wollte schon zu Boden springen, als ihn noch einmal jene innere Stimme ansprach, wie wenn sie ihn warnen wollte: »Willst du nicht doch lieber gleich die Position der Insel bestimmen? Du kannst dann die Gewißheit haben, daß dich morgen eines der großen Seenotflugzeuge des Internationalen Rettungsdienstes an Bord nehmen wird. Du triffst bestimmt noch rechtzeitig in Adelaide ein und kannst dort deinen Vortrag halten. Dein Flugzeug wird später ein Dampfer bergen. Das übernimmt die Versicherung. Wofür bezahlst du denn die hohen Prämien?«
Doch mit Damm war nicht zu reden. Wie sein Bordmonteur schlug auch er jede Warnung in den Wind. Kurz entschlossen sprang er auf die Erde hinunter. Ein Blick noch auf die Maschine, dann sollte ihn nichts mehr halten. Als er sein Flugzeug umschritt, freute er sich wie ein kleines Kind. Nichts war verbogen. Der Rumpf hatte beim Heraufgleiten auf den felsigen Boden wohl einige Schrammen abbekommen, doch die waren völlig belanglos. So gab es also auch hier nichts, was ihn vielleicht noch hätte festhalten können.
Wieder blieb sein Blick an dem kurzen Schienenstrang hängen. Diese Spur mußte er zuallererst einmal verfolgen. Mit raschen Schritten lief er die leicht geneigte Bahn aufwärts, blieb plötzlich stehen und bückte sich. Ein kleines Stück Holz lag in der Rinne einer dieser Schienen. Er hob es auf, prüfte es. Das war Kiefernholz, wie man es zur Anfertigung von Transportkisten verwandte.
Zum Teufel, zu welchem Zweck brachte man Kisten an den Fuß eines domhohen Felsens! Domhoch? Das dürfte ein schlechter Vergleich sein, sann Martin Damm weitersteigend. Dome von gut fünfhundert Meter Höhe gibt es nicht. Ein Dom ist spitz und rank. Was hier gewaltig vor ihm aufragte, war rundlich, glich eher einer riesenhaften halben Banane, einem großen Zeh, oder einem Daumen von gigantischem Ausmaß, dem sich wie ein Mützenschirm die Fläche, auf der er jetzt hinanstieg, vorlagerte.
Der Geologe in Martin Damm erwachte. Schon mehrfach hatte er kleine Gesteinsbrocken aufgenommen und geprüft. Das war Urgestein, feinkörniger Diabas. Ein Laie konnte es für Basalt halten. Geologisch ein höchst interessantes Gebilde, dieser Riesendaumen, ohne Zweifel vulkanischen Ursprungs, eine gewaltige Eruption, die erstarrt war, bevor der Berg sich zum Krater öffnen konnte. Ähnliches gab es an manchen Stellen des weiten Erdenrundes, doch so großartig und gleichmäßig, so imponierend in seinen regelmäßigen Formen, hatte der Forscher noch nichts kennengelernt.
Er stieg weiter. Die Sonne brannte trotz der Morgenstunde recht fühlbar auf das nackte Gestein. Nicht die geringste Spur von Vegetation bot sich dem suchenden Blick. Kein Wunder, denn Erdreich zum Wurzeltreiben konnte sich hier auf dem von Wind und Wetter geglätteten Felsgrund nicht bilden.
Vergebens prüfte Martin Damm den am Ende der Bahn erreichten, fast senkrecht emporragenden Felsen auf einen Eingang. Minutenlang glitten Hände und Augen mit wissenschaftlicher Gründlichkeit über das Gestein. Kein Ritz, keine Fuge oder Strukturänderung, nichts war zu erkennen, nichts, was auf ein heimliches oder geheimnisvolles Tor, das der Forscher im stillen hier vorzufinden gehofft hatte, schließen ließ.
Zum Kuckuck! Wozu baute man hier eine Transportbahn, legte einen Hafen an, verpulverte ein Vermögen in scheinbar nutzlosen Anlagen. Das alles mußte doch einen Zweck haben? Kein Mensch konnte so hirnverbrannt sein, auf einem in seiner Grundfläche vielleicht drei Quadratkilometer großen öden Felseneiland Arbeitskraft und Kapital zu investieren, ohne damit einen Zweck zu verfolgen. Eine Walfangstation schied bei allen Überlegungen aus. Fünfzig Meter Gleis hätten ausgereicht, selbst die stärksten Tiere aufzuschleppen. Die Bahn hier war gut und gerne zweihundert Meter lang. Mit größter, ja peinlicher Sauberkeit waren die kräftigen Schienen im Gestein verlegt. Das hatte wochenlange Arbeit gekostet.
Kopfschüttelnd wandte sich Martin Damm ab.
Die Sache fing an rätselhaft und aufregend zu werden.
Er schlenderte den Weg zurück, beschloß, um jeden Preis hinter dieses Geheimnis zu kommen. Immer aufs neue verstrickten sich seine Gedanken in der Vielzahl der unlösbaren Probleme, die hier ein seltsames Geschick ihm zur Lösung vor die Füße geworfen hatte.
Sollte man da oben auf der Spitze des Berges eigens eine Station errichtet haben, die wieder verlassen wurde? Für Wetterbeobachtungsstellen wurde sehr viel Geld ausgegeben. Bei derartigen Voraussetzungen bekamen die Bauten hier Hand und Fuß.
So kam er nicht weiter. Er mußte wieder kehrtmachen, um von der Landestelle aus Weiteres zu unternehmen. Im Nu war er wieder bei seinem Flugzeug, kletterte hinein, holte sein Fernglas und suchte den Felsen ab.
Auf der Spitze des Felsenkegels war nicht das geringste festzustellen, wenigstens von hier aus nicht. Er überlegte. Er konnte sich nicht entsinnen, beim Umkreisen der Insel irgend etwas Auffälliges, etwa Spur oder Fundament eines Hauses entdeckt zu haben. Dergleichen wäre ihm sofort aufgefallen.
Erneut setzte er das Glas an die Augen.
Rechts zum Meer fiel der Berg steil ab. Zur Linken aber zog sich eine schmale Terrasse um den Felsen herum hinan, die jedoch bald dem Gesichtsfeld entschwand. Wenn es für dieses Rätsel überhaupt eine Lösung gab, so war sie nur noch in der Verlängerung der Terrasse zu suchen.
Martin Damm steckte sich wieder die Pfeife an, hängte das Fernglas um die Schulter und ging, sich links haltend, die Anhöhe hinauf. »Wollen doch mal sehen, was es da für Überraschungen gibt! Irgendeinen Zweck müssen die Anlagen schließlich ja haben«, das waren die Gedanken, die wieder und wieder in seinem Kopf kreisten.
Majestätisch schön lag die Insel in ihrer elementaren Wucht und Verlassenheit mitten im Ozean. Die träge heranrollenden Wogen der Dünung, dem Auge kaum wahrnehmbar, brandeten mit Wucht gegen das verwunschene Eiland.
Ihr dumpfes Rollen und Dröhnen war das einzige Geräusch. Hoch spritzte an den vorgelagerten Felsblöcken der schäumende Gischt, fiel zurück in das Kochen und Brodeln um die nassen Kuppen. Blau strahlte der Himmel.
Je höher er hinaufkam, desto stiller wurde es um ihn. Schließlich hörte er nur noch seinen eigenen schweren Tritt gegen das harte Gestein ... klapp ... klapp ... klapp!
Weiter!... Weiter ... weiter!
Auf einmal blieb Martin Damm stehen.. Donnerwetter! Das war ja ein Weg! Er kniete nieder. Seine Augen hatten ein kleines rundes Loch entdeckt, ohne jeden Zweifel ein Bohrloch, dort noch eins, dicht am ansteigenden Fels. Hier war gesprengt worden. Da gab es keinen Zweifel. Dieser breite, ausgezeichnet planierte Weg war künstlich angelegt, führte leicht ansteigend um den Berg herum. Dort unten im Meer lagen Trümmer, über die die Brandung tobte.
Rascher schritt Martin Damm dahin. Aufregung bemächtigte sich seiner. Sollte das Geheimnis endlich aufgedeckt werden?
Weiter, weiter! Hastiger wurden die Schritte.
Plötzlich überfiel ihn ein Grauen. ›Laß die Finger davon!‹ Zum dritten Male mahnte ihn die warnende Stimme: ›Kehr um, geh zu deinem Flugzeug zurück! Warte bis zum Mittag! Sende und hole Hilfe heran. Kehr um!‹
Schnell ging der Atem. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Er schob den Hut ins Genick, wischte mit dem Taschentuch über die feuchte Haut. Er blieb stehen.
›Unsinn! Unfug! Hast heute nacht nicht geschlafen, du Tor! Zuviel starken Kaffee getrunken. Das ist alles.‹
Doch diese innere Stimme ließ nicht locker.
›Kehr um!‹
Martin Damm atmete einmal tief auf, blickte hinaus auf den stillen, weiten Ozean.
›Wär doch gelacht! Ich will wissen, wozu hier Wege gebaut sind und wohin sie führen!
Kein Mensch weit und breit und dann Angst haben! Angst am hellichten Tage?‹
Er wollte weitergehen, doch seine Beine gehorchten nicht.
›Dich beobachtet jemand!‹ Wie ein Ziehen im ganzen Körper lähmte ein unabweisbares Gefühl jede Bewegung.
›Bin ich denn nicht mehr Herr meiner Sinne?‹ Ein tückischer Zauber umspann die Einbildung.
Die Pfeife war ausgegangen.
Zwei, drei hastige Züge.
Zorn überkam ihn, auf sich, auf die Pfeife, auf den Weg hier, den Berg, die Brandung, auf alles.
Wütend riß er die Streichholzschachtel hervor. Die Flamme zischte auf. Die Pfeife brannte wieder. Er wurde ruhiger.
Doch das Gefühl wich nicht, beobachtet zu werden, aus dem Berg heraus von boshaft lauernden Blicken auf Schritt und Tritt beschnüffelt zu werden.
Er hob das Glas vor die Augen, sondierte eingehend seine Umgebung, vor allem den unheimlichen Berg.
Nichts!
Stille! Nichts als die Brandung tief unter ihm.
Unwillig setzte er das Glas ab und ging zögernd weiter. Wie ein Jäger auf der Pirsch, schlich er, Schritt vor Schritt, vorsichtig den Weg hinan, kaum Herr seiner Sinne, jeden Augenblick des Abenteuers gewiß.
An einer Wegbiegung blieb er stehen, schaute nach vorn.
Maßloses Erstaunen ließ ihn hochfahren.
Da war die Tür, die er solange gesucht hatte!
Eine Tür, eine graudunkle Tür, täuschend dem umstehenden Gestein angepaßt.
Eine kurze Strecke nur, etwa dreißig Schritte waren es bis dorthin. Dann endete der Weg, von dem natürlich aufragenden Felsen nach allen Seiten blockiert.
Also doch Spuren menschlicher Besiedlung?
Martin Damm zögerte. Sollte er weitergehen? Sollte er umkehren? Die innere Spannung steigerte sich, riß und zerrte an seinen Nerven.
Plötzlich lachte er grell auf, schlug mit der geballten Faust gegen die steinerne Wand zu seiner Rechten, einem Irren gleich, der seine Zelle sprengen will.
Die Faust schmerzte nach dem harten Schlag.
Das tat wohl, bewies doch dieser Schmerz, daß er noch da war, er selbst und nicht ein Schatten von ihm, dem ein hypnotischer Zwang angetan wurde.
Er lehnte sich gegen den kühlen Felsen. Knapp zwei Meter vor ihm fiel der Hang fast senkrecht zum Meer ab. War sein Schwindelgefühl allein Schuld an dem entnervten Zustand?
›Kehr um, Martin Damm!‹
Wie ein Gekreuzigter lehnte er an der Steinwand, die Arme ausgespreizt, die Augen in die Ferne gerichtet.
Und wieder zerschnitt ein grelles Lachen die Stille.
›Ich bin wahnsinnig geworden!‹ hasteten die Gedanken.
Langsam löste er sich von der Wand.
Die Pfeife war schon wieder ausgegangen. Er kramte in seinen Taschen, fand ein Päckchen Zigaretten.
Nach dem ersten Zug fühlte er sich wie von einem Zauber erlöst. Blau leuchtend lag das Meer, ein weiter Halbkreis, klar bis zum Horizont. Die leichte Brise kühlte die heiße Stirn. Die Wahngebilde zerstoben, seine Kraft erwachte neu und straffte die Glieder.
Jetzt zur Tür!
Was stand da in mehreren Sprachen angeschrieben?
Martin Damm mußte an sich halten.
»Notunterkunft für Schiffbrüchige!«
Du liebe Güte! Und darum diese Angst, dieses Fieber, diesen ganzen Wahnwitz?
Dazu also hatte man die Anlage geschaffen, den kleinen Hafen ausgebaut! Doch im nächsten Moment meldete sich schon wieder der Zweifel: ›Hätte man das alles nicht viel einfacher herrichten können?‹ Irgend etwas stimmte in der ganzen Rechnung nicht. Er mußte sich ein für allemal Gewißheit verschaffen.
Er preßte die Klinke nieder. Die Tür quietschte in den Angeln.
Das helle Tageslicht fiel in eine künstlich erweiterte Höhle. Die vier Wände waren sauber in quadratischen Flächen gearbeitet. In der Mitte stand ein Tisch mit einigen Stühlen, darüber hing eine Petroleumlampe mit einem weißen Emailleschirm.
Je mehr sich seine eben noch von der strahlenden Helle des Sonnenlichtes geblendeten Augen an das Halbdunkel in der Tiefe des Raumes gewöhnten, desto klarer tauchten die Umrisse weiterer Einrichtungsgegenstände auf. Er entdeckte noch zwei Schränke und einen Herd, über dem sich ein Bord mit Töpfen, Pfannen, Schöpflöffeln usw. befand, und in einer Ecke zwei übereinander gebaute Betten.
Das Ganze wirkte so anheimelnd, so gemütlich, so einladend, daß sich Martin Damm gleich wie zu Hause fühlte. Als erstes zog er sich die Jacke aus, denn ihm war von der brütenden Hitze draußen sowie von der Aufregung, die er hinter sich hatte, elend heiß, und die angenehme Kühle des Raumes tat ihm wohl, sein Körper war schweißgebadet. Aus der Felswand ragte ein Kleiderhaken, gerade der rechte Platz für seine Jacke. Den Hut stülpte er obendrauf. Mit dem Taschentuch trocknete er sich erst noch Stirn und Nacken, dann machte er sich an die Untersuchung der Schränke.
Die Tür schwang unter dem Griff seiner Hände auf. Die spähenden Blicke umspannten ein Lager von Lebensmitteln, das für lange Zeit reichen mußte. Buchstabenaufschriften bezeichneten den Inhalt, während an der Innenseite des Schrankes auf einer säuberlich unter Glas gerahmten Tafel in vielen Sprachen die dazu gehörigen Bezeichnungen standen.
Hier war offensichtlich an alles gedacht worden.
Im zweiten Schrank befanden sich Kleider, Schuhe, Wäsche und Decken.
Jetzt erst gewahrte Damm den Eingang zu einem weiteren, in den Felsen eingehauenen Gelaß, das durch eine Eisentür verschlossen war. Er öffnete sie. Eine Kammer tat sich auf. Ein neues Warenlager voller Büchsen und Fässer, soweit das Auge im matten Dämmerlicht die Umrisse erkennen konnte.
Wer hier notlandete, der hatte nicht zu befürchten, verhungern zu müssen.
Nun, ihn ging das nichts an!! Morgen früh würde die drahtlos herbeigerufene Hilfe ihn von der unfreiwilligen Haft befreien — und dann ade, verwunschene Felseninsel. Aber interessant waren die Einblicke in ein wohlorganisiertes Rettungswesen doch.
Ein Blick auf die Uhr. Er hatte noch genügend Zeit, um in aller Muße sein Entdeckungswerk fortzusetzen.
Wieder schob sich vor die Gedanken das Bild der langen Schienenbahn. Sie wollte zu dem, was er hier sah, nicht passen! Der Raum, in dem er sich befand, war gewiß eine natürliche Höhle gewesen, nur künstlich erweitert und ausgebaut. Sie lag nach Süden. Auf dem nördlichen Tropengürtel der Erde hätte sie zweckentsprechend nach Norden gerichtet sein müssen. Gewiß günstig in diesem heißfeuchten Klima, um die Nahrungsmittel kühl zu lagern und Menschen einen erträglichen Aufenthalt zu schaffen. Und trotzdem! Man hätte das alles viel einfacher anlegen können. Aber wer weiß, was die Erbauer ursprünglich vorgehabt hatten. Doch so kam er nicht weiter. Er mußte sich die Höhle noch genauer ansehen.
Da! Was war das? Ein lauter, dumpfer Knall — draußen!
Zu Tode erschrocken fuhr er hoch.
»Um Gottes willen! Die Maschine — sie wird doch nicht?«
Wie ein Rasender sprang er zur Tür, stoppte jedoch ganz plötzlich ab.
›Der Hut! Tropensonne — mein Hut‹, hämmerten die Gedanken. Aber wo war sein Hut? Ja, wo war denn seine Jacke? Hatte er beides nicht vor kurzem an den Haken gehängt?
Er stürzte hinaus, jagte in langen Sprüngen den Felsweg hinunter. An der Biegung mußte er freie Sicht auf den Hafen haben.
›Hilf, Himmel! Das Flugzeug brennt!‹
Der heißgelaufene Motor! Die stechende Sonne auf dem Felsboden! Feuer gefangen!
›Der Schaumlöscher, der Schaumlöscher!‹
Wenn er nur noch rechtzeitig anlangte.
Er stolperte. Riß sich hoch.
Eine Stichflamme schoß aus dem Flugzeug.
Ein Feuermeer ergoß sich über die Schienenbahn. Brennendes Benzin floß züngelnd ins Meer.
Wild prasselten die Flammen.
Schwere, schwarze Rauchwolken wälzten sich ihm entgegen, hemmten die Sicht.
Zu spät!
Mit keuchenden Lungen erreichte er vor Verzweiflung fast irre die sengende Glut. Hier gab es keine Hilfe mehr! Flugzeug und Sender — den Sender, der ihn retten sollte, fraß das leckende, tobende Flammenmeer.
Als Martin Damm seine Klause, wie er sie inzwischen getauft hatte, wieder erreichte, war er gefaßt. »Hätte ich doch dies oder das«, hatte er kurzerhand als nutzlosen Gedankenballast über Bord geworfen. Das Unglück war nun einmal geschehen, und die Tatsachen waren nicht mehr zu ändern, trafen sie ihn auch noch so hart. Damit mußte er sich eben abfinden, und je rascher, desto besser für zukünftige Entschlüsse. Was konnte im schlimmsten Fall schon eintreten? Ein paar Wochen, einige Monate ein Eremitendasein! Die Rettungsstation wurde, nach ihrem Zustand zu urteilen, in regelmäßigen Zwischenräumen von einem Dampfer angelaufen. Diese Hoffnung war ihm gewiß. Obendrein würde man ab morgen nach ihm suchen! Da mußte seine nach Cap Leeuwin gemeldete Maschine dann als überfällig auf der Liste stehen. Die großen Maschinen des Internationalen Flugrettungsdienstes würden ihren Patrouillendienst auf der gleichen Route, die er angegeben hatte, aufnehmen. Es galt nur aufzupassen und Signalmittel vorzubereiten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken!
Seine Lage war nicht im geringsten verzweifelt!
Er betrat den Felsenraum.
Da hingen ja Hut und Rock friedlich am Haken.
»So etwas! Daß ich sie vorhin nicht gesehen habe!«
Kopfschüttelnd ließ er sich nieder.
Ging es hier nicht mit rechten Dingen zu? Als geschulter Wissenschaftler überprüfte er seine Erinnerungsbilder. Dort hatte er gesessen; hier, an der Stelle, fast an der Türschwelle, gestoppt, sich umgewandt, nach dem Haken geblickt. Er sprang auf und wiederholte die Handlungen.
Dicht vor ihm an der rechten Seite des Felsenraumes, zum Greifen nahe, hingen, plastisch von der dunklen Wand abstechend, der helle Hut und das graue Jackett. Er brauchte nur den Arm auszustrecken und hinzulangen.
Hatte er das vorhin nicht gesehen?
Völlig unmöglich! Und wenn er tausendmal in Furcht um seine Maschine geschwebt, bange Ahnungen ihn zu großer Hast getrieben hatten, den Hut nicht gesehen zu haben, das war unmöglich.
Spukte es hier?
Die seltsamen Gefühle, die ihn beim Anstieg schier gelähmt hatten, tauchten vor der Erinnerung auf.
Irgend etwas ging hier nicht mit rechten Dingen zu. Daran gab es jetzt keinen Zweifel mehr.
Martin Damm nahm, von einer plötzlichen Eingebung getrieben, Hut und Rock von dem kleinen Kleiderhaken, warf beide achtlos auf den Tisch und trat dicht an die Wand.
Die Finger glitten sorgsam prüfend über die glatte Gesteinsfläche.
»Aha! — Also doch!« — Ein leiser Pfiff kam von seinen Lippen.
Die Wand war nicht fugenlos, wie der erste Augenschein vermuten ließ. Hier liefen die Rillen, kaum wahrnehmbar und doch dem aufmerksamen Beobachter deutlich sichtbar. Der Daumennagel verfolgte die schmale Ritze hinauf, seitwärts, hinunter, wieder seitwärts zum Ausgangspunkt zurückkehrend. Ein rechteckiger Rahmen im Gestein, und mitten in der umgrenzten Fläche ragten die Kleiderhaken.
Wenn diese fugenumrahmte Fläche, einer Klappe gleich, nach innen schwenkbar war, dann stellte die gesamte Einrichtung eine kleine, geheimnisvolle, sehr geschickt angelegte Tür dar, durch welche vorhin Hut und Rock verschwunden sein konnten.
Martin Damm pfiff leise vor sich hin und wappnete sich. Das waren keine dummen Hirngespinste gewesen, von denen er genarrt worden zu sein glaubte. Hier hausten außer ihm noch andre Menschen, zumindest einer, der ihn auf dem Wege beobachtet und ein unerklärliches Interesse an dem Inhalt der Jackentaschen bekundet hatte.
Sollte etwa sein Flugzeug auch ... ?
»Guten Tag, Herr Doktor Damm!«
Wie vom Schlag getroffen, fuhr Martin Damm herum.
»Sie suchen mich vergebens, Herr Doktor Damm!«
Die Stimme des Unsichtbaren klang irgendwoher aus einem Lautsprecher. Martin Damm zwang die durchgehenden Nerven zur Ruhe. Er fühlte, wie sein Leib zitterte.
»Alle Ehre!—Sie haben meine kleine Geheimtür entdeckt. — Bin von Natur etwas neugierig. — Wollte wissen, wer sich da mit einem Flugzeug zu mir verirrte. — Nun, Sie haben Rock und Hut ja wieder!«
Nur unter Aufbietung seines letzten Willens gelang es Martin Damm, langsam Herr seines Körpers und der jagenden Sinne zu werden. Nach der Entdeckung der Klappe war er auf eine höchst unliebsame Überraschung vorbereitet, dennoch traf der Schock zu jäh. Er schwieg beharrlich.
Mochte der Unbekannte reden. Jener sollte seine Stimme nicht beben hören.
»Ich bedauere Ihren Unglücksfall, Herr Doktor Damm, bedauere ihn aufrichtig!« Sehr höflich klangen die Worte, doch schwang ein Unterton von Spott und Überheblichkeit darin, der mehr als Unbehagen hervorrief. »Darf ich Sie bitten, mein Gast zu sein, bis der nächste Dampfer hier anlegt?«
›Dampfer anlegen? Eher werden wohl die Suchflugzeuge kommen‹, dachte Martin Damm. Doch er schwieg.
»Bitte schreiten Sie geradeaus weiter und drücken Sie gegen die Felswand zwischen Herd und Schrank!«
Martin Damm zögerte. Sollte er weglaufen? Doch wohin? Der Unheimliche besaß Macht, das hatte er vorhin zu spüren bekommen.
Sich zur Wehr setzen? Gegen wen?
Eine solche Ungeschicklichkeit würde in der mißlichen Lage, in der er sich befand, nicht voraussehbare Zwangsmaßnahmen hervorrufen.
Ruhe bewahren!
Den Willfährigen spielen, das dürfte die beste Tarnung darstellen.
Alles Weitere mußte sich ergeben, wenn der geheimnisvolle Gegner vor ihm stand.
Martin Damm griff, immer noch zögernd, nach Hut und Jacke auf dem Tisch, raffte sie auf, ging mit endgültig gefaßtem Entschluß auf die angegebene Stelle zu und stemmte die Schulter gegen die Felsenwand. Sie gab nach. Ein Tor, einer steinernen Grabplatte ähnlich, schwang auf. Im Dämmerlicht unsichtbarer Leuchtröhren erblickten die erstaunten Augen ein wohnlich eingerichtetes Gemach. Er betrat es. Hinter dem Eintretenden schnappte automatisch die Felsentür fast lautlos ins Schloß. Niemand war zu sehen. Von irgendwoher hörte er eine Stimme:
»Verzeihen Sie bitte die scheinbar schlechte Beleuchtung. Sie erleichtert Ihnen das Sehen! — Bitte wollen Sie in dem Klubsessel dort Platz nehmen!«
Martin Damm führte mechanisch die Weisung aus. Er fühlte sich gefangen, wehrlos. Was sollte das heißen, sie erleichtert Ihnen das Sehen? Wie kann schlechtes Licht das Sehen erleichtern? Sein Selbstbewußtsein bäumte sich gegen den herausfordernden Spott auf. Das tückische Vorgehen des Unsichtbaren schmeckte verteufelt nach Freiheitsberaubung. Abwarten! Nicht die Kräfte in nutzlosen Spekulationen verzetteln. Der erwartete Angriff mußte bald erfolgen. Ihn rechtzeitig zu parieren, davon hing sein Geschick ab.
Damm saß bequem und harrte entschlossen der Dinge, die nun kommen würden.
Da flammte vor ihm in der Wand eine umrahmte Fläche hell auf. Wie Mattglas schimmerte der opalisierende Grund in ständigem Flimmern.
Ein Kopf tauchte auf.
›Aha! — Fernsehen!‹ dachte der Physiker Damm. ›Daher das schlechte Licht, damit ich den Leuchtschirm besser erkennen kann.‹
»Sie werden gewiß über die merkwürdige Art der Begrüßung erstaunt sein, Herr Doktor Damm!«, sprach der lebensgroße Kopf auf dem Leuchtschirm. Dunkles, strähniges Haar umrahmte ein markantes Gesicht, das vor allem durch einen harten Mund und ein eckiges Kinn gekennzeichnet war. Die Augen blickten ihn groß und brennend an.
»Ich kann Ihnen leider nicht die Hände schütteln, da sie noch nicht von den Bakterien dieser Welt befreit sind. — Sie schauen mich sehr erstaunt an, Herr Doktor Damm. — Sie haben keineswegs mit einem Irren zu tun!« Die Lippen lächelten sarkastisch. »Ich persönlich bin überzeugt, im Vollbesitz aller geistigen Kräfte zu sein. — Sie denken jetzt, das behaupten alle Irren! — Nein, nein, ich bin weder Gedankenleser noch verfüge ich über geheimnisvolle Apparate, die mir das Hirn meines Gegenübers entschleiern. Ich beobachte Sie nur sehr genau, und Ihr lebhaftes Mienenspiel verrät dem aufmerksamen Beobachter Ihre Regungen. Sie sitzen in ultraviolettem Licht, das Ihr Auge nicht beeinträchtigt, das Bild auf dem Leuchtschirm zu verfolgen. Andererseits wird dadurch der Empfängerlinse der Fernsehapparatur so viel Energie zugeführt, daß ich Sie ausgezeichnet erkennen kann. Eine Tabakfaser hängt an Ihrer Unterlippe. — Jetzt haben Sie sie weggewischt. — Wenn Sie rauchen wollen, bitte bedienen Sie sich. In dem Schrank zu Ihrer Linken finden Sie alles!«
»Danke! Ich bin versorgt!« Das waren die ersten Worte, die Doktor Martin Damm hier sprach. Er zündete sich eine Zigarette an, doch dann ärgerte er sich, daß er sich dem fremden Willen untergeordnet hatte.
»Nun habe ich wenigstens einmal Ihre Stimme gehört«, sprach der Kopf, die Augen lächelten gutmütig, aber in seinen Worten schwang wieder der Hochmut, der Damm stets aufs neue aufbegehren ließ.
»Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß Sie sich hier unbehaglich, ja vergewaltigt fühlen, Herr Doktor!«
›Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen‹, dachte Damm nur, und blieb die Antwort schuldig.
»Um so mehr wird es Sie überraschen«, fuhr unbeirrt der sprechende Kopf fort, »wenn ich Ihnen versichere, daß Sie ohne Ihren bedauerlichen Flugzeugunfall in einigen Wochen auch hier säßen.« Der Unbekannte schien von der Überraschung Martin Damms keine Kenntnis zu nehmen.
»Wenn ich richtig informiert bin, wollten Sie zum Internationalen Geologenkongreß nach Adelaide und anschließend mit Ihrem Gerät in Neuseeland auf Bitten der dortigen Regierung Untersuchungen anstellen.«
›Zeitungen wird er sich auf seinem verwunschenen Felsenschloß wohl kaum halten‹, überlegte Martin Damm. Dafür dürfte seine Radiostation, gemessen an dem ausgezeichneten Fernseher, zweifellos auf der Höhe sein und alle Tagesneuigkeiten der Welt aufnehmen. Also kein Kunststück zu wissen, was der Geologe Martin Damm vorhatte. Der Kopf sprach schon wieder:
»Sie hätten in Neuseeland einen Mittelsmann von mir kennengelernt, der Ihnen mein Angebot überbracht hätte, auf einige Wochen mein Gast zu sein und gegen das bei Ihnen übliche Honorar geologische Untersuchungen, an denen mir sehr viel gelegen ist, auf dieser Insel vorzunehmen. Durch einen mehr als eigenartigen Zufall sind Sie früher, als ich es je zu hoffen gewagt hätte, mein Gast geworden. Es fehlt nur noch Ihr freundliches Einverständnis zu meinem Vorschlag.«
›Du gehst ja mächtig ins Zeug‹, sann Martin Damm, vor sich hinpaffend. Irgendwie reizte es ihn, den Geheimnissen dieses Zauberladens auf die Spur zu kommen, um so mehr, als er trotz seiner großen Kenntnisse der Erdoberfläche niemals davon gehört hatte, daß diese kleine Insel im Indischen Ozean bewohnt sei. Hier handelte es sich offensichtlich nicht um eine einfache Siedlung, sondern um weit mehr. Der technische Aufwand, den er bis jetzt kennengelernt hatte, war höchst beachtlich. Was verlor er schon, wenn er das Angebot annahm? In Überanstrengung würde die Arbeit gewiß nicht ausarten, dafür war der Flecken zu klein. Neuseeland lief ihm nicht fort, und eine Ausspannung für einige Wochen konnte ihm gewiß nicht schaden. Trotzdem! Zurückhaltung war geboten, besonders nach dem zweifelhaften Erlebnis mit der verschwundenen Jacke.
»Sie mißtrauen mir, Herr Doktor Damm?« Das Gesicht im Fernseher lächelte.
›Zum Kuckuck! Kann der Bursche doch Gedanken lesen‹, überkam es Martin Damm.
»Ich gebe zu, daß Ihre Erfahrung mit den zeitweise abhanden gekommenen Bekleidungsstücken Ihr Mißtrauen wachrufen mußte. Sie werden aber gewiß einsehen, daß ich nicht anders handeln konnte, um in den Besitz Ihrer Personalien zu kommen. Ich bevorzuge das Überraschungsmoment. Es führt oft schneller zum Ziel! Aus durchaus natürlichen Gründen bin ich gezwungen, in der Auswahl meiner Gäste einen besonderen Maßstab anzulegen. Wer mir nicht paßt, betritt dieses Zimmer nie!«
Martin Damm betrachtete forschend den willensharten Zug, der sich jetzt im Antlitz seines Leuchtbildgegenübers abzeichnete.
»So war ich leider auch bei Ihnen gezwungen, den Taschendieb zu spielen, konnte ich doch nicht ahnen, daß ausgerechnet Sie, dessen Besuch mir besonders wertvoll ist, der Schiffbrüchige sein würden. Ich hoffe, daß meine formelle Entschuldigung, die ich hiermit ausspreche, Ihnen genügen wird.«
Martin Damm nickte Zusage. Die weltmännische Art, in der jener die Worte vorbrachte, berührte ihn angenehm. Überdies mußte er im stillen anerkennen, daß die Methode ohne Zweifel zum gewünschten Erfolg geführt hatte.
»Ich, würde nun gerne von Ihnen hören, wie Sie sich zu meinem Vorschlag stellen.«
›Wollen doch mal sehen, wie du reagierst‹, dachte Martin Damm. Er zündete sich eine neue Zigarette an und begann:
»Sie werden verstehen, daß mir Ihr Anerbieten überraschend kommt und meine bereits getroffenen Dispositionen einer Änderung unterwirft, die mir nicht sehr gelegen ist!«
»Hat der Flugzeugunfall nicht bereits diese unliebsame Änderung herbeigeführt?« forschte das unverändert höfliche Gesicht.
»Ernstlich wohl kaum«, entgegnete Martin Damm ebenso verbindlich.
»Wenn ich den Sinn Ihrer Worte richtig verstehe, hoffen Sie auf den Internationalen Flugrettungsdienst?«
»Ja! Spätestens morgen mittag werden die schnellen Suchmaschinen meine Flugroute abfliegen und dabei diese Insel wohl schwerlich außer acht lassen. Die Trümmer meines verbrannten Flugzeugs dürften kaum zu übersehen sein! Zur Tagung nach Adelaide träfe ich nur mit geringfügiger Verspätung ein.«
»Selbstverständlich werde ich Ihnen mit allen Mitteln behilflich sein. Meine große Sendestation steht Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung, die Seenotbergungsflugzeuge hierher zu peilen!« Die großzügige Geste wurde betont durch den warmen Klang der Worte.
Martin Damm schwieg einen Augenblick verblüfft. Das unerwartete Entgegenkommen ließ seine Lage in ganz anderem Licht erscheinen. Auf eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit schien jener es wirklich nicht abgesehen zu haben. Trotzdem warnte ihn ein dunkles Gefühl, den glatten Worten nicht übereilt zu trauen. Den großen faszinierenden Augen in dem stumm abwartenden Gesicht ihm gegenüber waren recht wohl suggestive Kräfte zuzumuten. Der verhexte Zustand vorhin beim Aufstieg zu der Felsenklause schmeckte zu sehr nach Hypnose. Indien, das Land der Fakire und Zaubermittel, war nicht weit. Er selbst hatte dort schon recht seltsame Erfahrungen gemacht.
Er wurde unschlüssig.
»Einen Augenblick bitte, Herr Doktor Damm! Entschuldigen Sie mich für einige Minuten. — Ich werde am Fernsprecher verlangt!« Das Gesicht verschwand. Der Leuchtschirm flimmerte.
Fernsprecher schien es demnach hier auch zu geben. Weiß der Kuckuck, wie groß die gesamten Anlagen waren. Sollte etwa das Berginnere ein einziges Labyrinth von künstlich angelegten Stollen und Räumen darstellen? Wozu?
Die rätselhafte Angelegenheit reizte Martin Damm von neuem. Sein Wunsch, den Zweck der einstweilen noch schleierhaften Geheimnisse, besonders der hochmodernen Technik, zu entdecken, trieb ihn zu einer Zusage.
Er stand auf, durchmaß unruhig den Raum und ging dann wie von ungefähr an den Schrank, den der Herr der Insel ihm gewiesen hatte. Er öffnete ihn. Großer Gott! Der Vorrat an Tabakwaren aus aller Welt, an Zigarren, Zigaretten, ja sogar Seemannspriem einbegriffen, mußte ewig reichen. Er schloß die Tür wieder und zündete sich eine von seinen eigenen Zigaretten an. ›Verdammte Pafferei‹, sann er. Doch das Rauchen beruhigte ihn.
Hierbleiben? — Wegfliegen? — Hierbleiben? — Wegfliegen? Mit jedem Schritt schwankte sein Entschluß.
Was hatte jener da für kurioses Zeug geredet? Er sei noch nicht frei von Bazillen dieser Welt? Das schien demnach so eine Art Quarantänezimmer zu sein, in dem er sich befand. Groteske Idee, die Ankömmlinge erst zu desinfizieren.
Was bei allen Teufeln mochte dahinterstecken?
›Der fängt dich mit deiner eigenen Neugier‹, höhnte sein zweites Ich. Martin Damm lächelte vor sich hin. Der Zwiespalt seiner Gefühle begann ihn zu belustigen, zumal er sich frei eingestand, daß seine Wißbegier die Haupttriebfeder war, das Angebot anzunehmen und für einige Wochen hier zu bleiben.
Plötzlich stutzte er.
Mit wem wollte er denn eigentlich das Abkommen tätigen? Dieser seltsame Heilige hatte es bis jetzt noch nicht einmal für nötig befunden, seinen Namen zu nennen.
Er wandte sich seinem Ledersessel zu. Im gleichen Augenblick tauchte auch der Kopf wieder im Rahmen des großen Leuchtschirmes auf. Der Unbekannte redete sofort los:
»Ich habe Sie hoffentlich nicht zu lange warten lassen, Herr Doktor Damm? — Nein? — Dann bin ich beruhigt! Gestatten Sie übrigens, daß ich nachhole, was ich längst hätte tun sollen. Ich habe mich Ihnen noch gar nicht vorgestellt. Verzeihen Sie bitte diese Unhöflichkeit. Ich weiß selbst nicht, was eine derartige ungehörige Vergeßlichkeit veranlaßt hat. Sill ist mein Name.« Nach einer kurzen Pause des Beobachtens setzte der Kopf lächelnd hinzu: »Vielleicht haben Sie den Namen schon einmal gehört?«
Ohne die Antwort abzuwarten, fuhr er gleich fort:
»Ich will Sie nicht drängen, Herr Doktor Damm! Nichts liegt mir ferner! Sie sollen völlig Herr Ihrer freien Entschlüsse sein. Doch halte ich es für richtig, etwas zu unternehmen. Hören Sie! Mir wurde eben von meiner Nachrichtenzentrale mitgeteilt, daß seit etwa zehn Minuten von der australischen Sendestation des Flughafens bei Cap Leeuwin Funkanrufe für Ihre Maschine durchgegeben werden. Man vermißt Ihre Standortmeldungen. Ich halte es für unverantwortlich, den umfangreichen Rettungsdienst in Tätigkeit treten zu lassen. Was schlagen Sie vor?«
»Lassen Sie bitte zurücksenden, daß ich hier auf der Insel notgelandet bin und mich sehr wohlfühle!«
»Und —?« fragte der Kopf, ihn gelassen anblickend.
»Mit Ihrer gütigen Genehmigung beabsichtige ich vorerst hier zu bleiben.«
Da war es heraus. Martin Damm wunderte sich über sich selbst, daß er so kurz entschlossen zusagte.
»Ich werde sofort das Entsprechende veranlassen!« Seine Augen leuchteten aus dem Bildschirm in freudiger Genugtuung. Ja, Martin Damm schien es sogar, daß sie ihn dankbar anblickten.
»Ist es Ihnen recht, wenn ich gleichzeitig den Vorstand der geologischen Gesellschaft in Adelaide benachrichtige, daß zu Ihrem großen Bedauern Ihr Unfall Veranlassung sei, nicht an der Sitzung teilnehmen zu können?«
»Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie ein Telegramm in diesem Sinne abfassen und hinüberfunken würden«, antwortete Martin Damm.
»Selbstverständlich, gern! Ich stehe Ihnen voll zur Verfügung. Diese Angelegenheit wäre somit geklärt. Sie werden es mir bitte nicht verargen, wenn ich Sie jetzt für eine kleine halbe Stunde allein lasse. In dem anderen Schrank finden Sie eine Reihe von Büchern, von denen das eine oder andere Sie gewiß interessieren wird. Seien Sie so gütig und vertreiben Sie sich mit einer kurzen Lektüre einstweilen die Zeit. Es liegen sehr dringende Dinge vor, über die ich disponieren muß. Der tägliche Dienstplan hält selbst mich so in seinen Fängen, daß ich unvorbereitet laufende Arbeiten nicht auf die lange Bank schieben kann.«
»Dafür habe ich volles Verständnis«, entgegnete Martin Damm. »Bitte lassen Sie sich durch mich nicht stören. Gewiß können wir nachher noch in Muße das von Ihnen vorgeschlagene Abkommen und die Tätigkeit, die sich für mich daraus ergibt, durchsprechen!«
»Ich werde es so einrichten, daß ich Ihnen dann ungestört zur Verfügung stehe!«
»Verbindlichen Dank, Herr Doktor Sill!«
Um Sills Lippen spielte ein leichtes Lächeln, das sehr wohl ausdrücken mochte: ›Aha! Er kennt also doch meinen Namen, sonst könnte er den Titel nicht verwenden.‹
»Auf Wiedersehen, bis nachher!«
»Auf Wiedersehen«, erwiderte Martin Damm.
Sills Kopf verschwand, der Leuchtschirm erlosch und in Damms Raum flammte helleres Licht auf.
Zu gleicher Zeit wurde von mehreren Radiostationen, darunter auch der australischen bei Cap Leeuwin, eine Meldung aufgenommen, die offensichtlich von einem kleinen, schwachen Sender stammte. Sie besagte, daß die indische Bark ›Bengalia‹ mit Kurs von Südafrika nach Singapore unterwegs einen Doktor Martin Damm aus Seenot gerettet habe. Das Flugzeug sei nicht mehr zu bergen gewesen. Der Gerettete befinde sich an Bord wohl und werde bis Singapore mitgenommen. Die Funkmeldung war leicht verstümmelt, offenbar von ungeübter Hand gemorst. Doch ihr Sinn trat klar zutage.
Erst später entdeckte man, daß eine indische Bark »Bengalia« in keinem Schiffsregister geführt wurde.
Von Doktor Martin Damm fehlte von diesem Augenblick an jegliche Spur.
Martin Damm saß am Tisch. Er hatte es sich in einem Sessel bequem gemacht. Vor ihm lag aufgeschlagen ein Buch aus der rasch durchstöberten Bibliothek. Einige Seiten waren die Augen den Zeilen gefolgt, dann aber hatte er die Gedanken, die ihn bedrängten, nicht mehr abweisen können.
Was tut hier dieser Sill?
Er erinnerte sich eines Artikels in der Fachpresse — es mochte einige Jahre her sein — der von den umstürzenden Entdeckungen eines Doktor Sill berichtete. Sill stammte danach, wenn sein Gedächtnis nicht trog, aus Südamerika, hatte in Deutschland vor dem zweiten Weltkrieg studiert und sich dann nach den Vereinigten Staaten begeben. Wie es häufig derartigen Referaten, die nicht direkt aus der Feder des Urhebers stammten, erging, lautete der Bericht etwas verschwommen und unklar und schmeckte ein wenig nach Sensation. Ein späterer Artikel stellte einige Bemerkungen richtig und war Anlaß zu heftigen Debatten in Forscherkreisen. Sill wollte angeblich das Problem der künstlichen Ernährung des Menschen ohne Einschränkung gelöst haben. Nach einer kurzen Zeit der Umstellung des Organismus sollte es möglich sein, dem Körper die erforderlichen Nährstoffe in konzentrierter Form, als Pillen, zuzuführen, ohne die Leistungen im geringsten zu beeinträchtigen. Das war, soweit sich Martin Damm nach längerem Grübeln erinnerte, der Inhalt des Fachartikels gewesen. Auch die Tagespresse hatte ihn wiedergegeben, in der üblichen effekthaschenden Form, dann war es still geworden um die epochale Entdeckung. Eingeweihte wollten später wissen, daß die Regierung der Vereinigten Staaten in Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Chemiekonzern Doktor Sill eine phantastische Summe geboten haben sollte, unter der Bedingung, seine Geheimpatente abzutreten, sie nie auszunutzen und sich von allen Arbeiten auf diesem Gebiete zurückzuziehen. Sill sollte sich, so wollte die Fama wissen, als vielfacher Millionär zur Ruhe gesetzt haben und irgendwo andersgearteten wissenschaftlichen Liebhabereien leben.
Nun tauchte er hier auf, und das bisher Gesehene und Erlebte paßte vorzüglich zu dem Bilde eines Forschers, der sich von der Öffentlichkeit vertragsgemäß zurückgezogen hatte, um, mit immensem Kapital ausgerüstet und von aller Welt abgeschieden, seine Ziele dennoch im geheimen weiterzuverfolgen.
Unter solchen Gesichtspunkten fand manches durchaus seine Erklärung. Ein allzu offenes Spiel hätte gewiß seine Vertragspartner aufmerksam machen und zu Auseinandersetzungen über diese oder jene Klausel des Abkommens führen müssen, die eine Verletzung des Vertrages in den Bereich der Möglichkeit zogen. Hier war Sill sicher, wenigstens so lange sicher, als nichts von seinem Unterfangen in die Öffentlichkeit drang.
An diesem Punkte der Überlegungen angekommen, verwirrten sich Martin Damms Gedanken. Er glaubte da eine Tragweite seines Entschlusses zu erkennen, die er nicht abzuschätzen wußte. Sill lebte gewiß nicht einsam hier in seiner Felsenburg. Erstens konnte er allein die vielfachen technischen Einrichtungen gar nicht geschaffen haben und unterhalten, und zweitens benötigte er, falls er überhaupt die gleichen Experimente weiterverfolgte, Menschenmaterial zu ihrer Erprobung. Beherbergte dieser Felsen aber weitere Menschen, so mußten diese ihm entweder auf Gedeih und Verderb verschworen sein, oder aber Zwang hielt sie davon zurück, ihr Wissen in die Welt auszuposaunen. Dieser Gedanke bedrückte Martin Damm außerordentlich. Was würde aus ihm werden, wenn Sill ihn nicht gutwillig ziehen ließ? Und wenn er ihm diese Möglichkeit dennoch bot, so mußte er ein erhebliches Vertrauen in seine, Martin Damms, Verschwiegenheit setzen, ein Vertrauen, das nicht so ohne weiteres gerechtfertigt war, stand doch zu viel für Sill auf dem Spiel.
Das war ein Wust von Überlegungen, durch den er trotz allen Nachdenkens und Abwägens nicht hindurchfand. Bei aller Neugier, das Tätigkeitsfeld dieses Mannes in seinen Einzelheiten kennenzulernen, überwogen doch kühl rechnende Stimmen, die auf die Gefahren hinwiesen, denen er sich aussetzte und unter denen die, von dem Zwingherrn dieser Felsenburg auf unabsehbare Zeiten als Gefangener jeder Entschlußfreiheit beraubt zu werden, die beunruhigendste war.
Es bestand zwar die Möglichkeit, daß Eingeweihte in USA. sehr wohl über die Vorgänge hier im Bilde waren und Sill kontrollierten. Das zwänge jenen selbstverständlich, das noch zu tätigende Abkommen einzuhalten, ein Gedanke, der für Damm große Bedeutung hatte. Auf alle Fälle hätte er jedoch entschieden besser daran getan, sich zunächst einmal von den Rettungsflugzeugen aufnehmen zu lassen, in Adelaide Erkundigungen einzuziehen und dann nach hier zurückzukehren.
Seine Entscheidungen jetzt noch zu ändern, lehnte er selbst ab. Käme doch eine solche Meinungsänderung einem schlecht verhehlten Mißtrauensbeweis gleich, der nur weiteren Schaden brächte. Er beendete seine Überlegungen mit dem Entschluß, die Dinge so, wie sie sich gestaltet hatten, erst einmal weiterlaufen zu lassen. Seine Freunde in Adelaide waren ja durch Sills Radiotelegramme benachrichtigt und wußten, wo er sich befand. Wenn nach Monaten nichts von ihm zu hören wäre, würden sie schon Schritte unternehmen, um festzustellen, warum er nicht die zugesagten Arbeiten aufnähme.
Martin Damm hatte seine Ruhe wiedergefunden, griff zu dem Buch, um es bald darauf, mit neuen Betrachtungen beschäftigt, abermals zur Seite zu legen. Sill hatte von geologischen Untersuchungen gesprochen. Nun, solange sich diese in kleinem Rahmen hielten, waren sie durchführbar. Zu umfassenden Forschungen aber benötigte er sein Gerät, und das war mit dem Flugzeug verbrannt. So schien es durchaus notwendig zu werden, daß er ein neues baute. Das aber würde keine Schwierigkeiten ergeben, denn die Konstruktionsunterlagen besaß er. Gab es hier Werkstätten, was nach allem bisher Gesehenen außer Frage stand, und die erforderlichen elektrotechnischen Materialien — auch diese waren gewiß vorhanden in Anbetracht des Fernsehens und der vorhin von Sill erwähnten Sendestation — so erforderte ein Neubau vielleicht acht bis zehn Tage, sofern ihm geschickte Mechaniker zur Hand gingen. Er würde ja bald erfahren, wie weit seine Vermutungen, daß sich im Inneren des Felsendomes weitverzweigte Unterkunfts- und Arbeitsräume befänden, den Tatsachen entsprächen. Martin Damm schmiedete Pläne, wie er mit einfachen Hilfsmitteln sein elektrogeologisches Peilgerät zusammenbasteln könne.
Der Lautsprecher unterbrach sein Sinnen.
»Verzeihung, wenn mein Anruf Sie stören sollte! Ich schicke Ihnen gleich durch Rohrpost den Entwurf zu unserem vorhin besprochenen Abkommen. Der Entnahmebehälter für den Tubus befindet sich rechts neben dem Lichtbildrahmen. — Ich spreche von einem Raum ohne Fernsehapparatur. — Sehen Sie bitte den Vertrag durch und treffen Sie die Änderungen, die Ihnen angebracht erscheinen. — In etwa zehn Minuten stehe ich zu Ihrer Verfügung. — Eines noch unterließ ich vergeßlicher Gastgeber zu fragen. Haben Sie Hunger oder Durst? Tischzeit ist hier erst gegen halb zwei. Möchten Sie inzwischen vielleicht ein kleines Frühstück? Nach unserer Zeit ist es jetzt erst kurz nach elf. Ich bitte um Ihre Wünsche!«
»Mein Appetit ist noch zu zähmen. Für etwas Trinkbares wäre ich Ihnen allerdings dankbar, Herr Doktor Sill!«
»Wie Sie wünschen! Vor Ihnen in der Wand befindet sich die ,Futterklappe‹, wie wir sie hier nennen, ein Ihnen jederzeit gefügiges Tischleindeckdich. Ich gebe gleich Anweisung, daß Getränke serviert werden. Wählen Sie, was Ihnen gefällt. — Bis gleich«, setzte die Stimme freundlich hinzu.
Kurze Zeit darauf flammte zunächst ein Signal der Rohrpost auf, dann ein zweites über einem hellen Holzrahmen.
Martin Damm entnahm dem Aluminiumbehälter den zusammengerollten Vertrag und aus der rasch geöffneten Klappe ein Tablett mit mehreren Flaschen, Gläsern und außerdem noch einen Siphon Mineralwasser.
Angelegentlich betrachtete er zunächst die Flaschen. Reichlich verblüfft musterte er die Aufschriften, die nur aus großen lateinischen Buchstaben und Zahlen, A 17, F 4, R 52 usw. bestanden. Er hatte die in der heißen Zone üblichen Getränke erwartet: Eis, Whisky, Kognak, Wermut und Gin. Nichts dergleichen stand lockend vor ihm auf dem Tisch.
Wenn da wenigstens eine Gebrauchsanweisung beigefügt wäre. Was sollte F 4 heißen? Mißtrauisch öffnete er den Verschluß und schenkte ein. Eine weinbrandgelbe, klare Flüssigkeit floß in das Glas.
Gespannt kostete er den Inhalt.
Nicht mal so übel! Aber was war das? Irgendeine synthetische Mischung? — Schmeckte gar nicht so schlecht. Kühl, leicht bitter und sehr erfrischend. Er mixte ein zweites Glas mit Sodawasser. Der Geschmack war noch gehoben, löschte höchst angenehm den Durst.
Weiter! Jetzt mal A 17 probiert. Eine dunkelrote, cherry-brandyartige Flüssigkeit lief in die Schale. A 17 war entschieden alkoholhaltig. Mit Wasser verdünnt, erinnerte es an den Geschmack einer tropischen Frucht, deren Name ihm im Moment entfallen war.
Nun an R 52! — Wasserklar glitzerte der Inhalt im Glas. Er schnupperte, setzte das Getränk an die Lippen, nahm einen guten Schluck. Pfui, Spinne! Das brannte ja scharf wie eine Pfefferlösung. Martin Damm hustete empört. Magen und Kehle schienen mit Höllenstein geätzt zu sein. Dann aber durchpulste ihn wohlige Wärme. Das Brennen ließ rasch nach und wandelte sich in ein Gefühl allgemeiner Belebung. Gleichzeitig war der eben noch empfundene leichte Appetit völlig geschwunden.
Dieser Zauberer Sill schien tatsächlich die Ernährungsprobleme auf seine Art gelöst zu haben. Durst und Hunger wurden mit erstaunlich geringen Mengen gestillt, das Wohlbefinden unglaublich schnell gehoben. Dieses kleine Experiment, das er unfreiwillig an sich ausgeführt hatte, paßte vorzüglich zu den vorhin angestellten Überlegungen. Wie hatte Sill sich doch ausgedrückt? ,Ich liebe das Überraschungsmoment. Es führt geschwinder zum Ziel.‹ Diesem Prinzip huldigte Sill offensichtlich, und, wie Damm anerkennend zugeben mußte, durchaus mit Erfolg.
An dem Vertragsentwurf, den Damm einer gewissenhaften Prüfung unterzog, war nichts auszusetzen. Die Formulierungen waren knapp und klar gefaßt. Genaue Abgrenzung von Pflichten und Rechten gaben dem Ganzen in keinem Fall den Charakter eines sogenannten Krawattenvertrages. Lediglich die Dauer seiner Tätigkeit für Doktor Sill war nicht präzise festgelegt. Zunächst war sie auf drei Monate bemessen. Diese Frist konnte jedoch überschritten werden, falls die Arbeiten sich umfangreicher, als vorauszusehen war, gestalteten. Bedingung blieb die restlose Erfüllung der Aufgaben.
Dieser Passus barg Bedenken in sich. Andererseits konnte die Berechtigung einer solchen Forderung nicht verkannt werden. Der Auftraggeber verlangte ganze Arbeit und nichts Halbes. Nun, es lag ja schließlich an ihm, Martin Damm, sich so zu beeilen, daß er innerhalb der vorgesehenen drei Monate fertig wurde, zumal kaum anzunehmen war, daß auf dieser kleinen Insel der Umfang geologischer Forschung ein zu großes Maß annehmen könnte.
Er beschloß, den Vertrag, so wie er vor ihm lag, zu unterschreiben. Die finanziellen Bedingungen waren außerordentlich günstig.
Martin Damm griff gedankenlos zu der gewohnten Zigarette, tat, nachdem er sie angezündet hatte, einen Zug, um sie sofort wieder aus den Lippen zu nehmen und mißtrauisch zu betrachten. Was war denn mit der Zigarette los? Der Rauch kratzte, schmeckte abscheulich. Noch ein Zug! War da ein Haar in den Tabak geraten? Pfui Teufel! Er drückte die Glut im Aschenbecher aus. Der Appetit auf eine neue war ihm vergangen. Sollte etwa dieser Doktor Sill ein Gesundheitsfanatiker sein, der den Getränken ein Mittel zusetzte, sich das schädliche Rauchen abzugewöhnen? Der Gedanke machte ihn stutzig. War das schon wieder ein Eingriff in die persönliche Freiheit, wie er ihn schon einige Male gemutmaßt hatte? Seine Empfindungen lehnten sich gegen derartige Vorstellungen auf. Er langte abermals zu dem Vertrag und las ihn mit mißtrauen geschärften Blicken erneut durch. Nein! Hier gab es gottlob nichts zu deuteln und zu feilschen. Mit Verträgen kannte er sich aus. Es mußte wohl an der Stimmung hier liegen, daß er so reizbar und vorsichtig wurde. Er schob das Papier auf den Tisch zurück.
Einige Minuten mochten verstrichen sein, da flammte der große Leuchtschirm auf, gleichzeitig versank die Deckenbeleuchtung in das schon gewöhnte Dämmerlicht. Der Kopf Doktor Sills erschien, der Lautsprecher ertönte:
»Nun, Herr Doktor Damm, wie ist die Vertragsprüfung ausgefallen? Ich hoffe die beiderseitigen Interessen so berücksichtigt zu haben, daß eine gedeihliche Zusammenarbeit gewährleistet ist, sofern ein Stück Papier solches vermag. Ausschlaggebend sind schließlich die rein menschlichen Beziehungen. Doch was mich anlangt, so dürfen Sie überzeugt sein, daß ich das Schwergewicht gerade auf die Pflege dieser Beziehungen zu legen gewillt bin, gibt es doch nichts Schöneres, als eine starke, lebensbejahende Kameradschaft unter Männern, eine Kameradschaft, die in diesem Falle dazu noch einen sehr regen Austausch geistiger und wissenschaftlicher Erkenntnisse verspricht. Solche Gelegenheit versäumen hieße der Götter Gunst verscherzen!«
Martin Damm lachte. Er freute sich der heiteren und aufgeschlossenen Art, die das Mienenspiel des Kopfes und die klangvolle Stimme austrahlte.
»Der Vertrag sagt mir zu«, antwortete er rasch. »Ich akzeptiere!«
»Ihr Lob freut mich aufrichtig. Ich lasse Ihnen im Lauf des Tages zwei von mir unterschriebene Exemplare zugehen. Stecken Sie bitte eines davon mit Ihrer Unterschrift versehen in die Rohrpostkapsel.« Er machte eine kurze Pause, dann sprach er weiter: »Darf ich mir erlauben, Ihnen jetzt noch ein kleines Plauderstündchen vorzuschlagen? Sie werden gewiß viel zu fragen haben! Ich sehe, Sie rauchen nicht mehr?«
Martin Damm erkannte deutlich, wie der Schalk die Lippen Dr. Sills umspielte.
»Sie stellen die Frage gewiß nicht ohne Zweck, mein verehrter Gastgeber und Zauberkünstler«, meinte er humorvoll. Sein Auge glänzte vor Spottlust.
»Sie haben also den Braten gerochen«, fragte Sill.
»Gerochen und geschmeckt«, entgegnete Damm. »Nur schien mir der erwähnte Braten reichlich angebrannt! — A 17 vermutlich!«
»Die Zusammenhänge sind Ihnen somit klar«, wollte Sill wissen.
»Freiheitsberaubung zum Zweck der Gesundheitsförderung«, hieb Doktor Damm sarkastisch zurück.
»Um Gottes willen! Sehen Sie die Dinge nicht so an!« Jetzt war es an Sill, laut zu lachen, und er tat es weidlich. Zum ersten Male sah und hörte Damm den markanten Kopf ungezwungen lachen. »Nichts liegt mir ferner«, fuhr jener fort, »als Ihre Entschlußfreiheit einzuschränken und Sie mit Gesundheitsprinzipien zu vergewaltigen!« Die Freude verebbte. »Sie haben aber ganz richtig kombiniert, wenn Sie annehmen, daß A 17 Ihnen den Appetit auf Ihre geliebte Zigarette nahm. Doch hören Sie! Ich muß etwas weiter ausholen, um Ihnen diesen Vorgang erklärlich zu machen. Ich gehe wohl auch nicht fehl, wenn ich behaupte, daß Sie um mein Werk und meine Erfindung einiges wissen?«
»Ich las in der Fachpresse darüber!«
»So kennen Sie das Hauptsächliche. Auch daß ich mehr oder minder gezwungen war, meine Geheimpatente zu verkaufen, dürfte Ihnen bekannt sein!«
Martin Damm nickte.
»Mir wurde untersagt, in den USA. oder sonst einem Staate meine Experimente weiterzubetreiben. Nicht verboten blieb mir, an irgendeinem weltabgeschiedenen Platze dieser Erde die Entwicklung fortzuführen, unter der Voraussetzung allerdings, daß dieser Platz so abgeschieden sei, daß keinerlei Rückwirkungen auf die Weltwirtschaft eintreten könnten. Man hat wohl damit gerechnet, daß ich einen derartigen Ort im Zeitalter des Verkehrs, der die entlegensten Gegenden erschließt, niemals finden würde. Ich fand ihn trotzdem. Doch die Geschichte der Entdeckung dieser Insel steht auf einem anderen Blatt! Davon später! Zunächst möchte ich Ihnen die ominöse Wirkung von A 17 erklären. Heute früh deutete ich Ihnen schon einmal an, daß Sie noch nicht frei von Bazillen der Erde seien. Es währt etwa vierzehn Tage, bis Sie diesen Zustand in der Quarantäne erreicht haben. Ich brauche diese Bazillenfreiheit, damit nicht hereingetragene Infektionen meine Versuche stören. Während dieser Zeit gewöhnen Sie sich auch an die sogenannte künstliche Ernährung, das heißt eine Ernährung auf synthetischer Grundlage. Da der menschliche Magen nun einmal an gewisse Mengen von Nahrungsmitteln gewöhnt ist, verträgt er es nicht, wenn er zu plötzlich ganz kleine Quantitäten verabfolgt erhält. Es treten dann sehr schmerzhafte Störungen auf, die zur Krebsbildung ausarten können. Das ist durch jahrelange Versuche erwiesen. Andererseits kann die erstrebte geringfügige Magenschrumpfung ohne Gefährdung der Gesundheit und des allgemeinen körperlichen Wohlbefindens sehr wohl erzielt werden. Sie sehen mich als Vertreter dieser Spezies Mensch blühend und gesund, wenn auch nur im Leuchtbild vor sich. Selbst die Rückführung auf die sonst übliche Ernährung bietet keinerlei Schwierigkeiten. Etwaiger Sorgen in diesem Punkte enthebt Sie meine feste Versicherung.
Nun kann ich sehr wohl jegliche Art von Konserven ohne Schwierigkeiten völlig steril machen und diese bazillenfreie Nahrung sozusagen als Füllsel dem Magen zuführen. Ich kann aber nicht Zigaretten, Zigarren oder Tabak sterilisieren, ohne Geschmack und Aroma zu beeinträchtigen, so daß von einem Genuß kaum die Rede mehr sein kann. Man raucht schließlich um dieses Genusses willen. Tabak ist ein Naturprodukt, und zwar ein sehr empfindliches Naturprodukt. Meine Versuche, Tabak zu sterilisieren, sind sämtlich gescheitert. Um nun einerseits meinen Mitarbeitern gewohnte Freudenspender nicht zu entziehen, andererseits jegliche Bazillen fernzuhalten, entschloß ich mich zu Experimenten, die in A 17 ihre Krönung fanden. Dieses A 17 enthält ein synthetisches Nikotinderivat, einen Stoff, der bei dem bisher gewohnten Rauchen Widerwillen hervorruft, ferner eine neue hochpolymere Aminosäure, welche das Hungergefühl stillt — jeder, der sich das Rauchen abgewöhnen will, empfindet bekanntlich längere Zeit Hunger — und drittens ein von mir erfundenes höheres Vitamin, das sehr rasch ein höchst angenehmes Wohlbefinden erzeugt. Trinken Sie getrost pro Tag einige Gläser A 17, und Sie werden am eigenen Leibe erfahren, wie alle Rauchernervosität schwindet und ihre Spannkraft sich steigert. Wollen Sie das aber nicht, so bedienen Sie sich bitte während der nächsten vierzehn Tage noch der reichen Vorräte, die Sie dort im Schrank finden. Später, nach Ihrem Übertritt in das eigentliche Werk, müssen Sie sich allerdings der Anordnung fügen und das Rauchen unterlassen. Diese Forderung kann ich im allgemeinen Interesse nicht mildern! Doch was bedeutet es schon, drei Monate auf einen gewohnten Genuß zu verzichten, wenn ein anderer vollwertiger Ersatz dafür geboten wird!«
Der Kopf lächelte in sympathischem Wohlwollen.
»Empfinden Sie jetzt eine Entbehrung?« setzte Sill rasch hinzu.
»Nicht im geringsten«, entfuhr es Martin Damm. »Im Gegenteil, ich fühle mich außerordentlich wohl und bin Ihnen von Rechts wegen Dank schuldig, auf solche angenehme Art von einem Laster befreit zu werden. Sie sollten Ihr Mittel der ganzen Welt zur Verfügung stellen. Ich glaube, daß Millionen Ihre Wohltat preisen würden!«
»— O je!« Doktor Sill lachte laut. »Sie sind ein Optimist! Die um ihr Geschäft besorgten Tabakpflanzer und Rauchwarenfabrikanten würden mich lynchen! Das wäre der einzige Erfolg dieser Wohltat. Jahrhunderte alte Gewohnheiten der Menschheit antasten, ist eine Herausforderung, die stets mit dem Untergang des Weltverbesserers endet. Dafür danke ich! Mir genügt das Bewußtsein, daß diejenigen, die mir die Leitung ihrer Geschicke anvertraut haben, zufrieden sind und sich blühender Gesundheit erfreuen. Inwieweit sich meine Praktiken einmal auf die Allgemeinheit übertragen lassen, muß die Zukunft lehren. Ich persönlich bin fest überzeugt, daß die urweltlichen und veralteten Ernährungsmethoden und die gesundheitsgefährdenden Genußmittel einer überholten Vergangenheit angehören. Eines Tages wird meine Stunde kommen, ich werde die Menschheit erlösen und ihr Besseres schenken! — Das will ich und das werde ich!«
Die letzten Sätze waren erbarmungslos hart ausgesprochen. Ein prophetischer Fanatismus verzerrte das eben noch so ruhige Antlitz Sills. Er strich ungeduldig die dunkle Haarsträhne aus der Stirn.
›In diesem Punkt ist er mit Vorsicht zu genießen‹, dachte Martin Damm. ›Ich werde mir das merken. Der Welterlösungsgedanke scheint seine Manie zu sein. Nun, viele große Männer haben ihre Marotten. Solange sich diese im kleinen austoben, sind sie ungefährlich. Trotzdem möchte ich nicht zu denen gehören, die sich ihm anvertrauen.‹ Sagte Sill eben noch etwas? Nein. Nun gut, dann mußte er von diesem Thema ablenken:
»Weiß man in USA. übrigens von Ihrem Werk hier?«
»Hm —. Man läßt mich in Ruhe!« Das unbewegliche Gesicht verriet nichts, doch aus dem Ton klang deutliche Abweisung.
›Also auch das dürfte ein neuralgischer Punkt sein‹, überlegte Martin Damm rasch. Die Unterhaltung drohte auf ein totes Gleis zu geraten.
»Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?« fragte er weiter, teils aus Neugier, teils um auf ein anderes Gebiet überzuleiten. »Oder berührt diese Frage ein Geheimnis, das Sie ungern preisgeben?« setzte er entschuldigend hinzu.
»Durchaus nicht«, entgegnete Dr. Sill jetzt wieder in gewohnter Verbindlichkeit. »Sie werden ja doch in kurzer Zeit erfahren, was jetzt zu verschweigen eine unentschuldbare Unaufrichtigkeit wäre. — Und nichts hasse ich mehr im Verkehr mit Männern als diplomatische Umschweife oder gar — sagen wir getrost Lügen!« Die letzten Worte waren sehr bestimmt gesprochen. Das Mienenspiel des Kopfes unterstrich sie in unmißverständlicher Weise. Der da sprach, war ein Wahrheitsfanatiker. Für den Bruchteil einer unmeßbar kleinen Zeitspanne schob sich vor Martin Damms Gedanken die schreckhafte Vorstellung eines überwältigenden Schauspielers, die sofort wieder unter dem freundlichen Lächeln Sills zerrann. Die Zunge strich leicht über die Lippen, die Augen waren sinnend erhoben und faßten die Doktor Damms.
»Ich beschäftige zur Zeit fast tausend Mitarbeiter!« Im Blick lag der Triumph voll ausgekosteter Überraschung.
»Donnerwetter!« war die einzige Entgegnung des verblüfften Damm.
»Ja! — Sie staunen?«
»Tausend Menschen hier in diesem Berg? — Das ist ja unfaßbar! — Wie ist das möglich? Hier in diesen Steinhöhlen ...?«
»Nun, die Probleme liegen einfacher, als Sie vermuten. Sehen Sie, die gesamte gewaltige Felskuppe ist nämlich innen hohl und mißt auf ihren Grundflächen fast zwei Quadratkilometer, das sind 800 Morgen, so daß auf jeden Einwohner fast ein Morgen Land entfällt. An Überbesiedlung leiden wir hier also noch lange nicht!«
Martin Damms Mienenspiel war so offen, daß Sill ohne Schwierigkeit ablesen konnte, was in dem Hirn des erfahrenen Geologen im Augenblick vorging. Über allem stand der Zweifel, Zweifel sogar an der Zurechnungsfähigkeit des Herrn der Insel.
»Sie halten mich für verrückt?«
»Das will ich nicht gesagt haben«, entfuhr es Martin Damm allzu schnell.
»Aber doch so etwas Ähnliches«, lachte der Kopf an der Leuchtscheibe.
»Na ja —.« Martin Damm war sich plötzlich einer nie gekannten Befangenheit bewußt.
»Ich an Ihrer Stelle würde genau so denken«, sagte Sill. Wie eine rein sachliche Feststellung klangen die Worte. Dann belebten sich die Züge, als er fortfuhr: »Es würde zu weit führen, Ihnen im Augenblick alles zu erklären. Bitte legen Sie es mir nicht als Unhöflichkeit aus, wenn ich Ihnen nicht gleich jetzt, sondern erst später die gewünschten Auskünfte erteile. Heute abend stehe ich Ihnen zur Verfügung, solange Sie wünschen. Ich mache Ihnen daher den Vorschlag, bis heute abend sich die Zeit ganz nach Ihrem Belieben einzuteilen. Wenn Sie wollen, lesen Sie hier, oder gehen Sie noch einmal hinaus zu Ihrer leider unrettbar verlorenen Maschine. Der heutige Tag gehört noch ganz Ihnen. Nach Unterzeichnung des Vertrages bitte ich aber, sich dann völlig für die kurze Spanne Ihres Aufenthaltes den hiesigen Gepflogenheiten unterzuordnen. Sie haben noch Muße und Entschlußfreiheit, sich alles reiflich zu überlegen. Falls Sie Bedenken haben sollten, das Abkommen einzugehen, so sprechen Sie diese frei und offen aus. Gegebenenfalls werde ich sofort funktelegraphisch veranlassen, daß Seenotflugzeuge Sie hier abholen. Freuen würde ich mich allerdings, aufrichtig freuen, wenn unser Pakt perfekt würde!« Jetzt warb Sill in fast sehnsüchtigem Vertrauen um Verständnis und Zuneigung!
»Ich darf mich jetzt verabschieden, Herr Doktor Damm? — Bis heute abend gegen neun Uhr. — Halt, ehe ich es vergesse! Um halb zwei finden Sie hier Ihr Mittagessen vor, besser gesagt ein ›ausgiebiges zweites Frühstück‹, gegen fünf den Tee und nach acht das Abendessen. Um neun etwa melde ich mich wieder. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein?«
Martin Damm verneinte freundlich, fügte dann hinzu: »Wenn es Ihnen recht ist, werde ich mich ein wenig mit dem geologischen Aufbau dieses Eilands beschäftigen, sofern das von draußen möglich ist.«
»Freut mich außerordentlich. Ich werde Ihnen Hammer und Meißel durch den Essenaufzug übermitteln, falls Sie Gesteinsproben abschlagen wollen. — Also dann bis heute abend«, lachte noch einmal der Kopf. Dann erlosch das Licht auf dem Leuchtschirm in dem viereckigen Holzrahmen.
Martin Damm lag in den Nachmittagsstunden auf einer der Molenköpfe, unter sich eine Wolldecke, die er von einer der Kojenbetten aus dem Vorraum mitgenommen hatte. Sein Kopf ruhte auf den verschränkten Unterarmen. Eintönig, fast einschläfernd rauschte das Meer sein Lied. Ein kurzes Bad hatte den von der Mittagshitze erschlafften Körper neu gestärkt. Seine Gedanken umkreisten immer wieder die gleichen Probleme, die ihn seit Betreten dieser Insel so fieberhaft beschäftigten.
Je besser es ihm gelang, aus der Vielfalt der Erlebnisse Eindruck auf Eindruck als klare Bilder aufzureihen, desto verschwommener, widerspruchsvoller, ja beängstigender wurde die Gesamtwirkung. So sehr er sich dagegen auch wehrte, er wurde das Gefühl nicht los, hier möglicherweise überrumpelt und gefangen worden zu sein.
Vor ihm ragte der riesenhafte Felsdom auf. War er tatsächlich hohl? — Und lebten da drinnen wirklich an die tausend Menschen — Experimentierobjekte eines vielleicht Irrsinnigen? Gefangene wie er? Was wollte jener mit tausend Menschen? Wie kamen sie hierher? Freiwillig? Wer wußte, daß sie hier waren, hier lebten, vielleicht nur elend vegetierten, mit einer brennenden Sehnsucht im Herzen, die Freiheit wiederzugewinnen, jene Freiheit, die er im Begriff stand, vielleicht für immer aufzugeben. Wenn er den Arbeitskontrakt nicht unterschrieb? — Nichts würde dadurch an seiner Lage geändert! Ohne fremde Hilfe war nicht von hier fortzukommen!
Der einzige, der diese bot, bieten konnte, war Sill, wenn er wollte — ja wenn! Und wenn jener wollte, daß er, Damm, hierbliebe, dann mußte er bleiben, mit oder ohne unterschriebenen Vertrag. Ausweglos durchhetzten die Gedanken diese Kreiselbahn, aus der es kein Entrinnen gab.
Inzwischen hatte Martin Damm, den Geologenhammer in der Hand und einen kleinen zweckdienlichen Meißel in der Tasche, das Felsengemach verlassen. In der »Futterklappe« stand, als er die Werkzeuge herausnahm, eine Flasche, daneben lag ein Zettel: »Trinken Sie, wenn Sie wollen, ein kleines Glas W 37. Ihre geliebten Zigaretten und die Pfeife schmecken Ihnen dann wieder zu dem heutigen Ausflug. Ihr Sill!«
Er hatte bereits, um an sich selbst die Wirkung dieser höchst merkwürdigen Wundermedizin zu erproben, einen Schluck der klaren Flüssigkeit getrunken und hatte sich, nach wenigen Minuten von einem kaum beherrschbaren Zwang ergriffen, die Pfeife wieder angesteckt. Sie schmeckte ihm selten köstlich. Offensichtlich verstand Dr. Sill sein Metier ausgezeichnet. Gesteinsproben, die er an geeigneten Stellen des Weges abschlug, ergaben stets den gleichen Befund: Diabas, jenes basaltisch-vulkanische Gestein aus der Urzeit der Erde. Unvorstellbar nur, daß unter diesen Umständen der Felsendom hohl sein sollte, wie Sill behauptete. Er versuchte, sich eine Theorie zurechtzulegen, wie eine derartige Erscheinung geologisch zu deuten sein könnte. Vollauf mit seinen Überlegungen beschäftigt, erblickte er bei einer Biegung des Pfades das Flugzeugwrack und schritt rasch voran. Das Heck der Maschine lag im Wasser. Wäre es möglich, daß noch Teile seines Gepäcks, das dort verstaut lag, unversehrt geblieben sein konnten?
Die erst nur vage Vermutung war nach einer viertelstündigen Bergungstätigkeit einer beglückenden Wirklichkeit gewichen. Zwei wassergetränkte Lederkoffer und die wichtigsten Teile seiner elektrischen Peilsonde lagen auf dem sonnenüberglühten Felsboden. Wie weit die Instrumente noch brauchbar sein würden, mußte erst die genaue Prüfung ergeben, nachdem sie ausgebaut und gereinigt waren. Auf alle Fälle dürfte jetzt schon, das stand fest, ein völliger Neubau nicht erforderlich sein. Darauf machte sich Martin Damm ans Auspacken, um die Koffer und deren Inhalt zu trocknen, denn das Gepäck besaß in dem wasserdurchtränkten Zustand ein derartiges Gewicht, daß an einen Transport den steilen Weg aufwärts gar nicht zu denken war.
Damm wäre nicht ein erfahrener Flieger gewesen, hätte es ihn nach einer kurzen Pause nicht gereizt, der Ursache des Brandes auf die Spur zu kommen, soweit das jetzt noch möglich war. Der rechte Flügel wies an der Stelle, wo sich der Benzintank befand, durch eine Explosion starke Zerstörungen auf. Der rechte, nun das war jener, an dem sich der Motor heißgelaufen hatte. Er kletterte vorsichtig auf der Tragfläche herum und musterte prüfend das bloßgelegte Innere. Und dann — dann machte er eine Entdeckung, die wie eine Zange sein gesamtes Denken umgriff. An einem steil in die Luft spreizenden Aluminiumfetzen befand sich ein Loch, ein kreisrundes Loch von etwa fünfundzwanzig Millimeter Durchmesser, ein Loch, dessen Rundung leicht nach innen gebörtelt war, ein Loch, das einer Einschußöffnung so gleichkam, daß... Martin Damm besaß keine Waffen an Bord, die ein derartiges Loch verursacht haben könnten. Überdies, da gab es keinen Zweifel, bewies der Tatbestand eindeutig, daß das unheimliche Loch von außen nach innen geschlagen worden war und niemals umgekehrt. Von außen nach innen!? Ein fünfundzwanzig Millimeter starkes Loch mit einschußähnlichen Randungen von außen nach innen geschlagen — genau vor dem Benzintank?
Martin Damm schnellte hoch. Er war an einer weiteren Untersuchung nicht mehr interessiert. Der Befund genügte ihm bereits. Er wußte, was er davon zu halten hatte. Wer anders konnte diese Tat begangen oder zumindest veranlaßt haben als Sill, Herr Dr. Sill? Er war dafür verantwortlich, daß sein Flugzeug in Flammen aufgegangen war. Und warum und zu welchem Zweck? Nun, das stand außer Frage. Um ihn zu zwingen, hierzubleiben! Solcher Verbrechen war also der Mann fähig, mit dem er einen Vertrag abzuschließen im Begriff stand, einen Vertrag auf Treu und Glauben! Jener Mann, jener Sill, der von sich behauptete, daß er die Wahrheit über alles stelle und liebe — und der es dann fertigbrachte, sein Flugzeug in Brand zu schießen — dieser heuchlerische Schuft!
Minuten währte der Zustand aus Angst, Schauder, ohnmächtiger Wut und Ekel, dann hatte er sich wieder gefaßt.
Er raffte einen Teil der bereits trockenen Sachen zusammen und verstaute sie in einem der allerdings noch reichlich feuchten Koffer. Es war Zeit zum Mittagessen.
Viermal machte er nach der Mahlzeit, die zwar höchst seltsam aussah, aber ausgezeichnet mundete, noch den Weg nach oben, bis alle Gegenstände in seinem neuen Aufenthaltsraume ruhten. Dann ging er abermals hinunter, badete kurz und lag nun auf einer der Steinmolen. Über die Stellung, die er zu beziehen hatte, war er sich jetzt völlig im klaren. Die Warnung des Schicksals durfte er diesmal nicht wieder unbeachtet lassen. Wenn er die Freiheit wiedererringen wollte, mußte er List gegen List setzen und Schlag mit Gegenschlag beantworten. Vor allem aber mußte er sich unter der Maske des Biedermannes das Vertrauen seines Gegners erwerben, denn nur so konnte er hinter seine Schliche kommen. Vor dem Tode fürchtete er sich nicht. Der kam doch, früher oder später. Wenn er wenigstens seinen Sender noch gerettet hätte, um wieviel einfacher wäre seine Situation dann gewesen! Aber er würde es auch so schaffen. Er stand auf, blickte noch einmal lange hinaus auf das Meer. Dann raffte er die Wolldecke zusammen, warf sie über die Schulter und machte sich an die Arbeit, das geologische Gefüge dieses Felsendomes näher zu ergründen. Viel Erfolg versprach er sich nicht von solcher Tätigkeit. Bis jetzt hatten alle Gesteinsproben nur mehr oder minder dasselbe ergeben: Diabas. Doch Arbeit lenkt ab!
Vor dem Abendessen bastelte Martin Damm an seinen elektrischen Geräten herum und befreite, soweit es irgend möglich war, die ausgebauten Teile von den letzten Resten des ätzenden Meerwassers. Er würde nachher Sill bitten, ihm einiges Spezialwerkzeug, Vaseline und Watte zu überlassen, um die Peilsonde wieder gebrauchsfähig zu machen.
Ein schnurrender Summerton ließ ihn auffahren. In der »Futterklappe« stand die Mahlzeit. Er breitete die weiße Decke, die er am Mittag schon in einem Regal gefunden, über den Tisch und trug die Platten auf. Eine Flasche und ein Glas vervollständigten das Abendessen.
Was war das nun wieder für ein seltsames Zeug? In einer kleinen Schale lagen drei Pillen. Auf einer der Platten befand sich ein dem Rumpsteak ähnliches Etwas, das beim Zerteilen mit der Gabel wie ein Gemengsel von gebratenen Haferflocken mit Kraut ausschaute. Auf den anderen Platten stapelten sich einige heiße Röstbrotschnitten. Als er sie mit dem Finger betupfte, fühlten sie sich quallig wie Teig an. Er kostete zuerst das eigenartige Rumpsteak. Es mundete vorzüglich. Dazu aß er die Schnitten. Auch diese waren von delikatem Geschmack, einem Geschmack, der mit keinem bisher bekannten irgendwie zu vergleichen war. Die teigigen Röstbrotschnitten schmeckten fast wie Hummer oder Thunfisch.
Die Verblüffung steigerte sich noch, als er den Inhalt der Flasche erprobte. Das war ja ein ganz köstlicher Moselwein bester Lage. Oder doch nicht?
Der Nachgeschmack ließ ein wenig zu wünschen übrig, war eine Spur flach, als ob der Wein überlagert sei, die natürliche Säure nicht ganz ausreichte. Noch ein genießerisches Kosten. ›Du hast schon schlechteren getrunken als diesen‹, sann Martin Damm, ,und wenn die Verpflegung so bleibt, hab' ich nichts dagegen einzuwenden!‹ Sill hatte heute früh doch so gegen die widernatürliche Ernährung gewettert, und nun spendierte der Hohe Herr veritablen Moselwein, denn Alkohol war da drin, das spürte er. Außerdem konnte man Wein auch nicht ›desinfizieren‹, genau so wenig wie Tabak. Oder? — Sollte dieses Getränk etwa gleichfalls synthetisch sein, künstlich hergestellt? ›Laß es sein, was es will‹, grübelte Martin Damm vor sich hin. ,Es schmeckt.‹ Zuletzt schluckte er die drei Pillen und wollte sich angenehm gesättigt in den weichen Sessel zurücklehnen, doch besann er sich eines anderen und räumte das Geschirr in die ›Futterklappe‹.
Ein leises Schnurren. Das Geschirr entschwand den beobachtenden Blicken.
Schnell war das Tischtuch zusammengefaltet und verstaut, Flasche und Glas wieder hingestellt, und nun machte sich's Martin Damm bequem. Der blaue Rauch einer rasch angezündeten Zigarette zog zur Decke.
Was zeigte die elektrische Uhr dort oben an der Wand? Kurz nach halb neun. Er hatte Muße, seine Gedanken noch einmal zu ordnen und seine Marschroute endgültig festzulegen. Mit der Tatsache seiner Gefangenschaft hatte er sich abgefunden. Sills Angebot, funktelegraphisch ein Seenotflugzeug anzufordern, das ihn abholen würde, falls er Bedenken haben sollte, das Abkommen einzugehen, war ohne Zweifel auch nur eine Finte, um ihn in Sicherheit zu wiegen. Und das andere alles? Sollte er sich noch weiter damit herumquälen? Unsinn!
Damm füllte sein Glas. Die Uhr ging auf neun. Er empfand deutlich das leichte Vibrieren der Nerven, einem Jäger gleich, wenn das Wild auf die Lichtung getreten ist, der Finger am kalten Abzug ruht und es gilt, den tödlichen Blattschuß anzubringen. In dem Wettkampf der Geister hieß es jetzt nur noch: Du oder ich!
Er trank.
Da erhellte sich die Sichtscheibe. Im gleichen Augenblick begann der Lautsprecher leise zu brummen. Der Herr der Insel kündigte sich an.
Martin Damm straffte sich, setzte sein Glas zurück auf den Tisch. Die Deckenlampe verlosch. Die Leuchtröhren tauchten den Raum in ein violettweißes Dämmern.
Jetzt flammte das Bild des Fernsehers auf. Sill saß wie er an einem Tisch, vor sich eine Flasche, genau wie er. Der Kopf erschien nicht mehr wie heute früh im Großformat. Genau so würde ihn jetzt gewiß Sill sehen. Die Szene wirkte anheimelnder und so lebenswahr, als ob man sich tatsächlich gegenübersäße, nur war alles kleiner, eben im Format des Leuchtschirmes, aber schließlich in der Praxis des modernen Lebens, im Zeitalter des Fernsehens, ein gewohnter Anblick.
Ein lächelndes Beobachten drüben, dann öffnete sich der Mund, der Lautsprecher gab es wieder:
»So! Mein verehrter Gast! Des Tages Mühe hätten wir hinter uns. Jetzt wollen wir zwei es uns recht bequem machen. — Wissen Sie, so ein tiefschürfender Meinungsaustausch, eine waschechte Fachsimpelei, bei einem guten Tropfen bis in die frühen Morgenstunden, so etwas gibt es eigentlich nur in Deutschland. — Hab ich noch in guter Erinnerung von meiner Studentenzeit her.
Und wenn es nach mir ginge, möchte ich die guten alten Zeiten hier einmal auffrischen. Sie sind doch hoffentlich nicht müde oder mitgenommen von den heutigen Ereignissen —?«
Ein besorgter Blick prüfte sein Quasi-Gegenüber.
»Nicht die Spur, Herr Doktor Sill«, antwortete wahrheitsgetreu Martin Damm, der sich jetzt auch bewußt wurde, daß tatsächlich die mancherlei seelischen Erregungen des Tages keine Folgen hinterlassen hatten. Ob das an der seltsamen Kost lag?
»Das freut mich, freut mich aufrichtig«, entgegnete sichtlich noch besser gelaunt Sill. »Doch —«, ein leichtes Zögern, fast eine tastende Befangenheit, die rasch von übermütiger Lebhaftigkeit abgelöst wurde.
»Wollen wir zwei nicht in solch vertrauter Zwiesprache, wenn sie auch jetzt noch per Fernseher erfolgt, unsere beiderseitigen akademischen Grade aus dem Spiel lassen? Ich bin kein Freund von übertriebenen Zeremonien, weiß nicht, ob's Ihnen genau so geht. Sill — Damm, Damm — Sill! Kurz und schmerzlos. — Eine hemmende Scheidewand zwischen gleichberechtigten Partnern niedergerissen! — Einverstanden?«
Ein warmer, um Vertrauen werbender Blick folgte den herzlich vorgetragenen Worten.
›Das Spiel geht los! Du legst dich ja mächtig ins Zeug‹, schoß es blitzschnell Martin Damm durch den Kopf, er lachte dann fröhlich auf und freute sich, wie echt das Lachen klang.
»Aber selbstverständlich! Was mich anlangt...«
»In diesem Falle: Prost denn, mein lieber Damm!« unterbrach ihn Sill. »Mit diesem Schluck herzlich willkommen in meinem Felsenbau, auf gute Kameradschaft und gedeihliche Zusammenarbeit!« Er hob sein Glas, und Martin Damm tat ihm Bescheid fast mit den gleichen Worten.
»Wie schmeckt Ihnen übrigens der Wein?«
Ein verschmitztes Beobachten Sills.
»Ausgezeichnet! Nur bringe ich ihn nicht in Ihrer aseptischen und sanitären Tabulatur unter«, erwiderte Damm rasch.
»Wieso?« Ein verblüfftes Hochschauen. »Ach, ich verstehe, von wegen nicht desinfizierbarer Naturprodukte, siehe Tabak?«
»Ganz richtig!«
»Seien Sie beruhigt — das heißt, es wird Ihnen schwer werden! Dieser Wein stammt nicht von den sonnenüberfluteten Hängen Ihres herrlichen Mosellandes, sondern«, hier machte er eine kurze Pause, um die Wirkung zu steigern, »aus meiner eigenen Fabrikation!«
»Donnerwetter! Diese Mitteilung ist tatsächlich dazu angetan, einen aus der Ruhe zu bringen«, entgegnete sichtlich überrascht Martin Damm. »Den köstlichen Tropfen haben Sie künstlich hergestellt?«
»Ja!« Genugtuung blitzte aus den Augen Sills. »Und ich hoffe, Ihnen heute abend noch weitere Proben vorsetzen zu können, die die Güte dieses Getränkes noch beträchtlich übertreffen!«
Damm brauchte nicht zu schauspielern. Er konnte dem Gefühl unverhohlener Hochachtung freien Lauf lassen. Dieser Wein stellte fürwahr eine Meisterleistung chemischer Kunstprodukte dar. Er nahm das Glas, schnupperte prüfend die köstliche Blume, trank schlürfend, in kleinen Zügen, die Zunge mehrfach gegen den Gaumen pressend, und sondierte in leichtem Schnalzen den Nachgeschmack.
Sill beobachtete befriedigt jede seiner Gesten, die den erfahrenen Kenner verrieten.
»Na?« fragte er, setzte jedoch temperamentvoll gleich hinzu: »Nehmen wir an, ich wäre Weinhändler und Sie der Käufer. Würden Sie den Wein kaufen?«
»Wenn es Sie nicht verletzt, Herr Weinhändler, würde ich den Wein nicht kaufen«, antwortete belustigt Martin Damm in offensichtlich übertriebener Höflichkeit.
»Und warum nicht?« fragte wißbegierig Sill.
»Weil ich auch bei diesem Vorkosten feststellte, daß der Wein zu flach abläuft und die erst vorhandene, natürliche, feine Säure nicht nachhält.«
»Bravo!« rief Sill fast begeistert. »Bitte, gehen Sie doch mal zur Futterklappe. Dort stehen noch mehrere Flaschen kühl. Nehmen Sie bitte zuerst Nummer 117 und ein neues Glas!«
Daß seine Tätigkeit im Felsendom mit einer höchst beachtlichen Weinprobe beginnen würde, hatte sich Martin Damm nach den recht widerspruchsvollen Ereignissen des Tages nicht träumen lassen. Bei der zweiten Flasche kamen ihm Bedenken, daß Sill beabsichtigte, ihn trunken zu machen. Enthielt dieser fürwahr hervorragende Tropfen etwa Drogen, die ihn des freien Willens beraubten? Trotz sorgfältigster Selbstbeobachtung konnte er keine andere Wirkung feststellen, als die, die jedem natürlichen Wein innewohnt. Sill schien ein recht zechfroher Kumpan zu sein, wie sein in regelmäßigen Abständen neu gefülltes Glas erkennen ließ. Zudem zeigte er sich sehr aufgeschlossen und berichtete sehr eingehend, wie es ihm nach langen Experimenten gelungen sei, künstlichen Wein überhaupt herzustellen, um dann Schritt auf Schritt zu jener meisterhaften Beherrschung der Zusammensetzung der verschiedenen Grundstoffe zu kommen, die ein chemisch so kompliziertes Getränk wie Wein erforderte. Er offenbarte hierbei ein so reiches Wissen um organische Produkte, ihre Synthese und die Wirkung auf den menschlichen Organismus, daß Martin Damm ihm seine steigende Hochachtung nicht versagen konnte, um so weniger, als er im Laufe des Tages schon mehrere Ergebnisse dieses Wissens am eigenen Leibe erprobt hatte.
Noch mehr überrascht war er allerdings, als Sill ihm offenbarte, daß diese Weinfabrikation hier im großen Stil erfolge. Der Mensch benötige nach seiner Ansicht Anregungsmittel, die Freude und Wohlbefinden steigerten. Jedem seiner annähernd tausend Mitarbeiter stände Wein jederzeit zur Verfügung. Für Tee und Kaffee habe er gleichfalls vollwertigen Ersatz. Der einzige Zwang, den er ausübe, sei das Abgewöhnen des Rauchens, denn erstens habe er dafür keinen Ersatz, es sei denn in dem Getränk A 17, und zweitens erachte er das Rauchen für das nerven- und kreislaufschädigendste Laster, das sich die Menschheit angewöhnt habe.
Aus den gesamten Darlegungen formte sich allmählich für Martin Damm das Bild eines wahrhaften Idealisten. Von dem gemutmaßten Zwingherrn war nichts mehr zu verspüren. Zwangsläufig steigerte sich damit auch seine Neugier, den immer rätselhafter werdenden Betrieb der tausend Menschen kennenzulernen, denn je mehr Tatsachen offenbar wurden, desto mehr ungelöste Fragen ballten sich im Hintergrund.
»Rauchen Sie heute getrost noch, soviel Sie mögen«, sagte Sill nach einer kurzen Pause im Gespräch. »Morgen wird es Ihnen nicht mehr schmecken, und in wenigen Tagen werden Sie keine Neigung mehr verspüren. Aber bitte betrachten Sie das nicht als Zwang oder Einschränkung Ihres Selbstbestimmungsrechtes. Im Werk kann aus den dargelegten Gründen nicht geraucht werden, und wenn Sie später das Laster draußen in der Welt wieder aufnehmen wollen, so steht das völlig in Ihrem freien Ermessen. Ich sage das allerdings unter der Voraussetzung, daß Sie mein Abkommen akzeptieren!«
»Ist unterschrieben«, entgegnete Martin Damm. Er hatte den Gegner scharf beobachtet, ob sein Mienenspiel irgendeine Veränderung zeigte. Nichts dergleichen! Innerlich atmete er befreit auf. Seine entscheidenden Worte hatten so natürlich geklungen, daß sie selbst dem Argwöhnischsten keinen Aufschluß über sein wahres Sinnen und Trachten geboten hätten.
»Das freut mich aufrichtig! — Ich habe viel Arbeit für Sie«, sagte Sill schlicht. »Übrigens, haben Sie heute nachmittag etwas Besonderes entdeckt?«
Damm berichtete von dem spärlichen und wenig aufschlußreichen geologischen Befund. Sill nickte dazu, als ob er nicht ganz bei der Sache wäre. Die Schilderung der Bergung des noch unversehrten Gepäcks und besonders der elektrischen Peilsonde jedoch entlockte ihm helle Freude.
»Haben Sie die Meßinstrumente aus Ihrer Peilsonde schon ausgebaut?« lautete die hastige Frage.
»Ja!«
»Die müssen sofort in fachmännische Pflege, damit sie auch von den letzten Spuren des Meerwassers befreit werden. Ich weiß nicht, ob ich die entsprechenden Typen auf Lager habe, und von dem einwandfreien Arbeiten Ihres Gerätes hängt zu viel ab. Zeigen Sie sie doch bitte einmal her!«
Damm stand auf und legte vier runde Meßinstrumente auf den Tisch.
»Doch! Die passen gewiß in den Rohrposttubus! Bitte, stecken Sie sie doch gleich hinein. Ich werde sofort das Nötige veranlassen!«
Jetzt erhob sich auch Sill und entschwand aus dem Leuchtschirmbild, während Martin Damm der Aufforderung nachkam.
Kurze Zeit währte es nur, dann nahm er wieder Platz.
»Einer meiner Feinmechaniker nimmt sie sofort in Arbeit! Schade, daß ich das heute mittag noch nicht wußte. Wirklich schade! Kostbare Stunden haben wir ungenutzt verstreichen lassen. Na, nichts zu ändern! Hoffentlich klappt alles!« Er nahm einen Schluck aus dem Glase. »Was Ihre Koffer nebst Inhalt anbetrifft, so stellen Sie sie bitte morgen in die Luke hinter dem Garderobenhaken, von dem heute früh Ihre Jacke so rätselhaft entschwand!« Sill lächelte. »Wir werden das gesamte Zeug desinfizieren. Anzug und Wäsche, die Sie jetzt tragen, legen Sie bitte hinzu. Sie finden in Ihrem Schlafzimmer dort nebenan«, er deutete mit der Hand, »alles Erforderliche, sowie Gebrauchs- und Toilettengegenstände. Später schließt sich dann die große Felsentür zum Vorraum hermetisch und Ihr vierzehntägiger Desinfizierungsvorgang beginnt. — Unheimlich — wie?«
»Nun! — Auf ein schreckhafteres Gemüt, als ich es bin, würden Ihre Anordnungen schon mehr als unheimlich wirken«, meinte Martin Damm nur vergnügt. »Mich trifft es nicht!«
»Na, dann Prost auf die entzauberte Felsenburg«, lachte Sill.
»Da kann ich nicht nein sagen«, meinte Martin Damm und tat dem Hausherrn Bescheid.
»Noch eines möchte ich gerne heute abend klären«, begann Sill wieder. »Es handelt sich um Ihr Flugzeug. Was ist Ihnen das Wrack noch wert?«
Maßlos erstaunt blickte Martin Damm auf. Was kam jetzt? Er hatte sich sofort wieder in der Gewalt.
»Was soll mir das noch wert sein! Nichts«, entgegnete er scheinbar unbekümmert. »Es später bergen zu lassen lohnt nicht die Unkosten, die dabei entstehen. Außerdem bin ich gut versichert!«
»Es mag wohl sein«, erwiderte Sill, »daß es für Sie keinen Wert mehr darstellt, wohl aber für mich. Das Aluminium ist schließlich ein Rohmaterial, ganz abgesehen von den Motoren. Ich biete Ihnen fünftausend Dollar, zahlbar morgen früh, wenn Sie mir die Maschine überlassen. Ich lasse sie dann auf der Rollbahn einschleppen und ausschlachten!«
In diesem Augenblick ließ Martin Damm wie zufällig ein Schräubchen fallen, mit dem er schon eine Weile gespielt hatte. Er bückte sich danach. ›So, mein Freund, nun bist du in die Falle gegangen‹, sagten die Gedanken. ›Mag sein, daß du Rohmaterial, wie Aluminium, benötigst. Die Maschine soll verschwinden, bevor der Flugzeugsuchdienst seine Tätigkeit beginnt. Du hast nicht nach Adelaide gefunkt.‹ Die Rechte hatte die Schraube ertastet. Er richtete sich wieder auf und hatte sich voll in der Gewalt. Mochte sein Gesicht jetzt gerötet sein — ein Erbübel, das ihn zu leicht überkam, wenn er eine beschämende Entdeckung an seinen Nebenmenschen machte. Sill konnte diese Rötung nur als Folge des Bückens deuten.
Er sah wie jener teilnahmslos an seinem Glas nippte und dann wieder aufschaute. ›Aha! Also auch du konntest mir nicht frei ins Auge schauen.‹
Diese Erkenntnis gab Martin Damm das Gefühl der Überlegenheit zurück.
»Na, sagt Ihnen mein Angebot etwa nicht zu?« fragte Sill.
»Zusagen?« Martin Damm wiegte nachdenklich den Kopf. »Wenn ich ehrlich sein soll, dann muß ich Ihnen sagen, daß ich mir als Wucherer vorkäme, diese Summe anzunehmen. Das ausgebrannte Wrack ist das nicht mehr wert!«
»Mir schon! Mir schon, sonst würde ich so viel nicht bieten«, sagte Sill bestimmt.
›Kann ich mir denken, das corpus delicti muß verschwinden‹, durchzuckte es Damm. Unklar blieb ihm nur, warum Sill dieses Kauftheater vorspielte.
Da hub Sill schon wieder an:
»Also abgemacht? Sie brauchen Ihr Gewissen in keiner Form zu belasten. Ich benötige in Kürze etwa tausend Kilo Duraluminium. Soviel steckt in dem Wrack drin. Das Umschmelzen kostet mich weniger als ein etwaiger Transport von Europa. Die Rechnung geht genau auf. Morgen früh erhalten Sie per Rohrpost die fünftausend Dollar! Sie würden mir mit Ihrer Zusage einen großen Gefallen erweisen!«
Der Gleichmut, mit dem Sill seine doch nicht ganz glaubwürdige Erklärung vorbrachte, wirkte bestechend.
»Wenn es so steht, dann ja«, entgegnete Martin Damm bedächtig. »Hätte ich das vorher gewußt, so wäre es mir eine Freude gewesen, Ihnen die ausgebrannte Kiste sozusagen als Gastgeschenk zu übermitteln.«
»Ihr Anerbieten ehrt Sie, ehrt Sie außerordentlich! Doch es gehört zu meinen unabänderlichen Gewohnheiten, mich keinem, wer es auch sei, irgendwie zu verpflichten. Verzeihen Sie bitte diese etwas brüske Aufrichtigkeit. Soll und Haben muß bei mir im Leben jederzeit aufgehen. Das ergibt dann nie spätere Komplikationen. Ich bitte um Verständnis!«
Wieder bannte Damm dieser um Vertrauen werbende, warme Blick. Er nickte nur schweigend seine freundliche Zusage.
»Gut«, hub Sill sofort wieder an, der unbestritten die Gesprächsführung schon den ganzen Abend meisterhaft beherrschte. »Wenn es Ihnen recht ist, will ich Ihnen jetzt meinen Bericht über die Geschichte dieses weltabgelegenen Eilands geben. Es ist erst zehn! Wir haben noch viel Zeit. Zu rauchen haben Sie noch, wie ich sehe, aber die Flasche geht zur Neige. Würden Sie sich bitte aus der Futterklappe neu versorgen?«
Eine liebenswürdige Aufforderung, der Martin Damm gern nachkam. Während er die neue Flasche aus der Vorratsluke herausnahm, sah er im Fernsehbild, wie Sill sich nur bückte. Er vernahm aus dem Lautsprecher das leise Rascheln von Eisstückchen. Sill wischte mit einem Tuch über seine Flasche und stellte sie auf den Untersatz. Die Flasche Damms war rätselhafterweise angenehm kühl. Er nahm wieder an seinem Tisch Platz.
»Hoffentlich wird Sie mein Bericht nicht langweilen«, fuhr er lebhaft fort. »Ich lege aber Wert darauf, daß gerade Sie, Ihrer baldigen Arbeit wegen, selbst über die geringfügigsten Einzelheiten informiert sind. Sie müssen sich ein umfassendes und zutreffendes Bild machen. Ich könnte zwar mit der Schilderung der derzeitigen Verhältnisse anfangen, müßte dann jedoch immer wieder auf vergangene Ereignisse zurückgreifen. Darum möchte ich Ihnen gleich einen vollständigen chronologischen Bericht vermitteln, ab ovo sozusagen!«
In diesem Augenblick fuhr Martin Damm erschreckt zusammen, sprang entsetzt auf. Der Boden bebte, schwankte unter ihm. Ein fernes Dröhnen schien aus dem Schoß der Erde aufzubranden. Der Fels zitterte. Der Wohnraum schaukelte. Noch ein Stoß. Dann war alles vorüber. Er umkrampfte verstört die Tischplatte.
»Haben Sie gemerkt? Pluto grollt mal wieder«, tönte gelassen die Stimme Sills aus dem Lautsprecher. »Das kommt hier öfter vor. Eine ausgezeichnete Bestätigung für die Dringlichkeit meiner Bitte an Sie, gründliche Messungen mit Ihrer Peilsonde vorzunehmen. In der letzten Zeit sind mir aus mancherlei Beobachtung leichte Bedenken gekommen, ob der Felsendom genügend stark fundamentiert ist, wenn ich mich so ausdrücken darf. Ich bin kein Geologe wie Sie. Von meiner mittelamerikanischen Heimat her bin ich an Erdbeben gewöhnt und messe ihnen keine allzu große Bedeutung bei.
Ich möchte aber doch ganz sicher gehen, denn schließlich trage ich die Verantwortung für tausend Menschenleben. — Sie haben sich sehr erschreckt, wie ich sehe, mein lieber Damm! Setzen Sie sich getrost wieder hin! — Vor einem halben Jahr haben Sie ähnliche Überraschungen nicht zu befürchten, und dann sind Sie längst nicht mehr hier. Entschuldigen Sie bitte, ich hätte Sie auf derartige Vorkommnisse vorbereiten sollen. Wir sind an solche unvermittelt einsetzenden, kurzen Erdstöße gewöhnt, da vergißt man leicht, einen Gast rechtzeitig aufzuklären. Verübeln Sie mir bitte die Unaufmerksamkeit nicht.«
Doktor Martin Damm hatte unter den beruhigenden Worten zögernd Platz genommen. Der Teufel sollte diese Insel holen! Auch das noch! In seinem Hirn arbeitete es fieberhaft. Er versuchte sich aus der Erinnerung heraus den geologischen Aufbau des Untergrundes dieses Stückes des Indischen Ozeans vorzustellen. Doch er tastete vergebens nach Anhaltspunkten. Der Indische Ozean war lange nicht so gründlich erforscht, wie etwa die Bodenbeschaffenheit des Atlantik.
Sills unerschütterliche Ruhe übertrug sich allmählich auch auf ihn. Die Erregung ebbte ab. Er griff hastig nach seinem Glas, trank einen kräftigen Schluck und steckte sich fix eine Zigarette an.
»Bravo!« sagte Sill. »Ihre Nerven sind in Ordnung!«
›Gemütsmensch‹, dachte Damm.
»Kann das gut beurteilen«, fuhr Sill freundlich lächelnd fort. »Die meisten Neuankömmlinge hier reagieren viel stärker als Sie. — Aber nach diesem Intermezzo kann ich dann wohl mit meiner Erzählung beginnen!« Er lehnte sich bequem in seinen Sessel zurück und schlug ein Bein über das andere.
»Ich gehe wohl nicht fehl, wenn ich voraussetze, daß Sie die Geschichte meiner umwälzenden Entdeckung in großen Zügen aus Presseveröffentlichungen kennen.«
Martin Damm nickte Bestätigung.
»Daß ich versuchte, diese Entdeckung auch in der Praxis des menschlichen Lebens auszunutzen, ist wohl mehr als verständlich. Hierbei stieß ich aber auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Ich konnte meine Ideen vortragen, wem ich auch wollte, man war höflich, hörte mir gespannt zu, versprach, diese ohne Zweifel überaus wichtige Angelegenheit wohlwollend zu prüfen und mir in Kürze Bescheid zu geben. Der versprochene Bescheid ging mir zu und war stets ablehnend.
Nachdem ich sämtliche einschlägigen Werke in USA. abgegrast hatte, fuhr ich nach Europa. Das gleiche Spiel wiederholte sich. Langsam kam ich dahinter, daß System in der ablehnenden Behandlung steckte. Sie wissen, daß nahezu sämtliche Chemiekonzerne mehr oder minder international verflochten sind. War ich damals noch ein idealistischer Phantast, so waren jene Herrn bedeutend geschäftstüchtiger und beurteilten meine hochfliegenden Pläne mit der ihnen eigenen Sachlichkeit. Meine Mittel zur künstlichen Ernährung des Menschen konnte man überaus preiswert herstellen, zumal, wenn die Massenproduktion erst aufgenommen würde. Damit wäre aber die Landwirtschaft vor den Ruin gestellt, und nicht nur diese, sondern auch der größte Teil aller Transportmittel zu Wasser und zu Lande. Die Chemie selbst hätte die Herstellung von Kunstdünger und der sehr lohnenden Schädlingsbekämpfungsmittel einstellen müssen, und daran war mehr zu verdienen als an meinen Pillen. Die Fabriken landwirtschaftlicher Maschinen, und deren gibt es, wie Sie wissen, eine Unzahl, hätten ihre Tore schließen können. Ein unermeßliches Heer von Arbeitslosen aus der Industrie, dem Transportgewerbe, dem Handel und der Landwirtschaft wären in keinem anderen Produktionszweig unterzubringen gewesen. Eine Revolution, wie die Erde noch keine erlebt, hätte alles gesellschaftliche Leben bis ins Mark erschüttert, so lautete die Ansicht meiner Widersacher.
Auch meine Vorschläge, ganz allmählich die Umstellung vorzunehmen, also eine Kompromißlösung zu schaffen, um meinem Ziele wenigstens etwas näherzukommen, verfielen der gleichen Verfemung. Man begann diesen ›Teufel in göttlicher Wohltätergestalt‹, wie mir einmal gesagt wurde, zu fürchten und zu hassen.
Ich ließ nicht locker, schrieb Bücher, Artikel. Sie wurden kaum mehr zum Druck angenommen, oder, was mich schlimmer wurmte, ihr Inhalt der Lächerlichkeit preisgegeben. Die Presse schwieg mich tot. Die Macht des stets beharrlichen und konservativen Großkapitals begann sich zu regen. Ich war zur Ohnmacht verdammt, ich, der ich mit die größte Entdeckung seit Bestehen des Menschengeschlechts gemacht hatte, der die Massen von der Fron unnützer Arbeit befreien wollte — ich wurde einfach kaltgestellt, totgeschwiegen, dem Ruin und der Verzweiflung nahegebracht.«
Sill griff zum Glase. Aus seinen Augen sprühte ein unzähmbarer Fanatismus. Er trank und fuhr sogleich fort:
»Da meldete sich eines Tages in meinem schon höchst primitiv gewordenen Heim in der Nähe von San Antonio, Texas, eine Kommission an. Gezeichnet war das Schreiben von einem höheren Staatsbeamten. Ich jubelte, frohlockte in meinem noch immer nicht erschütterten Optimismus: ›Endlich! Du hast gesiegt!‹ und zählte fast die Stunden bis zu dem angekündigten Treffen.
Doch es kam ganz anders, als ich erwartet hatte. Die Herren erschienen sehr zeremoniell, sehr zurückhaltend. Wohl auf gemeinsame Verabredung hin behandelte man mich vorsichtig, wie einen zwar nicht gemeingefährlichen, doch immerhin beachtlichen Geisteskranken. Man malte mir mit sanften, gütigen Stimmen die Folgen der Auswertung meiner Ideen in den schwärzesten Farben aus. Die Herren bezweifelten die Durchführbarkeit und verlangten endlich von mir, die an sich schon genügend geplagte Menschheit ein für allemal in Ruhe zu lassen. Meine Patente gehörten nicht in Privathände, sondern in die Obhut des Staates, der allein wisse, was seinen Bürgern not tue. Andererseits erkenne man rückhaltlos die Priorität meines Verfahrens an. Würde ich mich den in einem bereits angefertigten Vertrag niedergelegten Bedingungen fügen, so erhielte ich die darin vorgesehene einmalige Grundzahlung. Außerdem wurde jährlich eine beträchtliche Summe zugesagt, die aber sofort entfiel, wenn ich vertragsbrüchig würde. Es sei keiner Privatperson gestattet, das Gefüge des Welthandels und der menschlichen Beziehungen derart zu erschüttern, wie ich es beabsichtige.
Ich las im tiefsten erschüttert das Abkommen durch. Es war finanziell überaus günstig. Ich war mit einem Schlage vielfacher Millionär, aber — zur ewigen Tatenlosigkeit verurteilt. Alle meine Rechte gingen an ein näher bezeichnetes Konsortium über. Um jedoch in jeder Beziehung die Form zu wahren, wurde mir ausdrücklich gestattet, an einem beliebigen Punkte des weiten Erdballs meine Versuche fortzusetzen. Es müsse jedoch an einer Stelle sein, von der aus meine Experimente sich nicht auf die Allgemeinheit auswirken könnten, wo keine Zeitungsreporter — das war ausdrücklich festgelegt — mich je aufspüren und interviewen könnten. Außerdem dürften meine etwaigen Mitarbeiter keine Möglichkeit haben, bereits gewonnenes Erfahrungsgut, sei es in meinem Auftrag oder eigenmächtig, irgend jemandem — so lautete der Passus wörtlich — zu vermitteln!«
Doktor Sill hatte offensichtlich die Erinnerung an diese Szene in Harnisch gebracht. Aus dem Lautsprecher ertönte deutlich vernehmbar sein mehrfaches verächtliches, hartes Ausstoßen der Atemluft durch die Nase.
»Ich wußte nun, was die Stunde geschlagen hatte«, fuhr er nach kurzer Pause fort, »und — unterzeichnete. Die Stimmung meiner Besucher war von diesem Augenblick an wie umgewandelt. Man lud mich ein, nach San Antonio zu kommen. Einige chromglänzende, supermoderne Kraftwagen parkten draußen, und der Tag endete — entschuldigen Sie den Ausdruck — in allgemeiner schauderhafter Besäufnis. Noch am gleichen Abend erhielt ich einen Barscheck über fünf Millionen Dollar. So viel war ich ihnen also fürs erste wert. Die jährlichen Ratenzahlungen sollten sich auf eine Million Dollar für weitere 15 Jahre belaufen, dann 30 Jahre auf die Hälfte, zahlbar an mich oder im Falle meines vorzeitigen Ablebens an meine Erben.
Man sagt in Deutschland zu Kopf oft auch ›Rübe‹. Diese meine ›Rübe‹ erschien mir am nächsten Tage, an dem ich mit einem scheußlichen Kater erwachte, doch zu kostbar, als daß ich sie einer Revolverkugel auszusetzen beabsichtigte, um so weniger, als plötzlich die Presse aus ihrem Dornröschenschlaf erwachte und ausführlich berichtete, daß ich meine Patente der staatlich kontrollierten Gruppe eines Chemiekonzerns verkauft habe.
Ich fuhr zu einem Notar nach San Antonio, einem mexikanischen Landsmann, dem ich in jeder Beziehung vertrauen konnte, und verließ wenige Stunden nach Hinterlegung aller erforderlichen Vollmachten das für mich ungastlich gewordene Land.
Mein Reiseziel war Brasilien. Die schier undurchdringlichen Urwälder längst des Amazonas deuchten mir ein idealer Unterschlupf, denn eines stand fest: Von der Verfolgung meiner Pläne wollte ich nie und nimmer ablassen! — Nie und nimmer!«
Hart und dumpf dröhnend schlug Sills Faust auf die Schreibtischplatte. Die Fernsehscheibe zeigte es. Der Lautsprecher vermittelte dem Ohr die akustische Untermalung.
Martin Damm war dem Bericht schweigend, doch mit offensichtlicher Anteilnahme gefolgt. Nach allem, was er wußte, deckte sich die Schilderung gut mit den ihm zugänglich gewordenen Presseveröffentlichungen.
»Wie der Tatbestand zeigt, muß Brasilien Sie enttäuscht haben«, sagte er. Es war nur eine höfliche Betonung wacher Aufmerksamkeit, hinter der sich die brennende Neugier verbarg, mehr zu erfahren.
»Ja«, sagte Sill trocken. »Schon auf der Dampferfahrt dorthin waren mir erhebliche Bedenken gekommen. Ich hatte Muße genug, mir die Verwirklichung meiner Pläne gründlich zu durchdenken. Über eines wurde ich mir sehr rasch klar. Ich würde Rohstoffe und Menschen benötigen. Beide erfordern zum Antransport und zur Unterhaltung dauernden Nachschub. Ein Nachschub dorthin ohne Flugzeug war undenkbar. Flugzeuge erfordern Ausgangsbasen, Flugplätze, die unter mehr oder minder starker internationaler Kontrolle stehen. Redseligkeit der Piloten würde mich über kurz oder lang zum Vertragsbrüchigen stempeln. Außerdem bedeuten tropische Urwälder, wenigstens für Europäer, eine ständige Gefahr in bezug auf Seuchen, Fieber und weiß der Teufel was noch. Ich bin schließlich Chemiker und kein Arzt. Alle Versuchsergebnisse wären somit durch Infektionen zweifelhaft gewesen.
Ich verwarf die brasilianische Urwaldidee, bevor ich das Land betreten hatte. Die gründliche wissenschaftliche und organisatorische Schulung, die ich durchgemacht hatte, setzte sich langsam, aber um so bestimmter durch.
Meine blindwütige Abreise nach einem möglichst entlegenen Ort war eine einfältige Affekthandlung meines spanischen Blutanteils. Das war mir auf alle Fälle klargeworden. — Daß dergleichen nach meiner jahrelangen Depression nur zu verständlich ist, werden Sie gewiß begreifen.
Ich buchte in Rio eine Kabine nach Europa. Afrika war mein nächstes Ziel, doch von Südamerika gelangt man nur über europäische Häfen dorthin. Fliegen liegt mir nicht. Eine unbestimmte Hoffnung bewog mich, die Zwergvölker im Kongogebiet aufzusuchen und dort meine Versuche anzustellen. Ich bin tatsächlich dagewesen. Es war ungemein interessant, manchmal sogar recht kitzlich und gefährlich. Doch die Lebensumstände — nun, ich will Sie nicht mit langatmigen Reisebeschreibungen belästigen. Auf keinen Fall kamen abgelegene Waldgebiete für meine Zwecke in Frage. Diese Erkenntnis wuchs, je mehr ich die Verhältnisse sondierte. So blieben nur noch zwei Möglichkeiten offen, mich entweder in eine innerasiatische Gebirgseinsamkeit a la Dalai-Lama zurückzuziehen oder eine, wie man sagt, ›verlorene‹ Insel aufzuspüren. In der klaren Überlegung, daß ich dort so leicht nicht vertragsbrüchig werden konnte, entschloß ich mich, eine solche zu suchen.
Was lag da näher, als einmal die Inselgruppen des Stillen Ozeans zu durchforschen, besonders die am meisten südlich gelegenen, also polnahen, die abseits jeden Verkehrs lagen? Ich selber brauchte dazu nur irgendwo einen kleinen Dampfer zu chartern und dann in der Weltgeschichte herumzugondeln. Alle weiteren Planungen konnten erst an Ort und Stelle greifbare Gestalt annehmen.
In Kapstadt bestieg ich einen Frachter, der nach Australien auslaufen sollte. Dort wollte ich versuchen, irgendeinen Motorsegler zu bekommen. Und nun beginnt die eigentliche Geschichte der Entdeckung dieses Eilandes, die so phantastisch und abenteuerlich klingt, daß ich sie wohl kaum einem anderen glauben würde. Doch stärken wir uns erst einmal! Prost Damm!«
Sill hob lächelnd sein Glas.
»Prost Sill«, entgegnete Martin Damm, die vertrauliche Anrede genau so vertraulich erwidernd. Beide tranken. Martin Damm schien es drückend heiß geworden zu sein. Er zog kurz entschlossen sein Jackett aus und hing es über die Stuhllehne.
»Sie gestatten doch«, fragte er höflich.
»Selbstverständlich«, kam die Antwort zurück. »Machen Sie es sich so bequem, als ob Sie in Ihren eigenen vier Wänden säßen! — Also nun zu der merkwürdigen Story der höchst unfreiwilligen Entdeckung.
Wir waren nur wenige Passagiere auf unserem schönen, modernen Frachtdampfer und langweilten uns schlecht und recht unter den aufgespannten Sonnensegeln, wie man eben an Bord faulenzt. Sie kennen das gewiß. Häufig tummelten sich Schweinsfische in der Bugwelle unseres ruhig dahinfahrenden Schiffes von etwa sechstausend Tonnen. Ab und zu tauchten Haifische auf. Wir erprobten unsere Schießkünste als Sport und Zeitvertreib an diesen tückischen und gefräßigen Räubern mit einer eigens für diesen Zweck vorhandenen Kugelbüchse. Der Schuß kostete einen Schilling zugunsten der Mannschaftskasse. Es war ein angenehmer und nützlicher Zeitvertreib, diese verhaßten Bestien ein wenig zu dezimieren.
In den letzten zwei Tagen fuhren wir durch dicken, schwülen Nebel. Wie man mir sagte, käme das hier auf dieser Route infolge des Zusammenpralls kalter polarer und warmer tropischer Meeresströmungen häufig vor.
Donnerstag, den vierten Februar, hatte unser braver Kapitän Geburtstag. Das war Anlaß genug, das Einerlei der Tage zu unterbrechen. Bereits nach dem Morgenimbiß begann, mit dem Geburtstagskind in unserer Mitte, ein kräftiger Frühschoppen. ›Langen Sie nur tüchtig zu, die Reederei bezahlt alles‹, lautete die häufige Aufforderung des Kapitäns oder eines seiner gerade dienstfreien Offiziere. Warum sollten wir nicht zulangen?
Es folgte ein vorzügliches Mittagessen.
Man soll nicht schon des Morgens scharfen Getränken zusprechen. Das reiche und vorzügliche Mahl hatte zwar müde gemacht, aber einige kräftige Brandys und Whiskys hatten die aufkommende Schlaffheit bald wieder verscheucht. ›Kneifen, das gilt hier nicht‹, polterte der Alte und paßte wie ein Luchs auf und zwinkerte dem bedienenden Steward sofort zu, wenn ein Glas zur Neige ging. ›Wenn ich schon nur jedes Jahr einmal Geburtstag habe, dann aber auch gründlich‹, dröhnte seine rauhe Baßstimme von Stunde zu Stunde vergnügter über unsere Runde. Kurz und gut, es wurde eine ausgedehnte und tüchtige Trinkerei.
Ich vertrage einen höchst beachtlichen Stiefel, fühlte mich auch in dem lärmend zechenden Kreise, in dem besonders der Kapitän köstliche Anekdoten mit faustdick gesponnenem Seemannsgarn zum besten gab, höllisch wohl.
Zum Abendessen gab es eine Unzahl delikat belegter Brötchen. Es ging gegen zehn Uhr. Wir hatten nahezu zwölf Stunden munter gebechert, und ein Ende des ausgedehnten Festes war noch nicht abzusehen, da überkam mich ein nicht bezähmbares Bedürfnis nach frischer Luft. Diese Nebelatmosphäre war mir fremdartig und bedrückte mich sehr. Ich gab mir innerlich einen Ruck und ging, glaube ich, in korrekter Haltung an Deck.
Dort mußte ich mit leiser Beschämung feststellen, daß ich einen ärgeren Schwips hatte, als ich angenommen hatte. Doch die frische Luft tat wohl.
Ich stand, die Hände auf die Reeling gestützt, und schaute in die nachtdunkle Flut, über die, durch den Nebel seltsam verzerrt, die Kabinenlichter huschten. Der alte Bootsmann näherte sich mir. Er mochte mich wohl beobachtet haben. ›Na, Doktor‹, redete er mich vertraulich an, ›scharfes Tempo und noch schärfere Sachen beim Ollen da unten. — Fallen Se man nich über Bord! — Soll ich ein wenig bei Ihnen bleiben?‹
›Um Gottes willen‹, dachte ich, ›wenn der trotz der geringen Deckbeleuchtung sieht, was mit dir los ist, dann mußt du ja schon eine arge Schlagseite haben.‹ — Na, mein lieber Damm«, meinte Sill jetzt sehr erheitert. »Sie kennen ja gewiß aus eigener Erfahrung die bedauerliche Tatsache, daß ein Betrunkener selten oder nie weiß, wie weit sein Zustand vorgeschritten ist. Obendrein liebt man derartige Feststellungen durch Dritte keineswegs. Ich straffte mich also und entgegnete möglichst ungezwungen: ›Nein, Bootsmann! — So schlimm ist's bei Gott nicht! — Machen Sie sich keine unnötigen Sorgen. Ich will nur 'was frische Luft schnappen!!‹ ›Na, dann ist's gut‹, sagte er und trollte sich weiter.
Was dann geschah, und wie es überhaupt zuging, weiß ich nicht!«
Damm starrte den Erzähler ehrlich entsetzt an.
»Ich muß wohl für Sekunden das Bewußtsein verloren haben, mag es Unwohlsein oder Betäubung durch den reichlichen Alkoholgenuß, oder der Nebel gewesen sein — ich kann's nicht mehr entscheiden. Ich erhielt einen Stoß gegen den Unterleib, wahrscheinlich von der Reling. Dann vernahm ich nur noch einen gellenden Schrei und das Poltern von Schritten.
Ich hatte das Gefühl, irgendwie zu schaukeln, zu schweben — ganz klar denken konnte ich nicht — dann stürzte ich kopfüber in die Tiefe.
Das kalte Wasser ließ mit rasender Schnelle mein Bewußtsein hell aufleben: ›Du bist über Bord gefallen!‹ Noch unter Wasser, schwamm ich wie ein Verzweifelter, um von dem Schiffskörper loszukommen. Der Sog, der Sog — die Schrauben, peitschten wie irrsinnig meine Gedanken! Jetzt atmeten die Lungen wieder Luft. Gottlob, ich hatte es geschafft. Der schwarz aufragende Schiffsleib strich etwa fünf, sechs Meter hinter mir vorüber. Ich schwamm um mein Leben, noch größeren Abstand zu gewinnen. Langsam wurde ich zurückgerissen, unter die Wasseroberfläche. Dumpfes, mahlendes Poltern in dichtester Nähe! Dann war alles vorüber, der Schraubenstrudel spuckte mich aus. Gerettet! Das war tatsächlich das einzige, was ich in diesem Augenblick mit jubelnder Freude empfand.
Daß ich sozusagen mutterseelenallein mitten im Indischen Ozean schwamm, daß das Schiff weiterfuhr, daß jeden Augenblick ein Haifisch mir seine scharfen Kiefer in den Körper schlagen konnte, das alles bedachte ich nicht.
Ich schwamm einfach. Im übrigen mußte jeden Augenblick auch das Rettungsboot auftauchen, um mich aufzunehmen; denn daß mein Überbordgehen sofort bemerkt worden war, das stand bei dem mir immer noch in den Ohren gellenden Schrei fest.
Jetzt sah ich eine Leuchtkugel hochsteigen, doch der Nebel schluckte ihr Licht; je höher sie stieg, um so mehr erlosch sie. Rufe drangen zu mir herüber. Dann beobachtete ich, schon fast kaum noch wahrnehmbar, im Schein einer gelblich grellen Natrium-Magnesium-Fackel, wie ein großes Gummifloß von der Schleudervorrichtung in flachem Bogen durch die Luft schoß und auf den Meeresspiegel aufschlug. Wenige Sekunden danach flammte ein gelbrotes Fanal auf dem Wasser neben dem Schlauchboot auf. Ich brauchte nur noch auf die so gekennzeichnete Stelle zuzuschwimmen. Weit war es nicht, wenn auch gewiß Nacht und Nebel trogen. Bei der Schnelligkeit der Rettungsmaßnahmen schätzte ich die Entfernung auf etwa zweihundert Meter, also gar nichts für einen guten Schwimmer, zumal ich nur eine leichte Hose trug und Halbschuhe.
Ich war verteufelt schnell vollständig nüchtern geworden und kann nur sagen: Ich schämte mich scheußlich. Ausgerechnet mir mußte so etwas zustoßen. Niederschmetternd wirkte obendrein die Vorstellung der total zerplatzten Geburtstagsfeier. Merkwürdigerweise kam mir bei all diesem hastenden Sinnen während der gleichmäßig ruhigen Schwimmstöße nicht ein einziges Mal der Gedanke, Haie könnten bereits hinter mir her sein. ›Gottlob‹, vermag ich heute nur zu sagen, denn sonst wäre es wohl um meine Selbstbeherrschung geschehen gewesen. — Was ist Ihnen, mein lieber Damm, Sie blicken ja ganz verstört drein?«
»Das dürfte wohl nicht verwunderlich sein! Sie können einen wirklich meisterhaft auf die Folter spannen«, platzte Martin Damm heraus. »Wenn ich daran denke, wie es mir hätte ergehen können, falls ich Ihre Insel nicht gefunden hätte!«
»Warten Sie nur ab, Damm, es kommt noch viel schöner«, schaltete sich Sill wieder ein und fuhr in seinem Bericht gleich weiter fort:
»Ich erreichte das große Schlauchboot und zog mich nicht ohne einige Mühe hinein. Jetzt erst verspürte ich zitternde Schlaffheit. Von dem Dampfer war nichts mehr zu sehen. Irgendwo aus der Nebelferne ertönten verschwommene Geräusche, bald wie menschliche Rufe, bald wie dumpfes Mahlen der Schrauben klingend.
Ich setzte mich erst einmal bequem zurecht, um zu verschnaufen. Ich fühlte mich geborgen und sicher. Das rotgelbe Fanal, welches da einige Meter von mir entfernt auf der ruhigen Flut dümpelte, würde lange brennen, das wußte ich, und da gerade dieses Licht Nebel besser durchdringt als weißes, müßten mich meine Retter auch finden.
In diesem Augenblick schoß die wohlbekannte sichelkrumme Rückenflosse eines Haifisches dicht an der Seite des Bootes vorüber. Jetzt — mich überlief es eiskalt — verspürte ich einen leichten Ruck, das schüsselförmige Leuchtfanal wurde zu mir herangerissen, duckte unter Wasser und — verlosch. Grauenhafte Angst überkam mich. Ich zitterte an allen Gliedern. Ich wagte nicht auszurechnen, wie viele Bruchteile einer Sekunde mich von einem erbärmlichen Tode getrennt hatten. Daß meine Lage jetzt, ohne Lichtsignal, verzweifelt geworden war, dessen wurde ich mir im Augenblick ganz und gar nicht bewußt. Diese Erkenntnis kam mir erst eine ganze Zeit danach.
Ich habe mir später die Vorgänge folgendermaßen rekonstruiert. Der Hai, meine Spur witternd, war mir gefolgt.
Der Beute schon sicher, wurde er beim Auftauchen durch das grelle Licht geblendet. In der hastigen Flucht muß er irgendwie das Verbindungsseil zwischen Schlauchboot und Leuchtfanal mitgerissen haben. Die Folgen waren der deutlich verspürte Ruck und das Verlöschen des Lichtes. Eine andere Erklärung gibt's wohl kaum.
Auf alle Fälle saß ich naß, frierend und völlig verlassen in einer pechschwarzen Nebelnacht mitten auf dem weiten Ozean.
Ich schrie — schrie! Lauschte auf Antwort! Schrie wieder unter Aufgebot aller Stimmkraft, lauschte in kleinen Abständen, schrie, bis ich heiser wurde.
Es müssen Stunden vergangen sein, bis ich das Nutzlose meines Handelns einsah, und dann überkam mich elende Verzweiflung. Hätte ich wenigstens nicht so jämmerlich gefroren! Dabei war die Temperatur durchaus nicht kalt. Doch mein entnervter Zustand wirkte sich aus. Manchmal glaubte ich, in der Ferne Geräusche zu hören, die näher kamen, sich wieder entfernten, wähnte auch Lichter zu sehen. Es muß alles Einbildung gewesen sein. Denn als der Tag dämmerte, war zwar der Nebel etwas lichter geworden, doch von meinem Schiff war weit und breit nichts zu sehen.
Unmögliche Rettungspläne durchkreuzten mein Hirn. Doch dann bin ich offensichtlich unter der Nachwirkung der Aufregung und des leider zuviel genossenen Alkohols einfach eingeschlafen.
Die Sonne ging dem Mittag zu, als ich, von glühender Hitze gebraten, aufwachte. Mein Kopf schmerzte, mir war entsetzlich dösig und elend zumute. Zu meinem scheußlichen Kater war noch ein, gottlob gelinder, Sonnenstich gekommen. Mich plagte als erstes ein maßloser Durst. Meerwasser kann man nicht trinken. So suchte ich — ich gestehe das offen ein — mit einer geradezu verzweifelten Gier nach etwas Trinkbarem. Daß derartige große Schlauchboote Proviant enthielten, wußte ich. Würde der Wasservorrat auch ordnungsgemäß ergänzt sein?
Meine Hände durchwühlten die aufknöpfbaren Taschen, die an den Innenseiten des Schlauchbootes angebracht waren. In der dritten erst fand ich, was ich suchte: mehrere kleine Kanister mit kohlensaurem Sprudel, dem etwas Zitrone zugesetzt war. Sie wissen, daß Wasser in verschlossenen Gefäßen leicht schal und muffig wird.
Ich trank in hastigen, langen Zügen. Mir wurde wohler. Nur belästigte mich stark die heute fast nebelfreie Sonne. Ich mußte mir unter allen Umständen Schatten verschaffen. Ich suchte und fand fein säuberlich zusammengerollt ein Segel und zusammensetzbares Mastgestänge sowie Leinen und Strickwerk.
Das Schlauchboot war für mehrere Personen berechnet und dementsprechend der Proviant bemessen. Eine oberflächliche Durchmusterung ergab, daß ich allein für gut vierzehn Tage zu essen und zu trinken hatte.
Wie aber sollte es weitergehen? Daß in diesem Teil des Indischen Ozeans verdammt wenig Schiffe verkehrten, war mir bekannt. Somit sprach jede Wahrscheinlichkeit dagegen, daß ich von einem zufällig aufkreuzenden Dampfer aufgenommen werden würde. Andererseits war ich felsenfest überzeugt, daß mein Unfall längst drahtlos an alle Schiffe und Landstationen durchgegeben war. Mein Frachter hatte die Suche sicher abgebrochen, weil der starke Nebel ein Auffinden verhinderte, hatte aber ganz gewiß Seenotflugzeuge angefordert, die das in Frage kommende Gebiet absuchen würden. So hieß es, sich nur mit Geduld wappnen, und dazu war ich bereit. Nur der Nebel, der wieder dichter wurde, machte mir ernstlich Sorgen. Wenn der hier tage- oder sogar wochenlang anhielt, dann —. Die Folgen wollte ich nicht zu Ende denken.
Näherliegende Sorgen lenkten mich auch rasch ab. Kleider und Wäsche waren bis auf kleine Stellen, auf denen ich gelegen hatte, knochentrocken, aber stark mit Seesalz durchsetzt. Wollte ich mich nicht einer üblen Hautentzündung aussetzen, so mußte ich erst einmal das Salz entfernen. Ich entkleidete mich vollständig, und dann begann ein zwar recht langweiliges, aber doch zeitvertreibendes Reiben, Stückchen auf Stückchen, besonders des Unterzeugs, um das lästige Salz herauszuschütteln. Nach stundenlangem Bemühen war auch das geschafft. Ich zog mich wieder an und sah mit Ruhe der Nacht entgegen, für die ich mich gegebenenfalls in die Segelleinwand einhüllen konnte.
Als es dunkel wurde, verspürte ich zunehmende Müdigkeit. Schlafen aber wollte ich auf keinen Fall. Eine Zwangsvorstellung hatte mich gepackt, daß gerade dann, wenn ich schliefe, ein Flugzeugbrummen zu hören sein würde und ich meine einzige Rettungschance verpassen könnte. Unter den in den Seitentaschen verstauten Gegenständen hatte ich auch eine Leuchtpistole und die dazugehörige Munition gefunden. Die Pistole lag geladen und griffbereit neben mir. So wachte ich denn, gewaltsam gegen die Müdigkeit ankämpfend. Ich deklamierte zunächst laut mir noch in der Erinnerung verbliebene Gedichte. Schließlich sang ich Studentenlieder, die mich noch am meisten anfeuerten und aufheiterten.
Gegen Mitternacht ging an dem inzwischen sternenklar gewordenen Firmament der Halbmond auf. Ich sang: Guter Mond, du gehst so stille!
Doch dann fing ich an zu frieren. Ich baute mein Sonnensegel ab und wickelte mich ein und — fiel in Schlaf.
Ich erwachte, als es schon Tag war. Meine Gedanken fanden nur langsam in die Wirklichkeit zurück. Dann habe ich geflucht und gewettert, mich einen gottverdammten Narren gescholten. Aber was half das? Geschehen war geschehen! Die Vorstellung, daß in jener Nacht meine Retter über mich hinweggeflogen sein könnten, ließ mich bis zu meiner endlichen Auffindung nicht mehr los und verursachte mir niederträchtige Pein.
Eine leichte Brise hatte sich aufgetan. Der Nebel hatte sich dadurch zwar gelichtet, mein Gemütszustand jedoch verdüstert, denn ich erkannte in ihr die Vorbotin eines Sturmes. Ich aß und trank, um bei Kräften zu bleiben, Appetit hatte ich angesichts der neuen Gefahr keinen.
Was soll ich Ihnen sagen? Um das Maß meiner Verzweiflung voll zu machen, entdeckte ich auch noch wie zufällig, daß eine Schar Haie mein Boot umkreiste. Ich sah nur ab und zu die auftauchenden Rückenflossen. Doch diese Tatsache genügte, mir jede klare Besinnung zu rauben. Jeden Augenblick konnte eines dieser gefräßigen Bestien seine dolchartigen Zähne in die dünne Gummiwand schlagen, und was dann? Ich stierte voller Entsetzen auf die unheimlich kreisenden Sicheln, die die stille Flut wie Messer lautlos durchschnitten.
Da griff ich, dem Wahnsinn nahe, zu der Leuchtpistole und schoß auf den ersten Hai, der wieder auftauchte.
Ich hätte es nicht tun sollen! Denn was jetzt geschah, war entsetzlich. Kaum war der dröhnende Schuß verhallt, da färbte sich das Wasser neben mir dunkelrot, und sämtliche Haie, es mögen fünf oder sechs gewesen sein, stürzten sich wie toll auf ihren tödlich verwundeten Artgenossen und rissen den noch zuckenden Körper in Fetzen, und das alles spielte sich ein paar Meter von mir entfernt ab.
Das eben noch stille Meer kochte und zischte in rosageflockten Wirbeln. Es war grauenvoll, diese Urweltfische kämpfen zu sehen. Immer wieder schoß eine spitze Nase empor, die helle Bauchseite nach oben gekehrt. Der halbrunde, dolchbezahnte Rachen packte zu. Wütende Schwanzschläge trafen mein leichtes Boot. Ich klammerte mich verzweifelt an den Holzrost, auf dem ich saß. Jetzt glaubte ich zu sehen, daß nicht nur der tote Hai das Angriffsziel sei, sondern daß die Riesenfische sich wahllos und beuterasend untereinander Brocken Fleisch aus den Körpern rissen. Satanische Wut blitzte aus den tückisch kalten Augen.
Ich vermochte einfach nicht mehr hinzusehen und war so von Grauen gerüttelt, daß ich mich flach auf den Boden legte.
Wie lange diese Tragödie der gegenseitigen Zerfleischung dauerte, weiß ich nicht. Ich entsinne mich nur, daß ich, als ich wieder zu mir kam, ein leises Gluckern neben mir wahrnahm, was auf ein leichtes Treiben des Bootes schließen ließ. Ich richtete mich auf und spähte vorsichtig über Bord! Von den Haien war nichts mehr zu erblicken. Man muß so etwas miterlebt haben, um ermessen zu können, welches Gefühl der Erlösung mich überwältigte. Ich weinte.«
Sill schwieg. Die Schilderung dieses ohne Zweifel einmaligen Erlebnisses hatte ihn sichtbar ergriffen. Während Martin Damm sich nervös eine Zigarette anzündete, saß Sill völlig bewegungslos an seinem Tisch, und erst nach einer ganzen Weile fuhr er, viel langsamer als bisher, fort:
»Ich beruhigte mich zwar nach einer gewissen Zeit, aber seelisch war ich gebrochen. Ich war fertig.
Zitternd setzte ich mich aufrecht. — Ich mußte wenigstens sehen!
Die höher steigende Sonne brannte immer fühlbarer, aber ich war zu apathisch, um mein Sonnensegel wieder aufzubauen. Und als der Durst mich zu quälen anfing, war ich einfach zu träge, nach dem Kanister, den ich wieder in der Gummiwandung verstaut hatte, die Hand auszustrecken.
Endlich tat ich es aber doch, so ganz mechanisch. Ich merkte gar nicht, daß ich in ein anderes Segeltuchfach griff, ich öffnete nur das herausgezogene Blechgefäß und trank.
Dieser willenlos ausgeführten Handlung verdanke ich, davon bin ich überzeugt, meine Rettung. In dem Kanister war Kognak.
Wie ein Glutstrom durchrann das scharfe Getränk meinen Leib. Die Lebensgeister erwachten wieder, und ich faßte neuen Mut. Noch ein kräftiger Schluck, dann langte ich nach dem Wasserkanister.
Nein, nein, ich wollte nicht sterben! Man würde mich ganz gewiß suchen und finden. Ich mußte durchhalten, durchhalten!«
Sill begann jetzt wieder mit außerordentlicher Lebhaftigkeit zu sprechen.
»Ich wollte gerade mein Sonnensegel wieder aufbauen, da sah ich in weiter Ferne etwas Dunkles, Rundes aufragen. — Land? — War so etwas möglich? — Land? — Hier mitten im Ozean? — Ich wollte schärfer hinschauen! — Das Ziel zerflatterte, — tauchte verschwommen neu auf — entschwand!
War ich einer Fata Morgana zum Opfer gefallen, oder einem Trugbild, das mir der zu hastig getrunkene Alkohol vorgaukelte?
Ich starrte und starrte in die Ferne, bis mir die Augen schmerzten. Ein Hoffnungsschimmer hatte sich angekündigt, aber wie sollte, wie konnte ich mir Klarheit verschaffen? Wie?
Da blitzte der rettende Gedanke auf. Segeln!
Es währte eine Viertelstunde oder länger, bis es mir, der ich nichts davon verstand, gelang, den zuammensteckbaren Mast in der auf dem Lattenrost dafür vorgesehenen Messingtülle aufzurichten, mit den Leinen zu verspannen und das Segel zu setzen. Und es blähte sich tatsächlich in dem leichten Wind, mein Boot begann Fahrt zu machen.
Ich will Ihnen nicht berichten, was ich alles unternahm, um auf den rechten Kurs zu kommen. Schließlich hatte ich mit einem nach hinten als Steuerruder ins Wasser gesteckten Brett meines Bootes Erfolg.
Daß da, allerdings noch weit voraus, Land war, das wurde mir schon nach kurzer Zeit zu einer triumphalen Gewißheit.
Meine einzige Sorge und Furcht galt dem Wind. Wenn der einschliefe, war's aus mit meiner Segelei, und wenn ich vor Einbruch der Nacht mein Ziel nicht erreichte — ob ich es in der Dunkelheit oder am nächsten Morgen wiederfinden würde?
Aber ich hatte Glück. Der Wind schlief nicht ein, sondern nahm am Nachmittag sogar noch so zu, daß sich Wellen bildeten, die meinem Boot bald recht gefährlich wurden. Doch mein Ziel kam näher und näher, mein Mut wuchs — und ich segelte wie ein Wikinger, das heißt ich lernte es — zwangsweise.
Wie sehr es trotz allem mit meinen Segelkünsten noch haperte, merkte ich erst, als ich in unmittelbarer Nähe des gewaltigen aufragenden Felseneilands die meterhohe Brandung entdeckte, die an den Steilflanken hochschlug, und just auf diese Stelle trieb ich zu. Als nichts mehr half, riß ich im letzten Augenblick die Leinwand herunter und paddelte unter Aufbietung all meiner Kräfte. Ich landete schließlich in demselben alten Walfängerhafen, in dem Sie Ihr Flugzeug aufsetzten!«
»Dann war das hier doch einmal eine Walfangstation? Das war wenigstens mein erster Eindruck«, fragte Doktor Damm.
»Sehr richtig, aber seit nahezu dreißig Jahren ist er verlassen«, bejahte Sill. »Die Molenköpfe waren damals bereits sehr verfallen, auch nicht ganz so ausgedehnt, ihre heutige Anlage ist mein Werk!« — Nach kurzem Zögern: »Ermüde ich Sie, Damm?«
»Wo denken Sie hin! — Nicht im geringsten! Ihre Erzählung ist weiß Gott nicht dazu angetan, einen Zuhörer einzuschläfern, und dann hier«, er tippte launig mit einem Finger an die Flasche, »dieser köstliche Tropfen bereitet mir ein Wohlbehagen, wie ich es selten empfunden habe!«
»Nur ist die Buddel nahezu leer«, warf Sill ein. — »Es ist gleich ein Uhr. — Wie wäre es mit einer letzten vor dem Schlafengehen?« Dabei blinzelte er listig vergnügt, als ob er im voraus schon des Einverständnisses sicher sei, erhob sich und verschwand. Martin Damm schritt zur ›Futterluke‹ und entnahm ihr eine vorzüglich gekühlte Flasche.
Er hatte kaum wieder Platz genommen, als Sill ebenfalls auftauchte und sich niederließ.
»Kosten Sie den einmal! Ich halte ihn für das ›beste Pferd in meinem Stall‹, wie mein alter Kneipwirt in Heidelberg seine Edelgewächse, die er nur bei ganz besonderen Gelegenheiten aus seinem Keller zutage förderte, zu bezeichnen pflegte. Und für mich bedeutet der heutige Abend eine ebensolche Gelegenheit. Auf Ihr ganz besonderes Wohl, mein lieber Damm!«
»Verbindlichsten Dank. Ich komme nach!« Doch als er den ersten kleinen Probeschluck genommen hatte, setzte er verdutzt das Glas ab.
»Bei allen Göttern, das ist ja feinste Edelbeeren-Spätlese! — Wollen Sie etwa behaupten, daß dieser Wein gleichfalls aus Ihren Retorten stammt?«
»Jawohl!« Begeisterte Genugtuung blitzte aus den dunklen Augen Sills.
»Dann tun Sie wahrlich gut daran, hier und nicht an der Mosel zu sitzen. Man würde den anmaßenden Weinpanscher dort wohl lynchen!« — Ein neues Schnuppern und Proben. »Das ist ja unglaublich! Köstlich, köstlich die volle Süße — und diese nachhaltige, leicht erdige Säure, vollmundig und süffig, wie nur beste Jahre sie in ausgesuchten Lagen hervorbringen. — Sie verstehen Ihr Handwerk! Das muß Ihnen der Neid lassen! — Ein Hochachtungsschluck!« Martin Damm winkelte zeremoniös den Arm, verbeugte sich leicht, hob mit knappem Ruck das Glas zum Munde und trank mit so genießerischer Andacht, daß sein Beobachter still und triumphierend das Gebaren in kaum verhohlener Selbstgefälligkeit verfolgte.
Gleich verschwand dieser Ausdruck wieder und machte beglückter Anteilnahme Platz.
»Freut mich ungemein, daß ein Kenner so urteilt!« Dann trank Sill, als ob er sich selbst noch einmal der geschilderten Eigenschaft des Weins vergewissern wollte. Er setzte behutsam sein Glas nieder.
»So! Und jetzt will ich Ihnen noch rasch von meiner Rettung berichten!« Er lehnte sich wieder bequem zurück, die Ellbogen auf die Stuhllehne aufgestützt, trommelte die Finger gegeneinander und begann:
»Es war etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang, als ich nach meiner fast zwanzigstündigen Odyssee das Land betrat. Mein Schlauchboot zerrte ich aus dem Wasser und zog es einige Meter die Felsenfläche aufwärts. Ich verspürte keinerlei Aufregung mehr, höchstens unbändige Freude, daß dieses Abenteuer einen so unerwartet günstigen Abschluß gefunden hatte. Hier würde man mich ganz gewiß suchen und auch finden, lag doch die Insel nach meiner Schätzung höchstens einige Seemeilen vom Kurs meines Dampfers ab.
Nur e i n Bedenken schuf mir zunehmende Sorge. — Wie wollte ich mich nach all den Strapazen eine ganze, lange Nacht wachhalten? Ein während des Tages suchendes Flugzeug hätte sehr wohl des Nachts auf dem Rückflug hier über mich hinwegbrausen können, und was dann?
Ich vertrat mir, auf der Felsfläche sinnend und grübelnd umherwandernd, die Beine.
Eine zufällige Entdeckung enthob mich jedoch aller quälenden Gedanken. Da lag Holz verstreut, zersplitterte, schön trockene Planken, die wohl eine Sturzsee höher hinauf geschwemmt hatte. Ich suchte, soviel ich bergen konnte, zusammen, schichtete einen Teil davon nicht weit von meinem Schlauchboot zu einem Haufen. Den Rest lagerte ich als Reserve griffbereit. In den Segeltuchtaschen, die ich noch einmal gründlich durchstöberte, fand ich ein Messer und fing an Späne zu schneiden. In einem gewachsten Päckchen entdeckte ich Streichhölzer — man hatte bei der Ausstattung des Rettungsbootes offenbar an alles gedacht.
Dann aß ich und trank einen kleinen Schluck Kognak.
Erst wollte ich noch einige Stunden wachen, später das Feuer anzünden. Seine Glut würde einige Stunden, während ich schlief, vorhalten.
Ich saß, die geladene Leuchtpistole und Munition neben mir, das zusammengelegte Segel als Sitzpolster, bequem gegen die Wulstung des Gummibootes gelehnt und betrachtete den herrlich schimmernden Sternenhimmel, der sich über mir wölbte. Über der hoch aufragenden Felsenkuppel konnte ich das Kreuz des Südens anpeilen. Sein Lauf am Firmament sollte mir als Stundenmaß gelten. Hoffentlich würde nur nicht erneut der Nebel alle meine schönen Pläne zunichte machen.
Ich mochte wohl eine Stunde so gesessen haben. Da——!!!
War das nicht das Geräusch von Propellern?
Wie ein Irrsinniger sprang ich hoch, spähte in die Richtung, aus der der Schall kam, und da erkannte ich auch schon die roten, grünen und weißen Positionslichter. Ich hockte mich nieder, suchte in wilder Hast nach meiner Pistole und der Leuchtmunition, stopfte mir die Taschen davon voll, jagte auf die Höhe und schoß.
Wie ein gleißender Meteor stieg eine weiße Kugel in die Höhe, schuf Tageshelle, bis das Geschoß im leichten Bogen verlosch.
Ich lud — schoß — lud — schoß — rot — rot — grün — so wie ich die Patronen aus der Tasche riß. Es war ja auch völlig gleichgültig! — Nur Signal geben!
Abermals zischte ein weißes Fanal in die Lüfte, zerbarst oben in drei farbige Sterne, die langsam niedersanken.
Jetzt hielt ich inne. Das Flugzeug war schon näher gekommen. Hatte man aufgepaßt, meine Signale bemerkt? Mich überfiel Furcht, meine kostbare Munition weiter so verschwenderisch zu verpuffen.
Da — Da!
Von dem Flugzeug antwortete ein dreifarbiger Leuchtregen.
Ich bebte vor Erregung, schrie, schwenkte die Arme.
Die Maschine dröhnte über mir.
Grellweißes Licht umflutete mich.
Eine Fallschirmleuchtkugel schwebte taumelnd in nicht allzu großer Höhe.
Das Flugzeug zog einen Bogen, kehrte zurück.
Noch immer war das Dunkel durch die stechend weiße Lichtflut aufgerissen, meine Augen waren geblendet.
Ich lauschte auf das Dröhnen der Motoren — die Maschine kreiste.
Flackernd erlosch die Fallschirmsonne.
Drei grüne Fanale! Dann nahm der brummende Riesenvogel wieder Kurs auf und verschwand.
Ich war gesehen worden. — Ich schluchzte vor rasender, peitschender Freude.
Her mit dem Kognakkanister!
Ich stolperte in mein braves Schlauchboot, schlug der Länge lang auf den Holzrost. Was tat's schon?
Ich war gerettet!
Ich trank in seligen Zügen, Freudenfeier allein mit mir selbst.
Wohl eine halbe Stunde hab ich dann noch wach gesessen. Herrgott, wie die Sterne funkelten!
Als die Erregung abgeebbt war, wickelte ich mich in meine Segelleinwand und schlief.
Der folgende Tag wurde eine einzige große Enttäuschung, denn der mir jetzt erst recht verhaßte Nebel nahm von Stunde zu Stunde zu. Erst gegen Nachmittag verscheuchte ihn eine leichte Brise. Langsam wurde ich mir darüber klar, daß man, falls das Flugzeug vom Wetterdienst war, Abstand von einem erneuten Flug zu meiner Insel genommen hätte. Man wußte mich geborgen und mit Proviant versehen, warum ein unnötiges Risiko eingehen? Nur mit einem Wasserflugzeug konnte man mich bergen, und gerade solche Maschinen bedürfen klarer Sicht, um ihre Manöver durchzuführen.
Einstweilen beschloß ich darum, mir erst einmal die Insel näher anzusehen. War es möglich, daß ich dieses verwunschene Eiland der Ausführung meiner Pläne, die nun wieder mit Macht auflebten, dienlich machen könnte?
Bei meinem Herumstreifen entdeckte ich eine wulstartige Einsattelung im Gestein, die sich um die mächtige Felsenkuppe ansteigend herumschlang. Schwindel ist mir unbekannt. So konnte ich die zunächst waghalsig erscheinende Kletterei getrost aufnehmen. Doch ich wurde sehr bald gewahr, daß dieses Unterfangen einem harmlosen Spaziergang gleichkam, denn der Wulst war in seinem Übergang an den Felsendom fast horizontal und wegbreit.«
»So entdeckten Sie die Höhle, die auch ich heute fand«, unterbrach Martin Damm.
»Ganz recht!« fuhr Sill fort. »Allerdings verschloß die Höhle damals noch eine leicht verfallene Tür. Einige Pritschen, ein wohlgezimmerter Tisch und Stühle waren noch vorhanden, doch alles war verwahrlost und lange Zeit nicht benutzt, das fiel sofort auf. Die Höhle selbst bestand aus einem unbehauenen Naturstein, nicht so säuberlich in Flächen abgeglättet wie jetzt. Die Wände waren sehr feucht, dicker Schimmel lag wie weißes Linnen auf allem, was aus Holz bestand.
Aber woher rührte diese Feuchtigkeit? Draußen war alles trocken.
Sollten die Meereswinde, der Nebel, die Ursache sein? Diese Erklärung erschien mir wenig wahrscheinlich, zumal ich die, wenn auch baufällige Tür geschlossen vorgefunden hatte.
In meiner Hosentasche steckte eine Streichholzschachtel. — Ich riß ein Hölzchen an und tastete mich im matten Schimmer weiter vor, bis die Flamme verlosch. Nach mehrmalig neuem Anzünden erreichte ich einen in das Gestein gepreßten Balken, der wie eine Schranke den Weg versperrte.
Meine kümmerlichen Leuchten reichten nicht aus, um festzustellen, warum man diese offensichtliche Vorsichtsmaßnahme hier angebracht hatte. Ich legte mich auf den Boden, kroch etwas vor und — ertastete einen nahezu senkrechten Abfall des Gesteins.
Hier mußte ein Abgrund sein.
Licht, mehr Licht! Ich wollte jetzt um jeden Preis wissen, wie dieser Felsendom von innen aussah.
Eine Taschenlampe besaß ich nicht. Da fiel mir meine Leuchtpistole ein.
Schnell kehrte ich um und stand nach einer guten halben Stunde an der gleichen Stelle. Ich zielte schräg nach unten. Ohrenbetäubend krachte in vielfachem Echo der Schuß. Das Leuchtgeschoß entzündete sich. In strahlender Helle lag unter mir ein riesiger Hohlraum, dessen Ausmaße unfaßbar groß erschienen.
Einige Male noch habe ich meine Munition verschossen, dann begab ich mich sehr nachdenklich zu meinem Schlauchboot zurück.
Meine einwandfrei getroffenen Feststellungen lauteten wie folgt:
Erstens: Der Felsendom war hohl.
Zweitens: Sein Grund bestand aus einer nahezu ebenen Fläche, die sich schätzungsweise in Höhe des Meeresspiegels ausbreitete.
Drittens: Die entdeckte Eingangshöhle mündete etwa einhundert Meter über dem Ozean in den hohlen Dom, der sich wohl annähernd drei- bis vierhundert Meter nach oben fortsetzte.
Viertens: Aus mehreren Stellen des Grundes entströmte Dampf. Diese Tatsache bot auch die Erklärung, warum das Innere der Höhle so feucht war.«
Sill schwieg einen Augenblick, während er in Erinnerung versunken an seinem Glase nippte.
»Endlich hatte ich gefunden, was ich so lange gesucht hatte, und dazu unter Bedingungen, wie ich nie zu hoffen gewagt hätte. Denn hier war zugleich auch eine Energiequelle vorhanden, deren ich dringend bedurfte. Sie verstehen: Wo Dampf ist, muß auch Hitze sein, und Wärme ist Energie. Die aber bedeutete für meine Planungen einfach alles. Gewiß hätte ich nach irgendwohin beliebige Mengen Kohlen schaffen können. Der fortwährende Nachschub aber mußte selbst bei guter Tarnung eines Tages auffallen und eine Spur weisen, der allzu neugierige Reporter einmal hätten folgen können.«
»Ihre Erwartungen, die Sie in diese Energiequellen setzten, haben sich anscheinend erfüllt?« fragte Martin Damm.
»Ja«, entgegnete Sill, »sie wurden sogar bei weitem übertroffen. Aber kehren wir zunächst noch einmal zu dem einsamen Schiffbrüchigen zurück.
An diesem Abend aß ich zum erstenmal aus den vorgefundenen Büchsen warm. Mein Holzfeuer brannte.
Um mir ein bequemeres Nachtlager zu bereiten, ließ ich die Luft aus dem Schlauchboot, dessen zusammengefalteter Gummi mir bald eine herrlich weiche Unterlage bot. Ich schlief, bis mich die helle Sonne weckte.
Der Tag blieb klar.
Gegen Mittag vernahm ich Motorenbrummen. Eine Stunde später schon saß ich geborgen in dem Seenotrettungsflugzeug. Der mitgeflogene Arzt fand an Stelle eines beklagenswerten und erschöpften Patienten einen quicklebendigen Erzähler, dessen Bericht er genau so gespannt lauschte, wie Sie es taten. Prosit, mein lieber Damm!«
»Sehr zum Wohl!«, entgegnete Martin Damm, der wie verliebt dem edlen Wein zusprach, doch achtsam jedes Wort der Schilderung aufgenommen hatte.
»Gott sei Dank hatte ich beim Oberbordgehen meine Brieftasche in der Hose getragen. So war ich denn in der glücklichen Lage, daß ich dem Leiter der dortigen Organisation nicht nur in Worten meinen Dank abzustatten brauchte, sondern ich konnte ihm einen Bankscheck überreichen, der zwar recht zerknittert und vom Seewasser mitgenommen war, der ihn aber sonst wohl zufriedengestellt haben dürfte.
Die weiteren Formalitäten, Protokollaufnahme und was sonst ein wohlgeordnetes Polizeiwesen verlangt, waren bald erfüllt. Ich gab wahrheitsgemäß an, daß ich, von plötzlicher Übelkeit befallen, über Bord gegangen war. Diese Aussage deckte sich vollständig mit der drahtlosen Durchgabe jenes wackeren Kapitäns.
Dann nahm ich ein Taxi, fuhr in die Stadt und kleidete mich von Kopf bis Fuß neu ein. Gegen Abend zog ein vollendeter Gentleman, mit allem erforderlichen Handgepäck versehen, in ein Kapstädter Hotel ein.
Mich lockten nur zwei Dinge. Eine Badewanne und ein richtiges Bett. Von beiden habe ich dann auch ausgiebig Gebrauch gemacht.
Als ich gegen Mittag des nächsten Tages erwachte, war mein erster Gedanke: Die Insel mußt du haben!
Wem gehörte sie rein staatspolitisch und — wer hatte außer mir dort noch Interessen?
Ich wandte mich zur Klärung all dieser Fragen einfach noch einmal an den Seenotrettungsdienst. Hier mußte man schließlich Bescheid wissen.
Mit einem Taxi fuhr ich bei einer Weinhandlung vor und kaufte zwei Körbe voll Whisky, Gin, Wermut und was man sonst noch zu anständigen Mixdrinks benötigt. So ausgerüstet, erreichte ich bald mein Ziel, den Wasserflughafen.
Na! Die Freude dort war groß, und bald saßen wir fröhlich zechend beisammen. Es währte auch nicht lange, so kam das Gespräch auf unsere Insel. Mein Pilot hatte sie zum erstenmal angesteuert. Es wurden genaue Seekarten herausgekramt. Nur auf einer derselben war sie als schwarzer Punkt ohne jeden Namen eingetragen. Ich fand sehr bald heraus, daß keiner etwas Näheres wußte. Sie lag zu sehr außerhalb jedes normalen Flugkurses. Daß Schiffe sie mieden, war bei dem dort häufigen Nebel selbstverständlich.
Nach etwa zweistündigem Geplauder war ich kaum schlauer als zuvor. Da kam mir gerade im letzten Augenblick, als ich mich schon entschlossen hatte aufzubrechen, ein Zufall zu Hilfe. Ein alter Funkoffizier brachte ein Telegramm. Es muß wohl belanglos gewesen sein, denn er nahm, von mir aufgefordert, in unserer Runde Platz.
Als er die ausgebreiteten Karten wahrnahm, sagte er:
›Aha! Sie suchten die Daumeninsel?‹
›Daumeninsel?‹ fragten seine Kameraden verblüfft. ›Wie kommst du auf Daumeninsel? Auf der Karte ist kein Name angegeben!‹
›Stimmt‹, sagte der Grauhaarige. ›Die merkwürdige Insel hat keinen Namen und ist, was gewiß einen kuriosen Fall darstellt, sozusagen staatenlos. — Ich wüßte auch nichts davon, besäße ich nicht einen uralten Onkel in Port Elisabeth, der dort mit fünfundsechzig Jahren noch am Pfosten eines Ehebetts hängen blieb und den Walfang ein für allemal aufgab. Sie leben beide noch, sind zäh wie Hundsleder. — Er war übrigens Norweger, wie ich. — Nur mit der Walfängerei, da hat irgend etwas nicht gestimmt. Er muß es wohl mit der gesetzlichen Schonzeit nicht so ganz genau genommen haben.‹ Er zwinkerte mir vielsagend zu. ›Und da war die verlassene Daumeninsel — sein — na, ihr wißt schon, was ich sagen will. Möchte dem guten Alten nicht nachträglich irgendwelche Scherereien machen. — Aber Daumeninsel heißt das gottverlassene Eiland, darauf könnt ihr euch verlassen!‹
Mehr erzählte er nicht. Nur eines konnte ich ihm noch entlocken: die Anschrift seines Onkels.
Und zwei Tage später saß ich in Port Elisabeth bei dem Alten. Erst wollte er nicht so recht mit der Sprache heraus. Schließlich erfuhr ich dann aber doch alles, was ich wissen wollte:
Die Daumeninsel war vor rund dreißig Jahren sein Piratenversteck zur Trankocherei gewesen. In der Höhle hatte er die Fässer gestapelt, die Wale, selbst in der Schonzeit, erbarmungslos ausgerottet und zu Geld gemacht, sein schwer mit Walöl geladenes Schiff aber nur dann zu einem Umschlaghafen gesteuert, wenn die erlaubte Zeit gekommen war.
Sie hatten allesamt, vom Schiffsjungen aufwärts, viel Geld verdient. Als er dann in Port Elisabeth hängenblieb, war das sein Glück. Denn sein Schiff kehrte unter dem Kommando seines ersten Offiziers schon von der ersten Reise in das Südpolargebiet nicht mehr zurück und war spurlos verschollen!
Ich hatte genug erfahren«, sagte Sill, »und am gleichen Abend noch trat ich die Rückreise nach Kapstadt an. Zwanzig Tage später verließ ich einen der neuesten Ozeandampfer in Southampton, und abermals zwanzig Tage danach saß ich in einem Korbsessel auf der Hazienda meiner Schwester in Mexiko.
Und damit begänne der zweite Teil meines Unternehmens, doch ich glaube« — er schaute auf die Uhr — »das würde wohl zuviel werden, für Sie und — für mich. Sie haben heute allerlei hinter sich und, das kann ich mit Genugtuung feststellen, ich auch. Darf ich Ihnen vorschlagen, daß wir für heute Schluß machen?« Er stand auf, und auch Martin Damm erhob sich.
»Ich danke Ihnen für Ihr aufmerksames Zuhören. Schlafen Sie wohl, diese erste Nacht hier auf der Daumeninsel, und« — fügte er hinzu — »morgen früh dann auf Wiedersehen.«
Ohne daß Damm noch die Möglichkeit hatte, auch nur ein Wort zu äußern, war der Bildschirm abgeschaltet und Sill seinen Blicken entschwunden.
Martin Damm glaubte zwei, drei Stunden geschlafen zu haben, als er durch polternde Geräusche im Nebenraum wach wurde. Erschreckt sprang er aus dem Bett, öffnete hastig die Tür und erstarrte fast vor Staunen.
Im Nebenraum standen vier, in schwarze Gummianzüge vermummte Gestalten, die sich an einem schweren, werkbankähnlichen Tisch, der am Tage zuvor noch nicht dagestanden hatte, zu schaffen machten. Das Licht der Deckenbeleuchtung strahlte in seiner ganzen Helle und spiegelte sich in dem wie speckig polierten Gummi. Aus den taucherähnlichen Kopfhelmen blitzte ihn hinter Glasscheiben das unheimliche Weiß der Augen an. Als die Männer Damm erblickten, hielten sie in ihrer Arbeit einen Augenblick inne und musterten ihn kurz, dann senkten sich die Helme, die Gummihände griffen zu und setzten das unterbrochene Werk fort. Man kümmerte sich nicht mehr um ihn.
Damm war völlig fassungslos. Er spürte, wie sein Puls hämmerte — jede Sekunde müßte — würde etwas geschehen. Doch es geschah nichts — gar nichts. Kurz entschlossen zog er die Tür hinter sich zu und wartete.
Verteufelt merkwürdige Weckmethoden hatte dieser Sill, einen mitten in der Nacht——.
Er blickte auf die elektrische Wanduhr, deren leises, stoßweises Rucken ihn jetzt erst auf sie aufmerksam werden ließ.
Mein Gott! Elf Uhr vorüber!
Schöne Bescherung, den Vormittag so zu verschlafen!
Er erinnerte sich wieder, daß die Zeiger, als er zum letzten Male nach ihnen geblickt hatte, auf drei gegangen waren.
Über sieben Stunden fest geschlafen?
Doktor Sill hatte wahrhaft Rücksicht auf den Langschläfer genommen, das mußte man ihm zugestehen.
Aber was wollten — was wollten die Kerle da nebenan?
Wozu die Gummianzüge, die fest verschlossenen Helme?
Eine rasche Erkenntnis sprang auf. Mein Gott — ich bin noch nicht stubenrein! So also schützte Sill seine Gemeinde gegen unwillkommene Ansteckung.
Martin Damm mußte lachen.
Immerhin — sicher waren diese seltsamen Methoden auf alle Fälle, nicht einmal seine Luft konnten jene Gummimänner atmen, aber — mein lieber, verehrter Sill, dein System ist zum mindesten als einzigartig anzusprechen...
Schon war Damm drauf und dran, wieder seinen Grübeleien zu verfallen — da hörten die Geräusche von nebenan auf.
Jetzt nichts als anziehen und raus! Martin Damm wusch und rasierte sich im Blitztempo, wählte aus dem Schrank einen Overall, passendes Schuhwerk und schon verließ er das Schlafzimmer.
Seine eigenen Sachen trug er als Bündel unter dem Arm. Im Fernsehraum musterte er kurz die dort aufgestellte Werkbank, packte dann eingedenk der Aufforderung Sills alle Habe in die beiden Koffer, öffnete nicht ohne Anstrengung das Felsentor und verstaute die beiden Gepäckstücke in der jetzt weit aufsperrenden Luke.
Ein brennender Trieb überkam ihn, noch einmal auf den Ozean hinauszuschauen. Die Stahltür gab nach.
Er stand draußen und atmete in tiefen Zügen die frische, herbe Seeluft. Seine Blicke umspannten die unendliche Weite des hell azurenen Horizonts.
Wann wirst du dieses Bild wiedersehen?
Kurz entschlossen machte er kehrt, schob mit dem Fuß die Tür ins Schloß, durchschritt den Vorraum und stemmte sich von innen gegen das Felsentor, um auch dieses fest zu verschließen.
Jetzt hatte er sich endgültig aus freiem Willen gefangengesetzt. Das wußte er! Sill sollte keinen Anlaß finden, ihm auch nur das leiseste Mißtrauen entgegenzubringen.
Er verspürte Hunger.
In der Futterluke stand, wie erwartet, der Morgenimbiß.
Er deckte den Tisch und stellte die wiederum seltsam anmutenden Gerichte darauf.
Eine Thermoskanne enthielt ein dunkles, aromatisch duftendes, heißes Getränk. Auf einer Platte lagen wiederum warme Röstbrotschnitten, während in einer Porzellanpfanne etwas Gebackenes von seltsamer Farbe brutzelte, was einen an durcheinandergeratene Spiegeleier mit Schinken erinnerte.
Alles mußte erst vor kurzem zubereitet und angerichtet worden sein.
Die Aufmerksamkeit hier war ohne Zweifel vollendet, nicht nur die rein gastgeberische, sondern auch die, die seiner Person galt.
Das Essen mundete vorzüglich, und obwohl die Portionen keineswegs groß waren, fühlte er sich dennoch angenehm gesättigt.
Als er den Tisch abgedeckt hatte, musterte er aufs neue, dieses Mal eingehend, die Werkbank, und plötzlich wurde er gewahr, daß er im Gegensatz zu seiner sonstigen Lebensgewohnheit nicht den geringsten Appetit auf Rauchen verspürte. Ob die Speisen vielleicht etwas enth.....? Er nahm eine Zigarette, zündete sie an und ...
Brr! Er spie auf die Erde.
›Zum Kuckuck, das schmeckt ja wie Stroh!‹ Er trat die Zigarette aus. Der Qualm war unerträglich.
›Ist ja ein Teufelskerl, dieser Sill!‹ dachte Damm, ›macht einen im Nu zum Nichtraucher! — Na, schönen Dank auch, mir ist's nicht leid darum — im Gegenteil.‹
Er zog einen Stuhl zur Werkbank. Seine elektrische Peilsonde lag darauf. Als er sie zur endgültigen Reinigung in Arbeit nehmen wollte, stellte er verblüfft fest, daß die Geräte meisterhaft sauber und sämtliche Metallteile entweder hauchdünn gefettet oder mit glasklarem Spritzlack überzogen waren.
»Kompliment, Herr Doktor Sill!«, lachte er in unverhohlener Anerkennung dieser Heinzelmännchenleistung laut auf. »Danke herzlichst!« klang es heiter hinter ihm aus dem Lautsprecher.
Martin Damm fuhr wie von einer Natter gestochen herum. ›Ist man hier denn keinen Augenblick allein?‹ durchfuhr es ihn voller Empörung.
»Sie sitzen gewiß an dem Arbeitstisch, den ich Ihnen heute früh hereinschaffen ließ? Erst einmal: Einen fröhlichen guten Morgen, mein lieber Damm! Wie ist Ihnen der gestrige Abend bekommen?«
»Ausgezeichnet! — Guten Morgen, Sill! — Ich könnte besser guten Mittag sagen. — Schlief wie ein Murmeltier!« Bei diesen Worten spähte Martin Damm ringsum im Raum, irgendein Guckloch zu entdecken. Nichts dergleichen.
»Sie suchen mich?« meinte der Unsichtbare. »Ich höre es an Ihrer Stimme, daß Sie den Kopf nach verschiedenen Richtungen wenden! Seien Sie nicht ungehalten ob des einfachen logischen Schlusses aus meinen akustischen Wahrnehmungen. Ich sehe Sie wirklich nicht! Nichts liegt mir ferner, als meinen verehrten Gast etwa zu beschnüffeln. Eine solche Handlungsweise müßte unweigerlich den Bruch und damit das Ende jeden Vertrauens heraufbeschwören.«
›Hat dieser unglaubliche Bursche hier tatsächlich Apparate verborgen, die Gedanken lesen können?‹ durchfuhr es Martin Damm.
Unbeirrt fuhr die Stimme fort:
»Es ist Ihnen gewiß bekannt, daß alles, was spanisches Blut in sich trägt, Gastfreundschaft als die edelste Tugend schätzt und pflegt. Man kann es schon als grotesken Zufall bezeichnen, daß ich gerade in dem Augenblick Mikrofon und Lautsprecher einschaltete, als Sie Ihren liebenswürdigen Dank äußerten, und da ließ ich mir die Gelegenheit nicht entgehen, Sie ein wenig zu überrumpeln. Von dieser Untugend kann ich nun mal nicht ablassen, —— Amice, peceavi! O Freund, sei mir armem Sünder gnädig!«
Die Worte tönten mit verstellter Stimme so unwahrscheinlich reumütig, daß Martin Damm zum zweiten Male an diesem Tage in ein befreiendes Gelächter ausbrach.
»Als Rundfunksprecher müßten Sie sich großartig machen, mein lieber Sill!« meinte er ausgelassen. »Doch zur Beruhigung Ihres Gemüts sei Ihnen versichert, daß ich Ihnen die erbetene Absolution hiermit gerne erteile.«
»Sehr schön! Ich fühle Zentnerlast von meinen Schultern weichen!« lachte jetzt Sill. »Doch hören Sie. Der Zweck meines Anrufs war, erstens Ihnen zu sagen, daß sich, wie gestern abgemacht, in dem Rohrposttubus die fünftausend Dollar befinden, zweitens von Ihnen zu erfahren, welche Spannungsquellen Sie für Ihre Peilsonde benötigen. Elektrische Geräte, besonders solche mit Verstärkerröhren, haben es nun einmal an sich, keinen Muck von sich zu geben, wenn ihnen keine Energie zugeführt wird! Wie steht's also damit?«
»Normalerweise einhundertzwanzig Volt Gleichstrom und etwa zwei Komma fünf Volt Heizspannung!« antwortete Damm. »Für größere Tieflotungen benötige ich allerdings einen kleinen Umformer, einen Benzinmotor mit einem Tausend-Volt-Dynamo gekuppelt!«
»Hm!« brummte Sill nachdenklich. Dann nach kurzer Pause: »Ihr Stahlakku ist noch in Ordnung, schon mit neuer Lauge gefüllt und bereits in Ladung. Sie erhalten ihn heute nachmittag, und was die hundertzwanzig Volt anbetrifft, so werde ich Ihnen einige Anodenbatterien anfertigen lassen, damit Sie bei Ihren Messungen nicht unnötig Leitungen nachschleifen müssen. Derartige Batterien sind doch, wie ich glaube, vorgesehen?«
»Sehr richtig!«
»Na ja! Sehr einfach! Zink, Braunstein und Kohlenstifte habe ich auf Lager. Spätestens morgen früh bekommen Sie die fertigen Batterien. Die Innenmaße sind bereits notiert!«
Doktor Martin Damm vermochte ein Gefühl steigender Achtung nicht zu unterdrücken. Hatte Sill denn überhaupt nicht geschlafen, daß er sich so sehr eingehend mit seinem Apparat beschäftigt hatte, und dann diese erstaunlichen Fachkenntnisse, über allem aber das unbestreitbare Organisationstalent. Was mußte da im Felsendom an Rohmateriallagern und Werkstätten vorhanden sein, wenn so rasch eine Spezialfabrikation aufgenommen und durchgeführt werden konnte.
»Warten Sie! — Ich schalte den Fernseher ein, dann können wir uns besser unterhalten und über die Einzelheiten klar werden. — Würden Sie bitte inzwischen an Ihrem Eßtisch Platz nehmen?«
Fast wie ein Befehl tönten die Worte aus dem Lautsprecher, wie der Befehl eines von der Arbeit besessenen Industrieleiters, der ein neues großes Betätigungsfeld vor sich sah.
Das Erlöschen der Deckenlampe, das Aufflammen der vermutlich Quecksilber und Argon enthaltenden Leuchtröhren, das unstete Flimmern der Fernsehscheibe waren für Martin Damm nun schon gewohnte Erscheinungen.
Es vergingen wohl zwei Stunden in rascher, lebendiger Diskussion. Nie drang Sill darauf, technische Einzelheiten zu erkunden, die das Lotungsverfahren Doktor Damms entschleiert hätten. Es ging ihm ausschließlich darum, das Gerät arbeitsfähig zu machen. Auch das Problem des transportablen Tausend-Volt-Aggregats wurde gelöst. Ein Telefon sollte zur Werkbank gelegt werden, damit man sich jederzeit sofort ins Einvernehmen setzen könnte, falls sich etwa der Wiederherstellung der kostbaren Peilsonde unerwartete Schwierigkeiten in den Weg stellten.
Dann trennte man sich. Gegen neun Uhr abends wollte Sill sich wieder melden und von den ersten Anfängen der Felssiedlung berichten.
Zwölf Tage später.
Doktor Damm hatte sich in seinen beiden Räumen gut eingelebt. Wie am ersten Abend, so war es auch an den folgenden immer spät geworden. Sill hatte seinen Gast nicht nur mit vorzüglichen Weinen eigener Fabrikation bewirtet, sondern obendrein auch die Darstellung des Werdens seines Werks lückenlos zu Ende geführt. Tagsüber war Damm voll in seine Arbeit eingespannt, denn es ergab sich, daß der Peilsonde das salzige Seebad keineswegs so gut bekommen war, wie der erste Eindruck glauben machen konnte. Das Gerät war schließlich ein feinmechanisches Kunstwerk, und derartige Dinge pflegen völlig unangebrachte Bäderbehandlung mit vielerlei Mucken zu beantworten, die nur Schritt für Schritt behoben werden konnten, bis schließlich das einwandfreie Arbeiten in Probemessungen bestätigt wurde.
Zwei Tage nur trennten Martin Damm noch von der Beendigung seiner »Desinfektionsquarantäne«. Körperlich fühlte er sich frisch wie nie zuvor. Die Sillsche Kost, das mußte der Neid ihr lassen, blieb nach wie vor vorzüglich, waren auch die dargereichten Portionen von Tag zu Tag kleiner geworden. An Stelle des heimlich befürchteten Kräfteschwundes glaubte Damm eher eine Stärkung zu verspüren. Sein Gewicht konnte er zwar nicht prüfen, doch stand ohne jeden Zweifel fest, daß seine geistige Spannkraft in durchdringender Klarheit und sprühender Energie die stets neuen Anforderungen der absonderlichen Umwelt meisterte.
Doktor Sill hatte ihm sehr ausführlich dargelegt, daß eine rein künstliche Pillenernährung an den inneren Organen und ihrer langgewohnten Funktion scheitere. Füge man jedoch der synthetischen Konzentratnahrung genügend Mengen unverdaulicher Zellulose in hinreichender Menge bei, so sei das Problem gelöst. Magen und Därme »amüsieren sich«, wie seine Worte lauteten, mit der zwar unverdaulichen, für diese Organe aber unbedingt notwendigen Reib- und Knetmasse. Die synthetischen Nährstoffe ihrerseits benötigten zum Aufschluß der inneren Sekretion genau so wie echte Kost. Es komme ausschließlich auf die exakten Gewichtsbestimmungen an. Der dem Menschen nun einmal unentbehrliche Gaumenkitzel und Geschmacksreiz sei nur eine Frage geeigneter und ebenfalls künstlich hergestellter Ingredienzien und der Art der Zubereitung der Speisen in Getränken, Suppenform, nachgeahmten Brot- und Teigwaren, Puddings, Bratstücken und so fort. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und ein paar Salze sei alles, was man benötige. Die erstaunlichste Tatsache, die Martin Damm vernahm, war die, daß bei einer auf rund tausend Menschen eingestellten Fabrikation die Tageskosten der Ernährung für den einzelnen sich auf noch nicht zwanzig Cents beliefen.
Martin Damm bereute es nicht mehr, hier notgelandet zu sein, und brannte förmlich darauf, bald das gesamte Werk und seine Insassen kennenzulernen. Was sich jetzt schon vor ihm auftat, bedeutete einen Blick in die Zukunft, die gewiß einmal Tatsache werden würde. Daß derartige Aspekte auf dem weiten Erdenrund nicht von heute auf morgen zu realisieren seien, das war ihm klar.
Er stand im Banne der Ideen Sills!
Zwei Tage noch, dann hatte sein Eremitendasein ein Ende. Er würde alles sehen und erleben, und zwar als gleichberechtigtes Mitglied der unterirdischen Gemeinschaft. Seine früheren Fluchtpläne waren völlig vergessen — ja einfach wie weggeblasen. Was tat es schon, wenn er länger hier bliebe? Bot die Welt da draußen wirklich stärkeren und fesselnderen Anreiz als das Leben hier? Das Gefühl des Geborgenseins erlöste die sonst hastenden Nerven und Sinne von dem Druck, der ewig auf ihnen lastete, und setzte nahe und greifbare Ziele, die zu erreichen es wahrlich lohnte.
Martin Damm schlief in den Nächten traumlos und fest.
»Der Teufel hole diese ganze verdammte Geschichte!« Ein kräftiger Faustschlag untermalte den lauten Stoßseufzer des sonst nie aus seiner Nilpferdruhe zu bringenden Chefs der Kriminalpolizei in Kapstadt. Nilpferdhaft wie seine sprichwörtliche Unerschütterlichkeit waren auch seine körperlichen Ausmaße. Böse Zungen, und deren gab es in der Stadt am Tafelberge in großer Zahl, behaupteten, er habe sich auf das Fahrgestell eines Zweitonnenlieferwagens eine Spezialkarosserie bauen lassen, um den Transport seines kolossalen Leibes nicht zu gefährden. Eigentlich hieß er Oliver Aston, so stand es auch in den Geburtsregistern. Arglistige Freunde hatten ihn jedoch »Hypopotamus« getauft.
Aus dieser Bezeichnung, über die, das sei nicht verschwiegen, nach einigem Alkoholgenuß die Zunge leicht stolperte, war mit der Zeit die mundgerechte Abkürzung Hyppo geworden, die so stadtbekannt war, daß Uneingeweihte den hohen Chef oft arglos mit Mister Hyppo anredeten. Oliver Aston verzog nie eine Miene, wenn solches geschah, ja, man konnte sogar den Eindruck gewinnen, daß er diesen Namen durchaus gern hatte, mahnte er ihn im Bedarfsfalle doch zugleich daran, dem wirklichen Namensträger entsprechend nie die Ruhe zu verlieren.
Heute aber hatte es ihn doch erwischt!
Seit etwa fünf Tagen beschäftigten sich mehrere seiner Beamten damit, sämtliche Schiffsregister der Welt nach einer rätselhaften Bark zu durchsuchen, und in langen, kostspieligen Funkgesprächen oder Telegrammen von den etwa in Frage kommenden Hafenbehörden zusätzliche Auskunft zu erheischen. Der anfänglich harmlos erscheinende Fall drohte in eine Kriminalgeschichte ohne Lösung auszuarten, und das verdroß Mister Oliver Aston um so mehr, als man ausgerechnet ihn für die Unauffindbarkeit der plötzlich von der ganzen Welt gesuchten Person verantwortlich machte.
Und warum?
Nur weil das Flugzeug jenes Taugenichts vom Flughafen Kapstadt aus gen Australien gestartet und drüben nicht angekommen war, der notgelandete Insasse aber, so stand es wenigstens in den Akten, von einer Bark »Bengalia« aufgefischt worden sei.
»Herein! — Aha, Captain Cross! — Treten Sie näher! — Nehmen Sie bitte hier Platz, alter Knabe! — Freut mich ungemein, daß Sie so rasch herkamen!« Der Kommandant des Kapstadter Flughafens ging auf Hyppo zu.
»Morgen, lieber Aston!« Die beiden Männer schüttelten sich die Hände wie gute alte Bekannte, dann zog sich Cross den Armstuhl zurecht und ließ sich nieder.
»Heitere Geschichte mit diesem Doktor Damm!« meinte er in einem Tonfall, der den anderen bewußt in Harnisch bringen sollte.
Doch Hyppos Fell trotzte solch harmlosen Anzüglichkeiten.
»Sie haben recht! — Sehr heiter! — So was bringt mal wieder etwas Schwung in meinen vermufften Generalstab, und das Ameisengekribbel der aufgestörten Sterblichen verschafft zumindest den Göttern Abwechslung, die unerschüttert aus ihrem Amtsstubenolymp von oben zuschauen!«
Der Angriff konnte als abgeschlagen gebucht werden, und Cross, der Spötter, zog seinen Mund breit vor Vergnügen. So liebte es Hyppo!
»Wieviel Zeitungshengste beglückten Sie schon?« fragte er gleichmütig.
»Zwei!« meinte Aston. »Die weiteren ließ ich rauswerfen.«
»Dafür rächten sie sich mit ihrer Neugierde bei mir. Ich bin schon bei sieben angekommen. — Schätze, daß mein Name bald in allen Weltblättern von Rang stehen wird! — Mal was anderes!«
»Gratuliere!« sagte Hyppo trocken, dann lehnte er sich in seinen Sessel zurück, daß das Holz beängstigend knackte. »Und was haben Sie ihnen für mastfette Enten aufgebunden? — Tatsachen gibt's doch kaum welche!«
»Oooh!« meinte Käpten Cross. »Die Geschichte mit dem ständig besoffenen Monteur Krause, seine fristlose Entlassung und der höchst selten vorkommende Alleinflug über eine so weite Strecke bieten doch schon Stoff genug!«
»Hm! — Für Sie vielleicht! — Sagen Sie mal, Cross, kann dieser Mister Krause Sabotage verübt haben?« Der Leiter der Kriminaldirektion schob den Kopf etwas vor.
»Ausgeschlossen!« entgegnete Captain Cross bestimmt. »Die Kiste Doktor Damms parkte in einem absolut sicheren Spezialschuppen natürlich unter der üblichen Bewachung.«
»Nehmen wir mal an, es läge ein Racheakt vor. — Ein paar Pfundnoten können die festesten Schlösser öffnen.« Die Bemerkung Astons klang wie die rein sachliche Feststellung eines Kriminalisten.
»Alles möglich! — Auch der Zuverlässigste kann mal solcher Lockung unterliegen!« sagte Cross höflich lächelnd. — »Aber! — Nun kommt das Aber! — Dieser Krause hat während der Zeit seines hiesigen Aufenthalts nur Weiber und Wein im Kopf gehabt. — Das steht einwandfrei durch meine Nachfragen fest!«
»Stimmt!« grunzte Aston und legte die mächtige Pratze wie zur Bestätigung auf den Aktendeckel vor sich. »Wollte nur mal wissen, wie Sie über die Affäre denken! — Auf alle Fälle kann man uns höheren Ortes in diesem Punkte keine Vorwürfe machen. — Sprach was dagegen — das ist eine Frage unter Freunden, nicht amtlich«, brummte der Kriminalchef, »diesen Damm alleine fliegen zu lassen? — Macht doch nicht schließlich jeder, so ohne Hilfskräfte über den Ozean zu gondeln!«
»Erstens besaß er eine der modernsten Maschinen, mit eingebautem Selbststeuergerät, zweitens wies sein Bordbuch aus, daß er nicht nur ehemaliger Luftwaffenoffizier war, sondern obendrein ungefähr fünfmal im ganzen gerechnet um den Erdball geflogen war, und drittens hatten zwei meiner besten Monteure die Kiste auf meine ausdrückliche Anordnung auf Herz und Nieren geprüft, bevor ich den Start freigab!«
»Also auch das stimmt!« seufzte Hyppo scheinbar unbekümmert und blätterte in dem Aktenstoß. »Verzeihen Sie, lieber Cross, wenn ich Sie persönlich noch einmal nach all diesen Dingen frage. — Oft bieten sonst unbeachtete Kleinigkeiten wertvolle Anhaltspunkte.« — Er blätterte zerstreut weiter. »Könnte dieser Damm Selbstmord begangen und vorher noch rasch den irreführenden Funkspruch durchgegeben haben?« Ein rasches, scharfes Aufblicken.
»Verrückte Idee!« schnob Cross, sichtlich verblüfft, mehr durch die Nase als durch den Mund sprechend. Als er sich gefaßt hatte, polterte er los: »Auf solche Vermutungen kann nur so eine Polizeidogge wie Sie kommen!«
»Danke für das nette Kompliment!— Müßte ein von jedem Zoo begehrtes Produkt ergeben, die Kreuzung zwischen Nilpferd und Dogge!« Aston zeichnete rasch auf ein aufgegriffenes Stück Papier ein höchst seltsames Lebewesen und schob wortlos die Karikatur seinem Gesprächspartner über den Tisch zu.
Cross brach in ein schallendes Gelächter aus.
»Hyppo! Sie sind und bleiben unbezahlbar! — Darf ich das Blatt behalten?« Er stöhnte vor Vergnügen.
»Aber bitte, wenn Sie dazu beitragen wollen, meinen Ruhm zu vermehren!«
Captain Cross prustete, das Taschentuch vor dem Mund, schüttelte mehrfach den Kopf und war, die groteske Zeichnung noch einmal anschauend, einem neuen Lachanfall nahe.
»Wie ist das nun mit dem Selbstmord?« bestand der Kriminalchef unberührt auf die Beantwortung seiner Frage.
»Augenblick mal, bitte, Sie verrücktes Huhn!« entgegnete Cross. Um seine Mundwinkel zuckte es noch, als er den Fernsprecher näher an sich heran zog.
Die Verbindung war rasch hergestellt. Es folgte ein längeres Warten, bis der von ihm verlangte Monteur eintraf.
»Hallo, Davis! Hier Kommandant Cross. Welches Sendegerät führte die Maschine Doktor Damms mit sich?«
—————
»Also ein ganz normales Gerät, keine Spezialausführung?«
—————
»Mit feststehendem Dreifachwellenbereich im Kurzwellenband?«
—————
»Auf keinen Fall auf die Schiffsverkehrsfrequenz umschaltbar?«
—————
»Das wissen Sie ganz genau?«
Es mußte eine längere Erklärung folgen, denn Cross lauschte angespannt in die Hörmuschel.
»So! — Danke Ihnen, Davis! — Gespräch beendet!«
Captain Cross legte den Hörer auf die Gabel und schob den Apparat an die alte Stelle.
»Ihre Vermutungen scheiden aus!« sagte er zu Aston.
»Weiß zwar nicht, was dieser Mister Davis Ihnen erzählt hat. Ihre Fragestellungen genügen mir aber im Augenblick, um völlig im Bilde zu sein! — Muß den Tatbestand rasch noch einmal schriftlich festlegen!« Der Kriminalchef beendete seine Aufzeichnungen laut murmelnd. »Es ist somit ausgeschlossen, daß die Funkmitteilung der ›Bengalia‹ von Doktor Damm gegeben worden sein kann.«
»Ja, völlig ausgeschlossen!« bestätigte Cross. »Denn der aufgefangene Funkspruch von der Rettung Damms ist im 800-m-Band gemorst worden, während Doktor Damm nur mit einer, allerdings sehr starken Anlage auf Kurzwellen senden konnte. Lediglich sein Empfänger bestrich das Gebiet von fünfzehn Meter bis zweitausendfünfhundert!«
»Ja! — Und diese Bark ›Bengalia‹ gibt es nicht!« knurrte erbost Oliver Aston. Sein Bleistift trommelte unentwegt auf die Tischplatte. »Wenigstens bis jetzt verliefen alle Nachrichten ergebnislos.«
»Das pfeifen schon die Spatzen von den Dächern!« spottete Cross.
»Das mit der Achthundert-Meter-Welle und den Kurzwellen wird Ihr Spatz Davis auch bald auspfeifen.«
»Soll er das nicht?« Schon langte Cross zu dem Fernsprecher.
»Doch, doch, lassen Sie ihn«, erwiderte Oliver Aston. »Ein guter Reporter macht daraus einen neuen Artikel, der sehr rasch den Erdball umkreist! — Vielleicht findet sich gerade dadurch eine neue Spur!«
Kommandant Cross nickte beifällig. Er überlegte eine Weile, dann, während Aston gedankenverloren vor sich hinstarrte, fragte er:
»Sagen Sie mal, Hyppo! Stimmt es, daß durch die Regierung von Neuseeland der Stein in dieser mehr als geheimnisvollen Angelegenheit ins Rollen gekommen ist?«
»Ja! Die Neuseeländer hatten ein Abkommen mit diesem Doktor Damm. Er sollte mit seinem Peilgerät geologische Tiefenlotungen vornehmen. In dem Schriftwechsel war der Termin der Forschungen nicht auf den Tag festgelegt. Plötzlich müssen irgendwelche Erwägungen eingetreten sein, die eine sehr rasche Inangriffnahme der Arbeiten nahelegten. Als nun die Presse berichtete, daß der bekannte Geophysiker Doktor Damm durch einen Flugzeugunfall um ein Haar sein Leben eingebüßt habe, jedoch im letzten Augenblick von einer Bark ›Bengalia‹ gerettet worden sei, einer Bark, die angab, sich auf Kurs nach Singapore zu befinden, da funkten sie nach Singapore die Aufforderung, von dort aus durch Rundspruch an alle Schiffe auf ähnlichem Kurs und alle in Frage kommenden Landstationen Doktor Damm, an Bord der Bark ›Bengalia‹, zu benachrichtigen, von Singapore das nächste Flugzeug nach Neuseeland zu nehmen. Alle Sonderspesen sollten zu ihren Lasten gehen, hieß es sogar! Na, und da ging natürlich die Morserei durch den Äther los. Aber keine Bark ›Bengalia‹ meldete sich. In diesen Tagen wütete ein außerordentlich starker Monsun, so daß sich ohne weiteres ergab, daß eine leichte Bark ihm zum Opfer gefallen sein könnte. Erfolg: neue sensationelle Pressemeldungen. Daß dieser Damm Weltruf in wissenschaftlichen Kreisen besaß, erfuhr ich erst durch die Zeitung.
Mit der ganzen Angelegenheit hätte ich überhaupt nichts zu tun bekommen, Flugzeugunfälle und Schiffbrüchige gehören nicht zu meinem Aufgabengebiet, zumal, wenn sich solche Tragödien weit außerhalb meines Amtsbereichs abspielen, wenn nicht ein übereifriger Kollege aus Neuseeland bei mir angefragt hätte, ob Doktor Damm auch tatsächlich von hier aus nach Australien gestartet sei. Daß ich daraufhin bei Ihnen anrief, wissen Sie. Ich kabelte also die einwandfreien Tatsachen, die Sie mir mitteilten, zurück und betrachtete die Sache damit als erledigt. Darin täuschte ich mich!
Am nächsten Morgen läutete mein Apparat Sturm. Ferngespräch aus Neuseeland! Mein Kollege erklärte mir, es gäbe nur eine Bark ›Bengalia‹, die habe sich aus Schanghai gemeldet. In den verfügbaren Schiffsregistern sei keine zweite Bark ›Bengalia‹ verzeichnet. Der von vielen Stationen aufgefangene und von allen gleichlautend niedergelegte Text der Rettung Doktor Damms müsse demnach eine bewußte Irreführung darstellen. Der Verdacht der Entführung Doktor Damms läge nahe. Dieser mir reichlich phantastisch klingenden Mutmaßung vermochte ich mich damals noch nicht anzuschließen. Ich widersprach aber nicht. Der Kollege bat dann weiter, ich möge doch, in Anbetracht der ohne Zweifel bewiesenen Dringlichkeit des Falles — mir erschien er keineswegs dringlich — feststellen lassen, ob eine Bark ,Bengalia‹ einen Hafen der Union von Südafrika verlassen habe. Eine gleiche Aufforderung ergehe in den nächsten Stunden an alle Anliegerhäfen des Indischen Ozeans.
Was bleibt einem Chef der Kriminaldirektion anders übrig, als höflich eine Zusage zu erteilen, wenn er offiziell von einer ausländischen Zentrale um Unterstützung in der Verfolgung eines angeblichen Verbrechens ersucht wird.
Na! — In wenigen Tagen trat das Fiasko ein. Dieses Mal muß wohl meine sonst so gute Spürnase versagt haben. Der Bescheid aller Hafenämter lautete negativ. Das wissen Sie ja aus der Presse. Ich wollte Ihnen nur klar Ihre Frage beantworten, ob tatsächlich durch die Regierung von Neuseeland der Stein ins Rollen gekommen sei. Außerdem halte ich es für angebracht, Sie als Nächstbeteiligten über die Vorgänge zu informieren, startete doch Doktor Damm von Ihrem Flugplatz. Außerdem wollte ich von Ihnen mal hören, ob Sie es für möglich hielten, daß Damm den Funkspruch fingiert und Selbstmord begangen habe. Da diese Lösung des Falles Damm offensichtlich ausscheidet, sind wir genau so schlau wie vorher — sagen wir getrost: so dumm!« schnaufte Hyppo, kniff die Augenlider zusammen und ähnelte, als er nunmehr den Mund zu einem gewaltigen Gähnen aufriß, tatsächlich bemerkenswert einem Nilpferd. »‹Tschuldige, Cross! — Hab die ganze Nacht gearbeitet. Kapstadt und Singapore sind im Augenblick die Zentralstellen der Fahndungsaktionen!«
Es klopfte an die Tür.
»Ja! — Herein!«
Ein Beamter betrat das Zimmer mit einem Stoß Akten und übergab sie dem Chef.
»Danke, Philipp! — Sonst was? — Nein? — Na, denn gut!«
Während der Bote sich entfernte, blätterte Oliver Aston schon in den Papieren.
»He! — Wird ja immer schöner! Jetzt werden die Regierungen munter. Washington muß wohl ganz besonders stark von dem Verschwinden dieses Herrn betroffen sein. — Und hier, Downing Street, höflich und korrekt, wie immer in London. — Verfluchtes Kuckucksei in meinem Nest! — Wenn mir diese gottverdammte Bark ,Bengalia‹ in die Hände gerät...« — Er vollendete den Satz nicht. Der Sessel knackte wieder einmal besorgniserregend.
Dann glättete sich die Miene des Kriminalchefs. Hyppo saß wieder freundlich lächelnd, zurückgelehnt in seinem Stuhl.
»Ja, Cross, Sie haben es gut in Ihrem Hummelstall!« Der Angeredete beschäftigte sich eifrig mit seinem Notizbuch.
»Das mit der Peilung wissen Sie?« fragte er, ohne aufzublicken.
»Ja, UXP, Port Elizabeth! Leider die einzige Radiopeilangabe, die mir bis jetzt bekannt ist, sonst wüßte ich wenigstens, wo sich dieses Krötenschiff zur Zeit der Durchgabe des Rettungstelegramms befand. So bleibt nur ein langer Strich durch den Südteil des Indischen Ozeans.«
»Eigentlich recht weit ab von einem Kurs nach Singapore!« meinte der Flughafenkommandant.
»Na! So ‹ne Segelbark kann allerhand Zicken drehen!« brummte Aston.
»Und Schmugglerschiff, Opium, Heroin oder Waffen?«
»Pflegt gemeinhin keine Schiffbrüchigen aufzunehmen, am allerwenigsten aber zu funken!« war die sachliche Entgegnung Hyppos. »Eine solche Annahme aber ist meine letzte Hoffnung. Ich glaube, dieser Doktor Damm taucht eines Tages, in irgendeiner weltabgelegenen Gegend an Strand gesetzt, wieder auf.«
»Möglich«, sagte Cross und steckte das Notizbuch in die Tasche. In seinen Augen spiegelte sich deutlich, daß er noch einen Überraschungsschlag zum unmittelbaren Angriff vorbereitete. Oliver Aston sah es.
»Sagen Sie mal, lieber Hyppo«, hub er an, »haben Sie die Peilgerade, die UXP angegeben hat, gründlich auf eventuell auswertbare Ziele verfolgt?«
»Nö!« meinte Aston in gut geheucheltem Erstaunen.
»Daß der Kurs, den Doktor Damm nach Australien zu fliegen vorhatte, eben diese Peilgerade, ziemlich genau ein menschenleeres Felseneiland schneidet?« Cross beugte sich über den Tisch vor, seines Triumphes sicher, als ob er jetzt Chef der Kriminaldirektion und Oliver Aston der überführte Verbrecher wäre.
»Nun sagen Sie nur noch Daumeninsel und Doktor Sill, und ein neuer Weltsensations-Presseartikel ist fertig!« schnaubte Hyppo vor Vergnügen quietschend los, dabei bibberten die Fleischpartien des Gesichts und die Schultern vor kaum noch unterdrückbarem Gelächter.
Verblüfft fuhr Kommandant Cross zurück.
»Das wissen Sie?« war alles, was der maßlos Enttäuschte hervorbrachte.
Da lachte Hyppo, lachte, wie in längst verklungenen Sagen Zentauren einmal gelacht haben mochten. Ein brüllendes Gedröhn zwischen Wiehern und Hirschröhren brandete in den Raum.
Cross sah unwirsch drein. Jetzt war er doch diesem unförmigen Weinfaß aufgesessen.
»Nichts für ungut, lieber, guter Freund!« entschuldigte sich Aston bald gefaßt. »Sie sind aber schon Numero zwei, der mir diese Geschichte auftischt. Numero eins war ein alter pensionierter Funkoffizier, Olavson mit Namen. Vor drei Tagen beglückte er mich aufgeregt —. Um aber ganz sicher zu gehen, veranlaßte ich, daß ein Flugzeug Aufnahmen von der Felseninsel machte. — Augenblick! —.« Er wühlte in den Akten. — »Hier sind sie!« Mit diesen Worten legte er mehrere sehr klare Fotos seinem Gegenüber vor. »Können Sie da etwas Besonderes erkennen?« Cross musterte angelegentlich die Bilder. »Sieht so aus, wie ein kleiner Hafen — hier!« Er deutete mit dem Bleistift auf eine Stelle. »Und das mutet fast wie ein Weg rund um einen Teil des Felsens an.«
»Sehr richtig! — Kennen Sie auch die Geschichte der sogenannten Daumeninsel?«
»Ich kenne Olavson!« sagte Cross nur. »Aha! — Dann hätten wir zwei ja dieselbe Bezugsquelle, wenn —« Aston lehnte sich behaglich zurück — »wenn die Kriminalpolizei doch nicht ein wenig mehr wüßte. — Hat Ihnen Olavson von der Errettung dieses Doktor Sill von eben jener Insel erzählt?« Cross nickte zustimmend.
»Dann wissen Sie also auch, daß er in völlig zusammengebrochenem Zustand in ein hiesiges Krankenhaus eingeliefert wurde. Körperlicher und seelischer Verfall, schwere Delirien, kein Wunder, bei dem, was er durchmachen mußte. Nach sechs Wochen konnte man ihn entlassen.« »Habe ich gehört«, sagte Cross.
»Daß er nach Port Elisabeth reiste, ist Ihnen auch bekannt?« forschte Oliver Aston.
»Ja! Er wollte dort, laut Olavsons Angaben, dessen Onkel aufsuchen!«
»Hm! Stimmt! — Dieser alte Seebär hat eine etwas zweifelhafte Vergangenheit gehabt. Wir hätten davon wohl nie etwas erfahren, wenn nicht Reue den armen Sünder so geplagt hätte, daß er neben seinem Testament einen Brief an das Gericht in Port Elisabeth hinterließ. Darin berichtete er offen alle seine Vergehen, die ihm besagte Daumeninsel als Versteck ermöglicht hatte. Dieser Brief ist vielfach fotokopiert an alle in Frage kommenden Kriminalstellen weitergeleitet worden, um für die Zukunft einer Wiederholung solcher Gesetzesübertretung im Walfang vorzubeugen. So erhielt auch ich, damals noch Leiter des Überwachungsdienstes für ausländische Einwanderer, davon Kenntnis.
Die Angelegenheit wäre auch kaum in meiner Erinnerung haften geblieben, wenn mir nicht einige Wochen vor dem Eintreffen jenes Schiffbrüchigen eine amtliche Mitteilung aus USA. zugegangen wäre, in welcher ich ersucht wurde, den Chemiker Doktor Sill, gebürtig aus Mexiko, zu überwachen. Er hege umstürzlerische Pläne bezüglich künstlicher Ernährung der Menschen. Im Falle der Niederlassung oder irgendwelcher besonderer Vorkommnisse wurde um Bericht gebeten.
Sill ist von mir, das heißt von meinen Leuten, bis zu seiner Abreise überwacht worden, auch in Port Elisabeth. Nachdem er das Land verlassen hatte, gab ich, wie es im internationalen Fahndungsdienst üblich ist, nach Washington die Einzelheiten seines Unglückes, seiner Errettung, seines Krankenhausaufenthaltes, kurz, alle erforschten Tatsachen weiter.
Wenige Wochen später traf außer der rein geschäftsmäßigen Eingangsbestätigung meines Berichtes die Meldung ein, daß der Fall Sill als erledigt zu betrachten sei. Besagter Doktor Sill sei am soundsovielten in San Pantalone, so ähnlich hieß der Ort in Mexiko, im Hause seines Bruders verstorben, nachdem er sich in einem Anfall geistiger Umnachtung vom zweiten Stock auf den Hof gestürzt habe.
Etwa ein Jahr darauf besuchte mich im Zusammenhang mit einem groß angelegten Diamantenschmuggel ein amerikanischer Kollege, ein urgemütliches Huhn übrigens. Wir saßen auch außerdienstlich bei manchem Glase zusammen, und so erfuhr ich denn Einzelheiten über den Fall Sill, den er bearbeitet hatte. Dieser Sill wollte mit künstlicher Ernährung die Welt auf den Kopf stellen!«
»Daran erinnere ich mich noch!« unterbrach Cross lebhaft.
»Na gut! Dann kann ich mir die Wiedergabe dieser Utopien ersparen!« meinte Oliver Aston und fuhr fort: »Es muß wohl nicht alles Humbug gewesen sein, denn staatlicherseits wurden dem Erfinder für eine beträchtliche Summe sämtliche diesbezüglichen Patente abgekauft. Man traute Sill aber nicht so recht, und abgesehen davon, daß er überwacht wurde, schickte man meinen amerikanischen Kollegen, nach Eingang der telegrafischen Todesanzeige — das war im Vertrag so ausgemacht —, nach San Pantalone, offiziell als Vertreter der Regierung, der Familie das Beileid auszudrücken, inoffiziell jedoch, um sich zu vergewissern, daß es sich bei dem Toten tatsächlich auch um jenen Doktor Sill handelte. Wie gesagt, man traute dem famosen Weltumstürzler nicht!
Mit einem Spezialflugzeug traf der Beileidsüberbringer auch noch so rechtzeitig ein, daß er sowohl den Toten, den er zu Lebzeiten gut gekannt hatte, identifizieren, als auch durch Umfrage bei den Ortseinwohnern sämtliche Einzelheiten der letzten Lebenswochen des Geisteskranken, wie man ihn dort bezeichnete, in Erfahrung bringen konnte. Sogar für den selbstmörderischen Todessturz fanden sich zwei Zeugen. Es gab keine Zweifel mehr. Sill war tot!
Der Bruder des Verstorbenen erhielt von da an die vertraglich festgelegte sehr beträchtliche Jahresrente. Die Ursachen des Selbstmordes lagen wohl in der vollständigen Nervenzerrüttung. Das hatten schon hiesige Spezialisten, die Sill damals behandelten, in diversen Gutachten niedergelegt!«
Oliver Aston stützte einen Arm auf die Tischplatte und lehnte den Kopf gegen die Handfläche. »Die Theorie Olavsons, Doktor Damm auf der Felseninsel zu suchen, schießt also leider daneben!« sagte er nachdenklich. »Leider! — Denn sonst hätten wir wenigstens einen für die Nachsuche erfolgversprechenden Anhaltspunkt. Tote können nicht in Felsenhöhlen wohnen und Geologen stehlen. Abgesehen davon, wäre ein eventueller Bewohner dieser Insel, der im Verborgenen zu bleiben wünscht, ja auch nicht so hirnverbrannt, drahtlose Meldungen in den Raum zu funken, müßte er sich doch bei halbwegs klarem Verstand sagen, daß er angepeilt und damit entdeckt werden könnte. — Die Luftbilder hier beweisen überdies schlagend, daß die Insel sich noch genau in demselben Zustand befindet, wie der alte Seebär sie in seinem letzten Brief beschrieben hat, für menschliche Daueransiedlung völlig ungeeignet!«
— Hyppo schwieg schwermütig, schüttelte den aufgestützten Kopf: »Der Fall Damm ist der mysteriöseste, der mir je in die Hände kam!«
»Das Verrückteste von allem ist und bleibt die Funkmeldung der angeblichen Bark ›Bengalia‹!« sagte Cross.
»Kann man wohl behaupten!« knurrte der Kriminalchef. »Wer funkt ohne ehrliche Absichten, daß er einen Notgelandeten aufgefischt habe, und gibt dann einen falschen Schiffsnamen an? Die Katze beißt sich bei diesem logischen Kringelspiel dauernd in den Schwanz! — So, mein lieber Cross. Ist Ihr Wissensdurst gestillt und sind Sie von Ihrem kriminellen Scharfsinn geheilt?« Vergnüglich zwinkerte Hyppo seinem Gegenüber zu.
»Gründlich!« erwiderte Cross resigniert.
»Dann schlage ich vor, wir nehmen gemeinsam einen anständigen Lunch zu uns. — Oder haben Sie Dienstverpflichtungen?«
»Keine, die mich von diesem Vergnügen abhalten könnten! — Gehen wir in den Klub?«
»Mir recht! Da ist es um diese Zeit ruhig!«
Die Männer erhoben sich und verließen den Raum.
Martin Damm stand kurz vor Übergang von den Quarantäneräumen in den Felsendom. Sill hatte ihm am Abend vorher mitgeteilt, um zehn Uhr werde sich das steinerne Tor zur Linken der Fernseheinrichtung öffnen. Er solle nur die Peilsonde und ihr Zubehör mitnehmen, im übrigen alle weiteren Dinge, auch seine Bekleidungsstücke, zurücklassen, also im Adamskostüm diesen Weg antreten. Die Felsentür schließe sich automatisch hinter ihm. Er betrete dann eine Art Schleuse, zu deren rechter Hand sich ein kleiner Aufzug befinde, in welchem er die Peilsonde unterbringen möge. Bevor sich die zweite Türe, also der Ausgang der Schleuse, öffne, währe es eine kleine Weile, bis der erforderliche Luftaustausch vollzogen sei.
Es erwarte ihn in dem darauffolgenden Raum ein Spezialreinigungsbad, von dem er bitte ausgiebig Gebrauch machen möge, besonders was das Kopfhaar anbetreffe. Sein Anzug und Wäsche lägen schon dort, sozusagen ihren Herrn erwartend.
Martin Damm war den Anweisungen pünktlich nachgekommen, hatte aber noch genügend Zeit gefunden, die Felsentür einer eingehenden Musterung zu unterziehen. Er war erstaunt, wie genau der leicht konische Gesteinsrahmen der Tür und diese selbst gearbeitet waren. Ein dünner Belag, aus einem gummiähnlichen Kunststoff bestehend, bewirkte eine als hermetisch zu bezeichnende Abdichtung, die einen Luftdurchlaß völlig unmöglich machte. Alles in allem betrachtet, eine Steinmetzleistung erster Ordnung.
In der Muße des Bades hatte er anfangs die Gedanken, wie und mit welchen Hilfskräften Doktor Sill diese geradezu unwahrscheinlich anmutenden Leistungen vollbracht haben mochte, weitergesponnen. Doch er durfte sich nicht verlieren. Es galt, den zweiten Schritt in das neue Reich zu tun. Er seifte, schrubbte, duschte und trocknete sich schnell ab und eilte, seine neuen Kleider anzulegen.
Eine nervöse Befangenheit überkam ihn, als er sich vor dem Spiegel das Haar kämmte und sich plötzlich bewußt wurde, daß ihn nur noch wenige Augenblicke von dem leibhaftigen Herrn dieses Eilands, diesem widerspruchsvollen, eigenwilligen Tatmenschen, den er vierzehn Tage lang allein auf dem Bildschrein erblickt hatte, trennten.
Er raffte sich zusammen, schob noch einmal zögernd den Knoten der Krawatte im Kragen zurecht.
Fertig!
Da drückte er kurz entschlossen die Klinke einer Aluminiumtür nieder und spähte erstaunt in einen leeren, hell erleuchteten Gang mit glatten, nicht unterbrochenen Wänden.
Von Sill war nichts zu erblicken, und Damm atmete erleichtert auf. Denn dieser Zeitgewinn vor dem lange im Geiste ausgemalten Augenblick des Zusammentreffens wirkte entschieden beruhigend, wenn er die Begegnung auch nur aufschob.
Martin Damm betrat den Gang.
Wohin jetzt?
Geradeaus zunächst einmal, zur einzigen sichtbaren Ausgangstür, das Weitere mußte sich finden. Dumpf hallten die Schritte.
»Hier bitte, mein lieber Damm!«
Verblüfft fuhr der Angeredete zusammen. Neben ihm im Rahmen einer wie von Zauberhänden geräuschlos aufgerissenen Öffnung stand Sill und lachte ihm beglückt zu.
»Treten Sie näher! — Laufen Sie immer an offenen Türen vorbei?«
Damm verschlug die unerwartete Begegnung die Sprache, aber auch Sill mußten Empfindungen angespannter Überraschung bewegen. Die beiden Männer musterten sich einige Pulsschläge lang, ohne ein Wort zu sprechen: Der Eindruck, den sie aufeinander machten, war von dem, den der Bildschrein vermittelt hatte, zu verschieden.
Sills Erscheinung war groß und schlank in Schultern und Hüften. Der Kopf wirkte schmal und lang unter dem strähnigen, ebenholzschwarzen Haar. Die Hautfarbe des Gesichtes, das von einem Paar dunkler, brennender, großer Augen beherrscht wurde, war leicht gelblich. Unter den leicht geöffneten dünnen Lippen gleißten in makellosem Weiß zwei Reihen prachtvoller Zähne.
Damm dagegen war groß und breit. Über einer ausladenden hohen Stirn türmte sich ein glatt nach hinten gezwungener Wust blonden Haares. In den klaren blauen Augen hing Staunen und mit Zutraulichkeit gepaartes Abwägen.
Doktor Sill war der erste, der sich wieder faßte. Beseligt ergriff er die Hand Damms und schüttelte sie derb mit unerwarteter Kraft, mit der Linken schlug er ihm auf die Schulter und zog ihn in ehrlicher Freude in das Zimmer.
»Nun noch einmal herzlich, allerherzlichst willkommen, mein lieber Damm!«
»Ich danke Ihnen ebenso herzlich für Ihre so freundliche Aufnahme hier!« erwiderte Martin Damm. Die Worte tönten sehr warm, doch wäre einem aufmerksamen Zuhörer die leichte Zurückhaltung gewiß nicht entgangen, die einer Befangenheit entspringen mochte.
Doch schon überwand der formgewandte Gastgeber die bedrohliche Unsicherheit des Augenblicks mit feiner Witterung.
»Habe ich Sie etwa wiederum durch mein geisterhaftes Erscheinen erschreckt? — Sie wissen doch, ich bevorzuge nun einmal——«
»Das Überraschungsmoment!« fiel Martin Damm ihm ins Wort.
»Sehr richtig!« lachte Sill und ließ die Hand von der Schulter Damms fallen. »Darf ich bitten!« Er wies auf einen Sessel neben einem runden Tisch der Zimmernische, über die eine Stehlampe ihr ruhiges, anheimelndes Licht ergoß, dann nahmen beide Platz.
»Nun habe ich Sie endlich in meinen vier Wänden!« begann Sill, ein Bein über das andere schlagend und sich tief zurücklehnend. Die langen Finger trommelten nervös leise auf die braunen rundlichen Lehnen. »Wenn ich ehrlich sein darf, habe ich mir doch ein ganz anderes Bild von Ihnen gemacht. Man sieht, selbst die beste Fernsehapparatur kann nicht den Augenschein ersetzen.« -.-.-
Ein Lächeln ehrlicher Anerkennung verschönte das herbe Gesicht. »Erging es Ihnen etwa ebenso?« Mit Lebhaftigkeit schnellte Sill vor.
»Das kann ich getrost behaupten!« entgegnete Martin Damm heiter. »Wenn zwei Riesen wie wir plötzlich in einer eben noch türlosen Wand zusammentreffen, dann gibt es halt einen seelischen——« er schien nach dem passenden Wort zu suchen, »Knalleffekt!« beschloß er rasch den Satz.
»Knalleffekt in der türlosen Wand! — Wäre bestimmt ein herrlicher Filmtitel!« Wieder lachte Sill, doch diesmal so jungenhaft übermütig, daß der Bann, der über beiden noch lastete, zerstob. »Sie interessiert natürlich das Mysterium der geheimnisvollen Tür über alles? — Oder nicht?«
»Aber gewiß!« entfuhr es Damm, der sofort bereute, daß seine Neugier die gute Kinderstube überrumpelt hatte. »Verzeihen Sie«, wollte er, sich entschuldigend, fortfahren, »daß——.«
»Nein, nein — nein!« lachte jetzt zum dritten Male Sill laut auf. »Sie wissen ja! — Kein Theater unter Männern! — Für Sie soll es hier keine Geheimnisse geben!« Schon war er aufgesprungen und eilte mit kurzen, schnellen Schritten zu der mit senkrechten Schmuckleisten unterteilten Wand. Er drückte auf einen in der Täfelung erkennbaren Knopf und.....
SSrrr——!
Lautlos schoben sich zwei Hälften der Umrahmung auseinander.
Martin Damm starrte auf den hell erleuchteten Gang.
Wenige Sekunden später schloß sich die Tür genau so zauberhaft. Die Zimmerwand, makellos in ihrer Glätte, umschloß wieder den Raum.
»Zufrieden?« Sill ließ sich in den Sessel fallen. Stolz sprühte aus den dunklen Augen.
»Allerhand!« sagte Damm sichtlich beeindruckt. »Sie scheinen eine besondere technische Begabung für hermetisch abdichtende Felsentore, Luken mit Garderobenhaken und automatische — früher sagte man — Tapetentüren zu besitzen!«
»O weh! — Jetzt reibt man mir die verschwundene Jacke unter die Nase!« Betrübt schaute Sill drein, doch der Schelm blitzte aus den Augenwinkeln. Doktor Damm empfand gar nicht, wie ungemein geschickt er von weiteren Fragen, die dieses Gebiet betrafen, abgelenkt wurde, freute sich nur, daß er mit diesem kleinen Seitenhieb Sill die kleine Ungehörigkeit heimzahlen konnte.
»Ist ja längst verjährt!« meinte er darum befriedigt.
»Allen Heiligen sei Dank!« erwiderte mit gut gespielter Sündermiene Sill, im nächsten Augenblick schlug die Stimmung schon wieder in südländische Lebhaftigkeit um.
»Wissen Sie was! — Ich zeige Ihnen jetzt erst einmal Ihren Aufenthaltsraum. — Dann müssen Sie etwas frühstücken! -Das Desinfektionsbad strengt an. — Bis halb zwei hatte ich vor, mit Ihnen Probleme, die Ihr Arbeitsgebiet betreffen, zu besprechen. Nach dem Mittagessen, bei dem Sie meine Sekretärin, übrigens eine Landsmännin von Ihnen und ebenfalls Physikerin, kennenlernen werden, sollen Sie sich in Muße mein Werk ansehen. Wir speisen abends wieder gemeinsam und haben dann wohl noch Zeit für ein gemütliches Zusammensein. — Sind Ihnen die Vorschläge angenehm?«
»Aber selbstverständlich!« entgegnete Martin Damm und stand auf. Auch Sill erhob sich.
»Hier bitte! — Diese Tür!«
Er schritt voran und drückte die Klinke nieder. Ein sehr gemütliches Wohngemach lag vor seinen musternden Blicken.
Ein großer, ausladender Arbeitstisch, eine breite Couch, die zweifellos in ein herrliches Bett umzuwandeln war, einige Sessel, eine Wascheinrichtung in der Ecke, so formten sich die ersten Eindrücke. Die gesamte Aufmachung kam der eines modernen, komfortablen Hotels gleich, mutete aber viel persönlicher und geschmackvoller an.
»Ich weiß nicht, ob Sie die Sitten meiner mexikanischen Heimat kennen!« begann Sill. »Dem verehrten Gast gebührt bei uns, kann man ihm nicht, wie auf einer Hazienda, ein eigenes Gästehaus zur Verfügung stellen, der Ehrenraum, wenn ich mich so ausdrücken darf, neben dem des Hausherrn.«
Sill neigte das Haupt und schwieg, den Blick auf den Boden geheftet. Der Offenbarung seiner tiefsten Gefühle sollte keiner aus seinen Mienen teilhaftig werden.
»Ich danke Ihnen!« sagte Martin Damm schlicht und ergriff die Hand jenes Menschen, dem er, das verspürte er immer stärker, manches in Gedanken abzubitten hatte.
Doktor Sill hob den Kopf, als er den Händedruck erwiderte. Über seinen Zügen lag ein stiller, froher Glanz der Genugtuung, ja, der Widerschein einer grenzenlosen Glücklichkeit.
»Unser Bad ist allerdings gemeinsam!« hub er entschuldigend an. »Dort ist der Knopf zu der Schiebetür, die auf den Ihnen bekannten Gang führt und dann links zum Baderaum, den Sie ja auch kennen.« Er wies auf die Betätigungsvorrichtung. »Wenn Sie zurückkehren, brauchen Sie draußen nur laut und vernehmlich ›Damm‹ zu sagen. Auf dieses akustische Signal öffnet sich die Zauberpforte!«
Verblüfft schaute Doktor Damm den Sprecher an.
»Ich hatte manchmal keine rechte Arbeit für meine Feinmechaniker, und da haben wir uns mit solchen physikalischen Spielereien die Zeit vertrieben. — Bitte versuchen Sie doch mal, ob die Einrichtung klappt! — Ich möchte mich selbst vergewissern!«
Doktor Damm ging auf den Knopf zu, seltsame Gedanken bewegten ihn. Er drückte den runden Metallstift nieder. Die Schiebetür tat sich geräuschlos auseinander und — schloß sich genau so hinter ihm.
Nach kurzem Verweilen, während dessen eine Flut von Vorstellungen ihn verwirrte, rief er laut seinen Namen.
Die Wand schob sich sofort, dem Zauberspruch folgend, auseinander. Als er sein Zimmer betrat, stand Sill lächelnd in der entferntesten Ecke, offensichtlich um darzutun, daß er keinesfalls von innen den Knopf berührt hatte.
»Großartig!« sprudelte er begeistert los.
»Ihre Anerkennung freut mich aufrichtig!« antwortete Sill. — »Doch kommen Sie, Ihr Frühstück wartet!«
Die beiden betraten den anstoßenden Raum.
Während sie mit gutem Appetit den schmackhaften Speisen zusprachen, begann Sill die bald in Angriff zu nehmenden Arbeiten darzustellen.
Martin Damm hörte aufmerksam zu.
Als das Mahl beendet war, klatschte Sill in die Hände. Ein Diener erschien, verbeugte sich mit höflichem, doch keinesfalls untertänigem Gruß vor dem Fremden und räumte ab.
Unaufgefordert kehrte er kurz darauf mit einem Tablett zurück, setzte zwei Gläser, Untersätze und eine Flasche zurecht und drehte sie mit flinker Bewegung so, daß der Gast das Etikett lesen konnte. ›Alter Portwein‹ — ›P112‹.
»Darf ich Ihnen Herrn Anton Peters, kurz Anton genannt, vorstellen?« sagte Sill sich erhebend. »Er wird Sie, Herr Doktor Damm, von heute an genau so gewissenhaft betreuen, wie er mich seit Jahren schon versorgt!«
Martin Damm, der gleichfalls aufgestanden war, reichte Peters die Hand.
»Sie sind Deutscher, Herr Peters?« Eine Frage höflicher Anteilnahme.
»Gewiß, Herr Doktor!« lautete die Antwort.
»Es ist gut, Anton!« sagte Sill kurz.
Der Diener entfernte sich, während Damm dem Gedanken nachhing, welch auffallend kameradschaftlicher Geist hier zu herrschen schien.
»Was mich also beunruhigt«, schloß Sill seine Ausführungen, »sind diese gelegentlichen Erdbebenstöße. Ich trage die Verantwortung für rund eintausend Menschenleben, die mir ihr Schicksal anvertraut haben, und darum möchte ich gern wissen, lieber Damm, ob diesem Felseneiland durch irgendwelche tektonischen Verschiebungen in der Erdkruste eine ernste Gefahr droht. In unserer abendlichen Fernsehunterhaltung habe ich ja schon manche diesbezügliche Andeutung fallen lassen, jetzt aber haben Sie einen Gesamtüberblick über die Beobachtungen, die zu meinen Mutmaßungen geführt haben. Sollten Ihre Peilungen zu dem Ergebnis führen, daß die Insel nicht völlig ungefährlich ist, dann muß ich die — allerdings sehr harten — Konsequenzen ziehen, das heißt wir müssen das Eiland räumen. Irgendwelche Verwicklung mit meinen Vertragspartnern brauche ich nicht zu fürchten. Ich habe mein Abkommen eingehalten. Niemand hat mich hier aufgespürt und keine, wie auch geartete, Erschütterung des Weltwirtschaftssystems strahlte von meinen hiesigen Versuchen aus. Mögen meine, in ihre Heimat zurückgekehrten, Mitarbeiter getrost von den wunderlichen Experimenten erzählen. Das Geheimnis bliebe, denn nur ich kenne die erprobten Zusammensetzungen der künstlichen Ernährung, ich allein habe die vollautomatische Fabrikation in Gang gebracht und überwache sie.«
Es folgte eine Pause nachdenklichen Schweigens, Sill starrte zu Boden. Plötzlich hob er den Kopf.
»Sie, Damm, könnten einwenden, daß bei Ihrer baldigen Rückkehr in die sogenannte zivilisierte Welt nur Ihre Verschwiegenheit mich vor Störungen schützen könnte! — Etwas Derartiges ging Ihnen ja wohl eben durch den Kopf, nicht wahr?«
Martin Damm nickte. Er hatte sich schon lange daran gewöhnt, daß Sill ein Psychologe von außergewöhnlichem Format war und diese seine Kunst bereits der des Gedankenlesens gleichkam. Im Unterbewußtsein beschäftigte er sich außerdem mit der Frage, ob Sill seinem Vertrag mit der Regierung eine vielleicht juristisch anfechtbare Auslegung gab. Solche Überlegungen drangen jedoch nicht so weit vor, daß er schon ein Resultat hätte finden können, zumal Sill bereits wieder erläuterte:
»Sehen Sie, lieber Damm ———. Ich suche mir meine Leute aus. Mein Vorhaben, die Insel geologisch gründlich durchforschen zu lassen, besteht seit etwa einem Vierteljahr. Für diese Arbeit kamen natürlich nur wenige Spezialisten in Frage. Daß Sie dazu gehörten, brauche ich nicht noch besonders zu erwähnen. Entscheidend war jedoch folgendes: Sie hatten mehrere geologische Tiefenpeilungen gemacht, die ohne Zweifel von internationalem Interesse gewesen waren.« Ein vielsagendes Lächeln umspielte die schmalen Lippen. »Ich könnte mir sogar vorstellen, daß gegnerische Finanzgruppen gerne bereit gewesen wären, ein kleines Vermögen zu opfern, um zu wissen, was in den Berichten an Ihre Auftraggeber niedergelegt war. Aber Herr Dr. Dr. Damm war unzugänglich und verschwiegen wie ein Grab.«
Sill hob sein Portweinglas, zwinkerte bedeutungsvoll und sagte nur: »Ihr ganz Spezielles!« Er nahm einen kleinen Schluck und betrachtete, den Kristallkelch gegen die Lampe anhebend, das funkelnde Farbenspiel der Lichtbrechungen in dem Schliffmuster.
»Als ich diese Tatsachen in Erfahrung gebracht hatte, stand mein Entschluß fest. — Daß Sie allerdings so liebenswürdig sein könnten, mich zeitraubender Vorverhandlungen durch meine bereits beauftragten Mittelsmänner zu entheben und hier wie der deus ex machina notzulanden, das hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht aussinnen können!«
Er setzte das Glas auf den Untersatz.
»Daß Sie schweigen können, wußte ich. Daß Sie schweigen werden, weiß ich jetzt um so mehr, als ich Sie persönlich kenne. — Vor Ihrer Abreise von hier, ich schätze in etwa vier Wochen, müssen wir uns nur noch gemeinsam ein Märchen ausdenken, welches etwa Allzuneugierigen eine hinlängliche Erklärung für Ihr scheinbares Verschwinden gibt. In zwei Jahren dürfen Sie dann über Ihre hiesigen Erlebnisse reden, soviel Sie wollen, denn zu diesem Zeitpunkt beabsichtige ich, die Kolonie aufzulösen und meinen Vertragspartnern — selbstverständlich gegen entsprechendes Honorar — die Ergebnisse aller Versuche zur beliebigen Verwertung zur Verfügung zu stellen. — Und man wird sie verwenden, verwenden müssen, denn die Ernährungsdecke der Menschheit wird immer knapper. — Langsam wird man die künstliche Ernährung zwischen die natürliche schieben, zunächst nur als Kalorienzusatz. — Und dann« — eine wegwerfende Handbewegung — »welcher Chemietrust widersteht auf die Dauer der Lockung, aus« — er machte eine kurze Pause. — »Dreck Geld zu machen?« Sill wurde sehr lebhaft. — »Damm, es gibt Umwälzungen in der Gestaltung des Menschengeschickes, die förmlich in der Luft hängen, die nur der Hand bedürfen, die sie ergreift und —«, ein ärgerliches Kopf wenden:
»Ja!«
Anton Peters erschien im Türrahmen. Sein Klopfen hatte Martin Damm im Banne der Ausführungen dieses feuerköpfigen Revolutionärs überhört.
»Herr Doktor! — Das Essen ist angerichtet!«
»Danke, Anton! — Wir kommen. — Also, mein lieber Damm!« Ein Blick auf die Armbanduhr. »Tatsächlich, es ist bereits halb zwei! — Schade. — Nun, wir werden ja noch öfter Gelegenheit zu einer Aussprache haben!« — Er machte eine einladende Geste, der nachzukommen Damm nicht gleich in der Lage war. Versunken starrte er in das Licht der Stehlampe. Dann sprang er rasch auf, knöpfte, die Schultern dehnend, seinen Rock zu. Die Augen der beiden Männer trafen sich, und aus den Blicken sprach gegenseitige Achtung, vielleicht mehr noch kameradschaftliche Zuneigung.
»Darf ich bitten?«
Der Hausherr ließ dem Gast mit einer leichten Verbeugung den Vortritt. Sie betraten den Nebenraum.
»Fräulein Verweer, meine Sekretärin!«
Die Hände auf die Stuhllehne gestützt, verharrte eine Frau, deren Antlitz den Eintretenden zugewandt war. Mit beherrschter, fast zu langsamer Bewegung hob sie die Rechte und bot sie dem Gast dar.
»Herzlich willkommen in unserem kleinen Kreise, Herr Doktor Damm!« Eine klingende Altstimme sprach die Worte werbend und kühl zugleich, mit jener gewinnenden Unnahbarkeit, die vielen Engländern eigen ist.
Martin Damm umfaßte die Hand. Der Druck seiner Finger wurde wie eine Andeutung erwidert.
»Ich danke Ihnen für die liebenswürdige Begrüßung, Fräulein Verweer!« Ihn erbitterte die Befangenheit, deren er sich zu gut bewußt war. Ein Ärger gegen Sill stieg hoch. Diese ständige Überrumpelei entzog ihm dieses Mal die gesellschaftliche Sicherheit.
Doktor Sill hatte seinen Stuhl erreicht. Fräulein Verweer zog den ihren unter dem nicht zu großen, quadratischen Tisch hervor und nahm Platz. Erst, als sie saß, folgten Sill und der Gast ihrem Beispiel.
»Sie haben die langweilige Quarantäne gut überstanden, wie ich mit Freuden feststelle, Herr Doktor Damm!«
»Es war gar nicht langweilig!« erwiderte Damm lebhaft. »Ich hatte Arbeit in Fülle!« Erleichterung überkam ihn, daß eine ungezwungene Unterhaltung in Gang kam.
»Sie basteln wohl gerne?« Sie dankte, kurz aufschauend, dem Diener Anton für die mit einer dampfenden Flüssigkeit vorgesetzte Tasse, ergriff lässig einen Teelöffel und rührte.
»Das bringt schließlich mein Beruf mit sich!« entgegnete Damm jetzt schon freier. »Die Versuchsbedingungen sind meist sehr verschieden, so daß ich häufig gezwungen bin, Schaltungsänderungen an meiner Peilsonde vorzunehmen!«
»Guten Appetit, Jose!« Die Fingerspitzen Fräulein Verweers berührten mit einer kosenden Gebärde die auf dem Tisch ruhende Hand des Hausherrn.
»Danke dir, Gisela, desgleichen!«
Dann führte Sill die Tasse zum Munde und trank hastig.
Martin Damm versuchte es ihm gleichzutun, doch war die Flüssigkeit seinen Lippen zu heiß. Er zögerte.
»Lassen Sie sich nicht durch das Beispiel Joses verleiten!« lächelte Gisela Verweer. »Er kann unglaublich heiß trinken!«
»Bitte tun Sie, als ob Sie hier zu Hause wären«, rief, wie um sich zu entschuldigen, Doktor Sill. »Ich pflege sehr rasch zu essen. — Unhöfliche Angewohnheit von mir. — Kann aber nicht davon lassen! — Anton!«
Sill wählte von der dargebotenen Platte kurz mehrere dem Röstbrot ähnliche Scheiben, teilte eine mit der Gabel und aß.
Gisela Verweer rührte gelassen in ihrer Tasse.
So kam es, daß der Hausherr schweigend sein Mahl bereits beendet hatte, als seine beiden Tischgenossen in immer reger werdender Unterhaltung noch langsam Bissen auf Bissen zum Munde führten.
»Wie ich sehe, verstehen Sie sich ganz gut mit Fräulein Verweer, lieber Damm!« sagte Sill, sich im Stuhl zurücklehnend, »das freut mich um so mehr, als ich vorhatte«, seine Fingerspitzen trommelten nervös gegeneinander, während er offensichtlich befriedigt lächelte, »Ihnen diese Dame« — eine graziöse Handbewegung — »als Ihre Assistentin zur Verfügung zu stellen. Fräulein Verweer ist Physikerin. Allein werden Sie, wie Sie mir sagten, schlecht mit dem Gerät fertig. Körperliche Anstrengungen sind ja nicht erforderlich, wohl aber geistige, und ich lege Wert darauf, daß Sie von meiner besten Fachkraft, und das ist nun einmal Fräulein Verweer«, er streichelte einige Male fast zärtlich ihre schmale, wohlgepflegte Hand, »unterstützt werden. Den Tagesplan dachte ich mir so: Fräulein Verweer wird Ihnen heute nachmittag und morgen das gesamte Werk zeigen. Leider kann ich es wegen Überlastung nicht selbst tun.
Das Abendessen führt uns jedoch wieder zusammen. Übermorgen ist Sonntag, da ist dann natürlich dienstfrei.
Montag früh beginnen Sie mit den ersten Probelotungen. Versuche natürlich nur! — Dabei wird sich bald herausstellen, ob der elektrische Teil einwandfrei arbeitet. Sollte tatsächlich alles klappen, so richten Sie sich Ihre Arbeit nach eigenem Ermessen ein. Nur würde es mich freuen, wenn wir in Zukunft das Abendessen gemeinsam zu uns nähmen. — Ist es Ihnen recht so?«
»Selbstverständlich!« entgegnete Doktor Martin Damm.
»Also abgemacht! — Anton! — Drei Kognaks!«
Der Diener schien die Gewohnheiten seines Herrn zu kennen. Er brachte sofort ein Tablett und verteilte die Gläser.
»Dann wollen wir diesen Schluck auf erfolgreiche Arbeit trinken!« forderte Sill seine Tischgenossen auf.
Drei Gläser klangen zusammen. Der Nachhall verwehte zitternd in dem anheimelnden Zimmer tief unter der Kuppe des Felsendomes.
Neben Gisela Verweer, die Hände auf die schimmernde Aluminiumbrüstung gestützt, stand Martin Damm. In ihm wogten die widerstreitendsten Gefühle.
Vor wenigen Minuten hatten sie beide den Speiseraum verlassen, rasch in ihren Zimmern den Arbeitskittel übergezogen und sich in dem langen Verbindungsgang wiedergetroffen. Damm war es nicht entgangen, daß die Augen der Sekretärin, der Geliebten Sills, oder was sie sonst sein mochte, ihn prüfend beobachteten, als sie die Abschlußtüre öffnete und gleichzeitig mit ihm den galerieartigen Vorbau betrat, der die Sicht freigab.
Zunächst gewahrte der Staunende nur die strahlende Helle eines riesenhaften Steingewölbes, und dann sah er — das einzäunende silberglänzende Geländer unmittelbar vor sich — hinab!
Tief unten breitete sich, wie eine Liliputstadt, die große Siedlung aus, Haus neben Haus, kleine Villen, voneinander getrennt durch gartenähnliche Einfriedungen. Straßen, alle parallel zueinander, durch Querwege verbunden, liefen dunkelglänzend wie Asphalt durch die Ortschaft.
Fabrikartige, höhere Gebäude säumten den Teil unmittelbar unter ihm, Sportplätze begrenzten den jenseitigen. Das fast kreisförmige ebene Rund endete überall an den lotrecht ansteigenden Felsenwänden, und dieses Felsenrund stieg, stieg, höher und höher, sich mehr und mehr verengend, einer in ihren Ausmaßen unfaßbar großen Glocke gleich, deren Helligkeit zunahm, je mehr sich das entdeckende Schauen hinauftastete, und schließlich schlossen sich die Augen, in gewaltiger Höhe von einer übermächtig strahlenden Sonne geblendet.
Aufs neue sprangen die suchenden Blicke hinab auf die Stadt unter dem Felsendom. Menschen bewegten sich auf den Straßen, von hier oben Zwergen gleich. Dumpfes, gedämpftes Brausen erscholl aus den fabrikartigen Werkanlagen.
Die Flut von Licht zeichnete kaum wahrnehmbare Kontraste, zu senkrecht überstrahlte die Riesensonne das friedliche Bild.
Ein Frösteln überlief Martin Damm. Der jetzt endlich erlebte Eindruck übertraf alles, was seine Vorstellungskraft ihm eingegeben hatte.
Die Wirklichkeit schuf Schaudern, preßte den ringenden Atem, verriet sich in den harten Pulsschlägen des rascher klopfenden Herzens.
Menschen im Felsengrab!
Was hatte dieser Sill da geschaffen?
Überwältigend, maßlos, erschütternd in der Tat!
Tausend Menschen lebten dort unten!
Niemand weiß davon, niemand ahnt es!
Tausend Menschen, Objekte eines einzigen Experiments!
Aus dem Willen eines einzigen geboren!
Ein Schaltergriff! — Die Sonne würde verlöschen.
Ein Schaltergriff! — Die Menschen müßten ersticken.
Ein Schaltergriff! — Die Ernährungsquelle würde versiegen.
Tausend von Einem abhängig, und dieser Eine dem letzten Schicksal jederzeit unterworfen: dem Tode!
Jener Eine, der hier unbeschränkt herrschte!
Schön war das Bild zu seinen Füßen. Friedlich und makellos die verschlossene Stadt, entrückt der ewig lauten Geschäftshast einer in ständigem Aufruhr jagenden Außenwelt, in glückhafter Ruhe und Selbstseligkeit. Hell, klar gerade und sauber, die Stadt im Felsendom.
Das Werk eines Mannes!
Doch lastete hier nicht zu viel auf den Schultern dieses Mannes?
Wo waren die Mitarbeiter, die einspringen konnten?
Wer war das Mädchen an seiner Seite?
Sekretärin ... Physikerin ... und ...
Seine erregten Sinne sträubten sich, sahen im Geiste die schlanke Gestalt mit den langen schlaksigen Bewegungen, die ruhigen, wachen Augen. — Seine Mitarbeiterin — Aufpasserin? Oder zögerte Sill etwa, gerade jene, die ihm unzweifelhaft am nächsten stand, ihm zuzugesellen?
Martin Damm wurde sich der Unhöflichkeit seines beharrlichen Schweigens bewußt.
Er senkte den Kopf.
Gisela Verweer schaute gleichgültig in die Tiefe, fühlte die auf ihr haftenden Augen, blickte ihn spöttisch an.
»Hätte Ihnen soviel Nachdenklichkeit gar nicht zugetraut!
- Nach Ihrem Äußeren zu urteilen, hielt ich Sie gefeit gegen — Gefühlsduseleien.«
Der beherrschte Ausdruck des Gesichtes unterlag nicht den geringsten Schwankungen, auch als sie betont zögernd das letzte Wort aussprach.
»Wie kommen Sie gerade darauf?« wollte Damm wissen, Gereiztheit schwang aus der Stimme.
»Wenn Sie als Physiker die Geheimnisse unserer Kunstsonne ergründen wollten, hätten Sie wohl schwerlich, bei der dazu immerhin notwendigen Betrachtung, die Augen geschlossen! — Und der Seufzer aus tiefster Brust! Ich will Sie nicht mit solchen Feststellungen verletzen, aber die Folgerungen liegen nahe!«
Seltsam forschende Augen hat dieses Mädchen, dachte Martin Damm. Er wollte wissen, warum sie mit der herausfordernden Behauptung in ihn drang.
»Den Tatbestand zugegeben! — Damit——«
»Damit — auch die Gefühlsduselei!« unterbrach ihn Gisela Verweer, sich ihm voll zuwendend.
»Nehmen Sie bitte eine Lehre von mir an! — Gefühle passen nun einmal nicht in diese irreale Welt weltumstürzender Experimente, und wenn Sie sich hier durchsetzen wollen, dann lassen Sie Ihre Mienen nie Ihr Inneres offenbaren. Denken Sie an den Felsen, der uns umgibt. Er ist undurchsichtig, kalt und hart! — Ich sehe, unser Aufzug naht! — Kommen Sie bitte, Herr Doktor!«
Sie wandte sich ab und schritt den galerieartigen Gang entlang. Martin Damm folgte bestürzt.
War das eine Warnung gewesen? Eine Warnung aus dem Munde seiner Aufpasserin, oder — nur eine überhebliche Kritik an seiner stummen Saumseligkeit, gekränkter Stolz der — Geliebten, daß kein Wort staunenden Lobes über das Werk ihres Meisters seinen Lippen entfahren war?
Die Aufzugtür öffnete sich, der Führer grüßte höflich, als das Paar eintrat. Ein Rasseln. Das Verschlußgitter schob sich zu. Der Aufzug glitt mit zunehmender Schnelligkeit in die Tiefe.
Beide schwiegen. Martin Damm musterte gründlich die technischen Einrichtungen dieses Fahrstuhls. Modernste Bauart, stellte er bald fest, wie alles, was er bis jetzt hier gesehen hatte.
»Wie groß ist die Höhe von der Galerie oben bis zum Grund?« fragte er nur, um das Gespräch wieder aufzunehmen.
»Einhundertdreißig Meter!« entgegnete Gisela Verweer.
Damm sah die Häuser immer näher kommen.
»Was mich am meisten verblüfft, ist, wie man das alles bewerkstelligen konnte, wie man die Unmenge Material herschaffen, den Aufbau, kurz den gesamten Betrieb hier in Schwung brachte, bevor die Besiedlung erfolgte!« wandte er sich erneut an seine Begleiterin.
»Das hat Jahre gedauert!« schaltete sich ungezwungen der Fahrstuhlführer ein. »Ich war einer der ersten, die herkamen. Oft lief damals noch unser Dampfer hier ein und brachte jedesmal eine Unmenge Kisten, Träger, Balken, Schienen, Bleche, kurzum das ganze Zeug, welches wir benötigten, wir paar Facharbeiter und die Ingenieure. Wir hatten tüchtig zu tun. Und erst als alles fertig war, ließ Herr Doktor Sill die Siedler kommen. Waren damals noch andere Zeiten! Nicht so friedlich wie jetzt. Aber Spaß hat's gemacht!«
»Und jetzt nicht?« Unversehens war die Frage Martin Damm entglitten.
»Oh! — Doch! — Wenn man älter wird, ist man zufrieden in seiner gesicherten Stellung mit Frau und Kindern!«
»Da wollen Sie wohl gar nicht mehr von hier fort?«
»Ich mich von Doktor Sill und seinem Werk trennen? — Da müßte ich ja von allen guten Geistern verlassen sein, Herr Doktor Damm. Verzeihung, so heißen Sie doch? Wurde heute morgen im Rundfunk durchgegeben, daß Sie uns besuchen würden!«
Martin Damm nickte.
»Freut mich, daß es Ihnen hier so gefällt. Die Einrichtungen sind ja auch geradezu ideal!«
»Das kann man wohl sagen!« schmunzelte der Aufzugführer und öffnete das Gatter. »Viel Vergnügen zur Besichtigung!« rief er lachend dem hinaustretenden Gast nach.
Damm schritt an der Seite seiner Führerin.
»Hätte ich nicht fragen sollen?« Ihr Schweigen beunruhigte ihn.
»Um Gottes willen, warum nicht! — Da haben Sie gleich zu Beginn Ihres Ausflugs die Stimme des Volkes gehört!« entgegnete Gisela Verweer fast belustigt. »Nur keine falsche Zurückhaltung, Sie dürfen alles und jedes erfragen!«
»Warum gerade ich?«
Ein erstauntes Aufblicken der Sekretärin.
»Sie sind doch ein Neuling bei uns! — In der Gemeinschaft hier unten gibt es keine Geheimnisse, jeder kennt jeden und sein Arbeitsfeld!« Auf dem Wort ›unten‹ ruhte eine deutliche Betonung.
Sie bogen in die breite Hauptstraße ein.
»Und oben?« Wollte Martin Damm mit einer herausfordernden Unbekümmertheit wissen, die an Dreistigkeit grenzte. Es wurmte ihn die ›Gefühlsduselei‹.
»Oben erfahren Sie alles Wissenswerte von Jose!« lautete die nüchterne Antwort.
Statt der erhofften Überrumpelung mußte er eine Niederlage einstecken.
Er fühlte, daß er im Begriff stand, einen Kampf vom Zaune zu brechen. Sich von einer Frau, und sei sie noch so intelligent, gängeln zu lassen, war er nicht gewohnt.
»Aus Ihren Worten könnte man schließen, daß sehr wohl Geheimnisse zwischen ›oben‹ und ›unten‹ bestehen!« Jetzt muß sie Farbe bekennen, frohlockte der Mann.
»Selbstverständlich!« sagte sie, unberührt neben ihm herschlendernd. »Keine Regierung kann sich erlauben — wenn dieser Vergleich hier angebracht ist —, mit aufgedeckten Karten vor ihrem Volk Schwarzer Peter zu spielen. Überdies gehören Sie ja zu ,oben‹ und nicht zu ›unten‹!«
»Solcher Auszeichnung war ich mir offen gestanden bis zu diesem Augenblick gar nicht bewußt!« entfuhr es spöttelnd Martin Damm.
»Dann war es gewiß gut, daß ich Sie darauf aufmerksam machen durfte!« erwiderte die Begleiterin.
Die Geliebte Sills! schoß es Damm durch den Sinn. Längst seine Frau vielleicht?... Als Sekretärin vorgestellt, als Aufpasserin beigeordnet. Die Fluchtpläne! — Verschüttete Erinnerung sprang auf. Er begann zu hassen.
»Herr Doktor Damm! — Wollen wir nicht einen fröhlicheren Ton in unsere Zwiegespräche bringen? — Was bei Ihnen jetzt zum Ausdruck kommt, nennt man bei Kriegsgefangenen Stacheldrahtkomplex. Dieser Felsendom erdrückte nahezu jeden, der zu uns kam. Sage ich jetzt, das legt sich mit der Zeit, so begehren Sie abermals auf. Vergessen Sie bitte nicht, daß gerade Sie nur für sehr wenige Wochen —« sie zögerte, »Gast, Mitarbeiter und Freund, das letztere darf ich getrost behaupten, Joses sind und ich Ihre Assistentin. Ich bin Jose dankbar, daß er mich einem neuen und, wie ich hoffe, anregenden Aufgabenkreis zuführte -. Bitte lassen Sie es mich nicht entgelten, daß Ihr eigener Zwiespalt und die Ungeklärtheit vieler Fragen Erschütterung verursachte——.«
»Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Sie verletzt habe, Fräulein Verweer!« Jetzt erst ward sich Martin Damm bewußt, daß sie sich inmitten der Häuser auf der breiten Asphaltstraße befanden und von neugierigen Blicken Vorbeieilender gemustert wurden. Zerstreut fuhr er sich mit den gespreizten Fingern der Rechten durch den dichten Haarschopf. Seine Begleiterin erwiderte mit freundlichem Kopfnicken die Grüße dieser Menschen.
»Ich habe noch nie mit einer Frau zusammengearbeitet, nur mit Männern«, setzte er hinzu, und es klang wie eine erneute Entschuldigung.
Gisela Verweer verharrte und zwang so auch ihn stehenzubleiben.
Ein Lächeln huschte über ihr sonst so unergründlich beherrschtes Gesicht.
»Dann versuchen Sie es ab heute einmal mit mir. Einverstanden?«
»Sie beschämen mich, Fräulein Verweer!«
»Ach, Unfug! — Daß Ihnen nicht wohl in Ihrer Haut ist, versteht sich von selbst... Kommen Sie, wir wollen uns als erstes das Kaufhaus hier zur Linken ansehen!«
Stunden verrannen, in denen Martin Damm Einblicke in dieses unterirdische Gemeinwesen vermittelt wurden, die er nicht für möglich gehalten hätte. Das Kaufhaus, wenn auch nur bescheiden in seinen Ausmaßen, bot eine Fülle von Waren, deren Auswahl trotz der Enge so reichhaltig war, daß jedem Geschmack Rechnung getragen wurde. Von Abteilung zu Abteilung wanderten sie, stets geführt von dem zuständigen Leiter. Stoffe, Kleider, Anzüge, Wäsche, Schuhe — Spielwaren, Haushaltgegenstände, Sportartikel, Schmuckwaren — eine sehr reichhaltige Buchhandlung, und als Überraschendstes eine geradezu Appetit anregende Feinkosthalle, die in verblüffender Kopie Delikatessen darbot, dazu Getränke jeder Art, Limonaden, Weine, Liköre, die, wie der Besucher belehrt wurde, durchweg aus künstlich erzeugten Nährstoffen bestanden. Überall herrschte rege Verkaufstätigkeit, doch ausschließlich Frauen waren die Einkäufer.
Als das Paar das Kaufhaus verließ, erläuterte Gisela Verweer, daß die Kinder der Siedlung den ganzen Tag über dem Kindergarten oder den Schulen anvertraut seien, dort auch verpflegt würden. Erst um fünf Uhr nachmittags — das sei auch die Stunde des Arbeitsschlusses — kehrten sie zu den Eltern zurück. Die Männer erhielten das Mittagessen an ihren Arbeitsstätten, die Hausfrauen holten es sich von der großen Gemeinschaftsküche. Die Abendmahlzeiten dagegen, die meist gegen sechs Uhr eingenommen wurden, zeichneten sich nicht nur durch Reichhaltigkeit, sondern überdies auch durch eine ausgesprochen persönliche Note aus. Tagtäglich liefere das Lebensmittelwerk an das Kaufhaus sämtliche erforderlichen Waren. Jede Hausfrau setze ihren Stolz darein, ein fast luxuriöses Abendbrot auf den Tisch zu bringen, obendrein herrsche allgemein rege Gastfreundschaft.
Sie besichtigten die Häuser. Jede Familie lebte für sich. Alle Bauten wiesen nur ein Erdgeschoß auf, errichtet waren sie, wie Martin Damm bald feststellte, aus Leichtbauplatten. Die als sehr komfortabel zu bezeichnende Inneneinrichtung zeugte jeweils von dem persönlichen Geschmack der Einwohner. Bereitwillig und aufgeschlossen, meist stolz sogar, öffneten die anwesenden Frauen Tür auf Tür und ließen den Besucher Einblick in ihr Heim gewinnen.
Die Uhr ging auf die fünfte Nachmittagsstunde zu, als Gisela Verweer ihrem Begleiter vorschlug, für heute die Besichtigung der kleinen Stadt zu beenden.
»Ich möchte Ihnen noch ein hübsches Bild von oben zeigen«, sagte sie, als sie dem Aufzug wieder zustrebten.
Der Fahrstuhlführer schien sie schon erwartet zu haben, erkundigte sich angelegentlich während der Fahrt, wie Herrn Doktor Damm alles gefallen habe, und der Gefragte brachte seine rückhaltlose Begeisterung offen zum Ausdruck.
Mit metallischem Klirren schloß sich hinter ihnen das Verschlußgitter, als sie auf der schmalen Galerie dahinschritten. Sie standen bald an der gleichen Stelle, von der er vor einigen Stunden den ersten Anblick der Felsenstadt gehabt hatte. »Wenige Minuten Geduld, bitte, noch!« unterbrach eine freundliche Aufforderung Martin Damms nachdenkliches Schauen auf die tief unter ihm ausgebreitete Stadt. Er nickte nur.
Gisela Verweer hob die Linke mit der Armbanduhr und beobachtete das Fortschreiten der Zeiger. »Jetzt!« sagte sie.
Ein tiefes Summen durchdrang den gewaltigen Felsendom. »Arbeitsschluß!«
Es währte nur eine kurze Weile, da belebte sich das stille Bild dort unten in nie erwartetem Ausmaße. Aus der Fabrik mit ihren Werkstätten strömte eine quirlende Menge von Arbeitern, alle in gleiche Overalls gekleidet, die im Nu lärmend und gestikulierend die Straßen bevölkerten. Viele der entfernter Wohnenden schwangen sich auf Fahrräder, ihre Heime rascher zu erreichen.
Minutenlang glaubte man großstädtischen Verkehr unter sich zu erleben, von der Spitze eines sehr hohen Turmes aus betrachtet.
Von der entgegengesetzten Seite, aus der Nachbarschaft der Sportplätze, eilten und sprangen aus weit geöffneten Türen die Kinder und Jugendlichen, und vor vielen Häusern standen Frauen winkend und lachend, die Ihrigen erwartend — ein schönes Bild voll warmer Lebensnähe und menschlicher Daseinsfreude.
Die Flut jäh erwachter Betriebsamkeit ebbte allmählich ab. Und wieder stand Martin Damm neben Gisela Verweer, die Hände auf die schimmernde Aluminiumbrüstung gestützt, und abermals verlor er sich in der Welt der Gefühle.
In einer Plauderecke des Speisezimmers fanden sich die beiden wieder. Doktor Damm hatte zum Abendessen bereits den Smoking angezogen. Die Sekretärin trug ein Kleid, das den jüngsten Pariser Modeschöpfungen entsprach, wie sie Damm aus Zeitungen zu kennen glaubte. Die große schlanke Gestalt umspannte der Seidenstoff, die Formen dieses gut gewachsenen Körpers mehr betonend als verhüllend. Hell schimmerte das jetzt gelockerte Haar, das im Nacken in einen zartgoldenen Flaum überging. Unter dem Licht der Stehlampe verschwammen die blauen Augen zu unergründlicher Tiefe, lockend und kühl abweisend zugleich. Die langen, sehr ausdrucksvollen Hände zierten jetzt Goldreifen und Ringe, über deren Wert sich Damm nicht recht im klaren war, vielleicht deshalb, weil er Schmuck nicht mochte.
In dem Gespräch war eine Pause eingetreten, während der Gisela Verweer T 96 — den Tee — in die Tassen neu eingoß. Sie setzte die Kanne nieder und hob den Kopf.
»Schafft es Ihnen etwa Unbehagen, daß Jose hier ausschließlich Deutsche beschäftigt?«
»Unbehagen?« wiederholte Damm und überlegte einen Augenblick. »Doch — Unbehagen ist ein treffender Ausdruck. Sie kennen ja die alte Behauptung, der Deutsche sei an vielen Stellen der Welt Kulturdünger, und nach dem heute Erlebten ist eine Parallele nicht von der Hand zu weisen!« entgegnete der so Gefragte.
»Das trifft keinesfalls zu! —« Eine entschiedene Handbewegung begleitete die Worte Gisela Verweers. »Die Deutung ist viel einfacher! — Nach den gewaltigen Wirren des zweiten Weltkrieges gab es eine Menge Entwurzelter, der Heimat Entrissener, in Deutschland, zu denen auch ich gehörte. Jose; lag daran, aus Gründen, die Sie ja kennen, nur Menschen ohne jeden familiären Anhang hier anzusiedeln, ihnen allein Auswanderungsbewilligung und Arbeitskontrakte zu vermitteln. Wo keine Bande mehr bestehen, brauchen solche auch nicht unnatürlich gelöst zu werden. Mit anderen Worten ausgedrückt: Jeder Briefwechsel entfiel, damit aber auch — verzeihen Sie, wenn ich das so offen sage, jede Nachforschung nach dem Verbleib der Ausgewanderten. Die Kontrakte liefen alle auf fünf Jahre. In Fällen, in denen diese Zeit überschritten wurde, erfolgte ausnahmslos die freiwillige Erneuerung. Ich kann getrost behaupten: die Leute wollen gar nicht mehr von hier fort. Die zwar räumlich beschränkten, aber fast als luxuriös zu bezeichnenden Lebensbedingungen sagen ihnen zu.
Sie wissen, daß Jose in Deutschland studiert hat und unsere Sprache, obgleich er von Geburt Mexikaner ist, hervorragend beherrscht. Er ist überhaupt ein Sprachgenie. Jose kennt Land und Leute bei uns vorzüglich. Er behauptet: Kein Volk der Erde sei so arbeitsam und erfinderisch, wie das unsere, und kein Volk liebe über alles eine so wohlorganisierte Ordnung.
Aus diesen Gründen besiedelte er sein Eiland mit unseren Landsleuten!«
Sie rührte in der Teetasse.
Fast schien es Damm, als ob das niedergebeugte Gesicht etwas verbergen wollte.
»So unrecht hat Sill nicht!« meinte er nach einer Weile unbeteiligt, als ob das Schicksal jener ihn nicht weiter berühre.
»Jose ist ein vorzüglicher, manchmal zu vorzüglicher Psychologe!« Sein Gegenüber schaute auf, und für Sekunden hing der Blick ihrer Augen in den seinen, rätselhaft forschend. Dann wandte sie sich wieder ihrer Teetasse zu.
»Sie wollten noch Näheres über unsere künstliche Sonne wissen. Um sieben Uhr morgens beginnt sie dämmerungsgleich aufzuleuchten. Um sieben Uhr abends verlischt sie langsam. Ihre Kerzenstärke entspricht etwa fünfhundert-tausend Watt. Den für die Lebensvorgänge notwendigen ultravioletten Anteil liefern Quecksilberdampf-Kaltleuchten modernster Bauart. Wenn Sie die physikalischen Einzelheiten der Lichterzeuger interessieren sollten, so können wir mal an einem der nächsten Abende hinaufsteigen. Die künstliche Sonne ist ein zu kompliziertes Gerät, um sie, ohne den Mechanismus vor sich zu sehen, allein mit Worten zu erläutern.«
»Sind fünfhunderttausend Watt nicht etwas wenig, im Vergleich mit der natürlichen Sonne, denn sehen Sie — Augenblick mal: rund zwei Watt pro Quadratzentimeter und«——Damm wollte rasch rechnend seine Behauptung untermauern.
»Halt, halt, nicht so voreilig, verehrter Herr Doktor«, unterbrach ihn Gisela Verweer, lebhafter als sonst, »Ihre Beobachtung, daß die Durchleuchtung des Felsendoms an Intensität der wahren Sonne gleichkomme, ist nur physiologisch, nicht physikalisch richtig. — Und Ihre eben angeführte Solarkonstante in allen Ehren. — Aber Sie vergessen eines! Das Empfindlichkeitsmaximum des menschlichen Auges! — Konstruieren Sie eine Lichtquelle, deren Spektrum diesen Bereich bevorzugt, so kommen Sie tatsächlich mit den von mir genannten fünfhunderttausend Watt in rund vierhundertfünfzig Meter Höhe aus. Die Bandverlängerung ins Violette und Ultraviolette hinein besorgen die Quecksilberdampf-Kaltleuchten, und diese benötigen, wie Sie wissen, bei ihrem vorzüglichen Wirkungsgrad geringe Energien!«
»Hervorragend ausgedacht!« Martin Damm nickte mehrmals nachdenklich vor sich hin. »War das etwa gar Ihr Werk, Fräulein Verweer?« Er musterte sie prüfend.
»Viele Verbesserungen, ja!« entgegnete die Gefragte anspruchslos.
Dieses schlichte Eingeständnis nötigte Martin Damm Hochachtung ab, und wieder überfiel ihn das verwirrende Gefühl, diese junge Dame vor sich, dieses gertenschlanke Mädchen im Abendkleid, nicht von der Physikerin, seiner Mitarbeiterin und — der Geliebten Sills trennen zu können.
Wie um sich abzulenken, entfuhr es ihm:
»Ich sehe hier und sah auch heute nachmittag in den Häusern, selbst im Kaufhaus, die wundervollsten Blumen. Köstlich der Duft dieser eben erblühten Rose!«
»Alle künstlich!« sagte Gisela Verweer. »Wie eben alles hier!« setzte sie hinzu.
Sie sah sein mehr als erstauntes Gesicht.
»Echte Blumen benötigen Erde, Mikroben, vielleicht sogar Bazillen, und diese sind doch streng verbannt aus unseren heiligen Hallen!«
War das nicht deutlicher Spott, der in den Worten mitschwang? Ihre Miene blieb ruhig und gelassen. »Die Blumen stellen Facharbeiter, drei Familien sind es nur, her, und den Duft fabriziert Jose naturgetreu!«
Draußen auf dem Gang nahten Schritte. Die sonst unerkennbare Tür in der Täfelung glitt geräuschlos auseinander.
»Herrlich! — Daß Sie schon hier sind!«
Doktor Sill streckte zur Begrüßung in der ihm eigenen Lebhaftigkeit beide Hände vor, trat hinter Gisela Verweer, hauchte die Andeutung eines Kusses auf die ihm entgegengehobene Stirn und schüttelte dann Martin Damm erfreut die Rechte.
»Hab heut etwas früher als sonst Schluß gemacht. — Möchte so ein nettes kleines Galasouper arrangieren, mit einigen neuen Leckerbissen, die ich zum ersten Male herstellen ließ! — Wie war's heute nachmittag, lieber Damm? — Viel Neues erlebt?« sprudelte er hervor, ohne die Antwort abzuwarten.
»Anton!« Ein geschwindes, mehrmaliges Klatschen in die Hände begleitete den Ruf.
»Bitte, Herr Doktor?«
»Aperitifs und Cocktails!« Rasch zu Martin Damm gewandt: »Wir wollen uns erst den richtigen Appetit verschaffen!«
Dann schob Sill einen Sessel näher und ließ sich wie erlöst aufatmend niederfallen.
Der Diener erschien mit einem kleinen Wagen, dessen unterer Teil mit Flaschen besetzt war. Auf der oberen Glasplatte standen Gläser in verschiedener Form und Größe. Sie klirrten in leiser Berührung, solange die Gummiräder noch über den dicken Teppich rollten.
»Also — Was wünschen Sie, mein lieber Damm?« fragte der Hausherr.
»Wenn solches bei Ihnen erhältlich, einen Gin-Wermut-Bitter!«
»Selbstverständlich!« frohlockte Sill.
Anton mischte bereits und bot den nun beschlagenen Kelch dem Gast dar.
»Und du, Gisela?«
»Na! — Ich versuch's mal mit demselben!«
»Und mir, wie immer!« sagte Sill.
Als alle drei die Gläser vor sich stehen hatten, hob Doktor Sill das Glas.
»Auf das, was wir lieben! — Prosit!«
»Ach, eh' ich es vergesse, ich habe heute das Flugzeugwrack von der Begasung freigegeben.« — Sill sprach in jener geschäftigten Erregtheit, die Werksleitern nach Beendigung wichtiger Konferenzen oftmals eigen ist. »Du könntest Doktor Damm, er wird gewiß Interesse daran haben, seine ehemals so schöne Maschine morgen zeigen, gleichzeitig die Desinfizierungshalle und die Rollkähne. Einverstanden?« Er nickte dem Gast wohlwollend und aufmunternd zu.
Der Trinkspruch hatte Martin Damm zwar merkwürdig berührt, doch war ihm keineswegs dabei entgangen, daß er sich am nächsten Tage die Einschußöffnung aus unmittelbarer Nähe ansehen könne.
Gisela Verweer drehte, den Kopf geneigt, einen ihrer goldenen Armreifen am Handgelenk.
Sill lächelte und genoß sichtlich zufrieden das Schweigen.
Da lehnte er sich plötzlich zurück und schlug ein Bein über das andere.
»Schmeckt Ihnen Ihre Mischung nicht, mein lieber Damm?«
»Doch, ausgezeichnet sogar. — Wie ich vermute, alles synthetisch hergestellt!« beeilte er sich zu antworten.
»Selbstverständlich!« entgegnete mit unverkennbarem Stolz Doktor Sill. »Noch ein Glas gefällig? Wir wollen die Geister einmal tüchtig anregen. Wird Ihnen nur gut tun, Damm! — Ich kann mich des leisen Eindrucks nicht erwehren, daß Sie noch ein wenig im Banne der heutigen Erlebnisse stehen. — War doch vieles zu unerwartet, trotz meiner schonenden Vorbereitung bei unseren abendlichen Fernseh-Gesprächen. Stimmt's?«
»Ich bekenne mich restlos ge- und erschlagen!« lachte Martin Damm. Und das Lachen klang echt.
»Sie sind von einer erfrischenden Ehrlichkeit!« sagte Sill voller Wärme. »Also, Anton! — Noch einmal dasselbe! — Ist dir doch recht, Gisela?« und als der Diener eingeschenkt hatte: »So! Schieben Sie mir den Wagen hierher! — Ihr Amt werde ich jetzt übernehmen. — Richten Sie alles an, daß wir etwa in einer halben Stunde essen können.«
»Jawohl, Herr Doktor!«
Die Türe schob sich hinter dem Davoneilenden zu.
»Jetzt sind wir unter uns! — Nun schießen Sie mal los, lieber Damm. — Mich interessiert brennend das Urteil eines Fachmannes!«
Und Damm zögerte nicht, seine Eindrücke zu schildern, wobei Sill ihn gelegentlich nicht nur durch kleine hastige Fragen oder rasche Erläuterungen, sondern auch durch seine Pflichten als Gastgeber und Bediener der kleinen Rollbar unterbrach.
Martin Damm mußte bekennen, daß wirklich köstlich mundende Getränke Gaumen und Geist erfrischten und stellte, als sie sich zum Abendessen erhoben, ohne Bedauern vor sich selbst fest, daß er einen kleinen lustigen Schwips habe.
Doch Sill schien es genau so zu ergehen. Seine dunklen Augen glänzten, er sprach lauter und temperamentvoller als sonst.
Nur Gisela Verweer beharrte in ihrem gleichmäßig ruhigen Wesen. Sie hatte wenig getrunken.
Das von Sill so bezeichnete »Galasouper« überraschte aber selbst diese. Die aufgetragenen Gerichte waren von einem Wohlgeschmack, der der besten Pariser Küche nur Ehre eingetragen hätte, dabei alles künstlich hergestellt, wie der Hausherr mehrfach in unverhohlenem Triumph betonte.
Als man sich nach dem Essen anschickte, in die Plauderecke zurückzukehren, empfahl sich Fräulein Verweer. Die beiden Männer verbrachten den Abend in der ihnen schon zur Gewohnheit gewordenen Art. Es war spät, als sie sich endlich trennten.
»So ist doch mein erster Eindruck bestätigt«, entfuhr es Martin Damm, als er und seine Begleiterin die in ihren Ausmaßen als gewaltig anzusprechende Desinfektionshalle durch eine kleine Pforte betraten. Vor seinen Blicken standen nebeneinandergereiht sechs große Prahme auf einer mächtigen Verschiebebühne. Jeder der schweren Lastkähne wurde durch eine Vielzahl von Rädern getragen.
»Ihr erster Eindruck?« fragte Gisela Verweer, und dieses Mal schwang aus der sonst fast betonten Lässigkeit der Sprechweise ein Unterton von Neugier mit.
»Ja!« sagte Damm. »Das erste, was mein Interesse nach meiner Notlandung auf der geneigten Felsebene wachrief, waren die in das Gestein eingelassenen Gleise mit ihrer ungewöhnlichen Spurweite von über drei Metern!«
»Und was schlossen Sie daraus?« wollte sie mit steigender Anteilnahme wissen.
»Da die Schienen sich noch weit unter Wasser fortsetzten, kam mir die Idee, daß zum Transport von Gütern Rollprahme benutzt sein könnten, denn die Mole war sichtlich zu kurz, um einem Dampfer Anlegemöglichkeit zu bieten. Ich glaubte damals noch, ich befände mich auf einer verlassenen Walfangstation.«
»Nicht schlecht!« sagte lächelnd das Mädchen an seiner Seite.
»Dazu kam noch, daß ich ein Stück Kiefernholz, welches offensichtlich von Kistenbrettern stammte, in einem der Gleise eingeklemmt fand.«
»Sie sind der reinste Detektiv!« Gisela Verweer schaute Martin Damm mit einem seltsam frohen und aufmunternden Blick an. Nach einer Weile schweigenden Dahinschreitens meinte sie: »Sie müssen mir überhaupt einmal erzählen, wie sich Ihre Erlebnisse abgespielt haben! — Es muß Ihnen doch sehr seltsam zumute gewesen sein.«
Es war das erste Mal, daß seine Mitarbeiterin eine Note persönlicherer Art im Gespräch anschlug.
»Dort steht Ihr Flugzeug!« setzte sie, plötzlich wieder sachlich, hinzu.
Von der Maschine waren die Tragflächen abmontiert. Sie lagen neben dem Rumpf am Boden.
Es war einmal! sann Martin Damm vor den Resten ehemaliger Habe. Wie schön war das Fliegen im herrlich blauen Äthermeer gewesen! Wie unbeschränkt war die Freiheit gewesen! — War gewesen! Jäh überwältigte ihn ein Gefühl, zu allen seinen Handlungen gezwungen, wider seinen freien Willen, mit List und falschen Vorspiegelungen, in die Gefangenschaft eines Unberechenbaren gelockt worden zu sein.
Da fiel sein Blick auf jenen hochgerissenen Fetzen Aluminiumblech, der in den ersten Stunden seiner Anwesenheit eine Flut von widerstreitenden Gedanken ausgelöst hatte. Er schritt wie von einem Magneten angezogen näher, noch näher. Wie unbeabsichtigt legte er seine Hand auf die Tragfläche.
War er wahnsinnig geworden?
Narrte ihn ein irrsinniger Spuk?
Hatte er damals seine Sinne nicht beieinander gehabt?
Hirngespinste, seine als untrüglich erkannten Feststellungen, die er unter Eid hätte beschwören können?
Gisela Verweer war in das Innere des Rumpfes geklettert.
Er beugte sich herab, prüfte mit fiebernder Hast den schier unglaublichen Tatbestand.
Die Börtelung des Loches wies jetzt nach außen, erweckte den Anschein, als ob ein durch den Explosionsdruck herausgerissener kleiner Metallbolzen das Blech von innen nach außen durchschlagen und nicht ein Einschuß die gezackte Randung des Bleches von außen nach innen verursacht hätte.
Seine Hand fuhr tastend von beiden Seiten über das Loch, das zu bestätigen, was den Augen völlig unmöglich erschien.
»Schade, die Kiste ist so restlos ausgebrannt, daß auch keine der vielen Apparaturen wiederhergestellt werden kann!« ertönte eine Stimme.
Er fuhr fast erschreckt aus seinen quälenden Gedanken auf.
Seine Begleiterin nahte. Sie schaute ihn nachdenklich an, dicht neben ihm tauchten ihre Blicke jetzt tief in die seinen.
»Es gibt mehr Dinge — als eure Schulweisheit euch träumen läßt.« Wie Hohn und Spott trafen die nur leise gesprochenen Worte seine wunde Seele.
Da stieß Martin Damm aus jäh erwachtem Zorn bedenkenlos hervor: »Meinen Sie das hier?« Er fauchte sie förmlich an. Seine Hand ruhte auf dem Blech.
Achselzuckend wandte sie sich ab.
Sie sprach laut und unbekümmert, wie ein Fremdenführer, dessen Aufgabe es ist, die Wißbegier der Besucher zu stillen.
»Ihre Vermutung damals war ganz richtig!« Sie drehte sich um, als ob sie Damm, der völlig fassungslos dastand, zur weiteren Besichtigung auffordern wollte.
»Was soll das heißen? — Was soll das heißen?« entfuhr es ihm. »Wollen Sie sich nicht näher erklären?«
»Ihre Vermutung damals war ganz richtig!« wiederholte sie, jedes Wort abwägend und akzentuierend. »Die Waren, die wir von der Außenwelt benötigen, kommen mit dem Dampfer an. Der Bruder Doktor Sills —« Doktor Sills sagte sie, nicht Jose — »führt ihn als Kapitän. Daß er verschwiegen ist, bedarf keines besonderen Hinweises. Etwa alle zwei Monate geht er draußen, stets in mondlosen Nächten, auf Reede. Die Gummimänner, die Sie ja kennen, löschen die Güter und laden sie in die Rollprahme um. Reicht eine Nacht nicht zu dieser Tätigkeit aus, so lichtet das Schiff im Morgengrauen die Anker und trifft abends wieder ein.
Die Ladung bleibt auf den Lastprahmen, die mit Seilzügen auf die Verschiebebühne hier geführt werden. Ist alles erledigt, so schließen sich die Felsentore. — Vielleicht haben Sie damals feststellen können, daß auch nicht der kleinste Ritz im Gestein diese Tore verrät.«
Damm nickte nur geistesabwesend.
»Eine Meisterleistung der Steinmetzkunst, das geben Sie doch zu?«
Er nickte abermals.
»Haben die Gummimänner die Halle hier verlassen, so wird sie luftdicht verschlossen und mit einem besonderen Giftgas unter leichtem Überdruck gefüllt. Nach vierzehn Tagen ist die gesamte Ware desinfiziert, garantiert so sicher desinfiziert, daß auch nicht ein einziger Bazillus uns, und damit den Versuchen, gefährlich werden könnte!«
Vernommen hatte Martin Damm die klaren Erläuterungen wohl, auch begriffen. Im Unterbewußtsein aber tobte der Kampf der Gedanken weiter.
Was wußte jene von dem umgearbeiteten Einschußloch? War das eben eine sehr deutliche Warnung gewesen, sich der unbeschränkten Macht des Herrn der Insel bewußt zu bleiben, oder — wie stand Gisela Verweer in Wahrheit zu Sill?
Sie schritten jetzt schweigend der Ausgangspforte zu.
Doktor Martin Damm beschloß, hinfort Gisela Verweer mit anderen Augen zu betrachten, jede ihrer Äußerungen auf die Waagschale zu legen. Unter dem Eindruck des eben Erlebten erhielten urplötzlich alle ihre früheren Worte einen doppelten Sinn.
Wer wußte, ob sie nicht ständig beobachtet, ja durch Mikrophone belauscht würden?
So fragte er, als ob bis jetzt ein harmloses Problem ihn beschäftigt habe:
»Mir ist alles klar! — Nur eines nicht. — Ein Dampfer muß eine Mannschaft haben. — Gut! Ladungs- und Entladungspapiere, Konnossemente und so weiter kann man fälschen. — Wer sieht überdies einem harmlosen kleinen Dampfer auf Trampfahrt so genau in die Schiffstagebücher? Wie kann man es aber auf die Dauer durchsetzen, daß die unter allen Umständen erforderliche Mannschaft, Ingenieure, Techniker und sonstiges Personal dicht hält?«
»Alle Ehre, Herr Detektiv!« lachte Gisela Verweer, und aus ihrem Lachen klang Genugtuung. »Ich darf Ihnen ehrlich gestehen, daß ich mir diese Frage auch schon des öfteren habe durch den Kopf gehen lassen, denn in alle Geheimnisse bin selbst ich nicht eingeweiht. Ich habe sie mir schließlich mit der Gegenfrage beantwortet: Wie kommt es, daß nie etwas über Schmugglerschiffe oder gar ungesetzliche Waffentransporte über See in die Öffentlichkeit dringt? Geld scheint auch hier die Lippen zu verschließen. Außerdem weiß keiner an Bord, ausgenommen der Kapitän, wohin der Kurs führt, und in pechschwarzer Nacht sind die Umrisse des dunklen Felsens gewiß nicht zu erkennen. Das ist meine Erklärung. Jose habe ich nie danach gefragt, und Sie sollten es auch nicht tun!« Bei den letzten Worten hob sich ihre Stimme.
Enttäuscht schwieg Martin Damm. Er hatte mehr erhofft und fühlte sich gleichzeitig zurückgestoßen. Die Scheidewand zwischen ihm und der Geliebten Sills ward erneut aufgerichtet.
Eine gelehrige Schülerin ihres Meisters, hohnlachte es in ihm. Oder war alles, alles hier, sein eigenes Erleben nur Wahn und Einbildung? Als ob seine Gedanken offen ausgebreitet lägen, sagte Gisela Verweer:
»Mit dem nächsten oder übernächsten Schiff werden Sie uns ja wieder verlassen. Dann wird das hier Erlebte bald wie ein spukhafter Traum hinter Ihnen liegen!«
Er schloß die Pforte hinter sich.
»Jetzt wollen wir der chemischen Fabrik einen Besuch abstatten!« sagte sie und schritt voran. In dem eng anliegenden Overall wirkte ihre Gestalt noch schlanker, fast wie ein schlaksiger Junge. Martin Damm betrachtete sie, wie sie vor ihm ging, und wurde sich bewußt, daß er die Formen und Bewegungen ihres Körpers abschätzend als Mann betrachtete.
Auf einer der breiten Asphaltstraßen, die nach einem kurzen Stück schmalen Weges bald erreicht war, schlenderten sie nebeneinander. Damm hatte somit Muße, in manches der einstöckigen Häuser einen Blick durch die geöffneten Fenster zu werfen und die Vielfalt der Einrichtung zu beobachten. Die Wohnlichkeit der Raumausstattung entsprach ganz und gar deutscher Art. Überall leuchteten Blumen in Vasen, und selbst manche Vorgärten prangten im Schmuck freundlicher Blumenbeete. Die Echtheit der Natur von Blüten und Blattwerk hätte kein Uneingeweihter bezweifelt.
Aus einem der Häuser erscholl fröhliche Lautsprechermusik.
»Besitzen Sie auch Radio hier?« fragte er seine Begleiterin.
»Nein, das nicht! — Übertragung von Schallplatten oder Magnetophonbändern!« beantwortete Gisela Verweer die Frage. »Oben in der Kuppel des Felsendomes befindet sich eine Empfangsstation, die Darbietungen aus aller Welt aufnimmt. Ein kleiner Stab von Rundfunkfachleuten stellt hier unten das Programm zusammen, ebenso die Nachrichten, so daß wir stets über alle Neuigkeiten, gleich welcher Art, Politik, Wissenschaft, Kunst und Tagesereignisse, informiert werden. Dann kommt dazu noch die tägliche Zeitung, die jede Familie erhält. Sie sahen wohl ein Exemplar davon oben bei Jose«
»Ja!« sagte Damm. »Das Blatt, das ich durchstudierte, war ganz vorzüglich redigiert, für jeden Geschmack etwas.
Nur——«, er zögerte, »wenn ich es so ausdrücken darf, die Meinungsbeeinflussung wirkte auf einen Neuling, wie mich, etwas fremdartig.«
»Empfanden Sie das?«
Martin Damm nickte nur. Die Sprecherin fuhr fort: »Schließlich strebt ja auch draußen in der Welt jede Presse eine spezifische Meinungsbildung an.«
»Da kann ich Ihnen nicht unrecht geben!« meinte Damm und sann darüber nach, ob dies eine Kritik oder nur eine sachliche Feststellung war. Er begann die Worte seiner Mitarbeiterin auf die Waagschale zu legen. Dieses Mal rührte sich der Zeiger der Waage nicht, oder vielleicht doch ein wenig zur Seite der Kritik?
»So! Hier wären wir!«
Sie schritten eine große Freitreppe aufwärts. Vor ihnen wurde eine Glastüre geöffnet.
»Herr Doktor Mingold erwartet Sie in seinem Zimmer!« empfing der Pförtner das Paar freundlich. »Geradeaus und dann links bitte!«
»Danke! — Ich weiß Bescheid, Scherer!« sagte Gisela Verweer kurz grüßend.
Martin Damm verblüffte die architektonische Inneneinrichtung der ovalen Vorhalle, die sie durchquerten. Der Fußboden bestand aus glanzgeschliffenem, grünlich-blauem Diabas, in rombenförmig eingelegten Platten. Die Wände glänzten matt, in ockerbraunem Kunststoff mit rötlichgelber Maserung, so daß sie wie schimmernder Marmor wirkten. Cremefarben wölbte sich in leichter Kuppelform die Decke. Unsichtbar angebrachte Leuchtröhren verbreiteten eine warm strahlende Lichtflut. Diese Halle hätte sich getrost überall auf der Welt als Muster guten Geschmackes im Eingang eines Konzertsaales sehen lassen können.
»Ist das hier Sills eigene Idee?« wollte er wissen.
»Sich nebenher noch als Architekt zu versuchen, ist eines von Sills Steckenpferden und, wie man hier sieht, sogar ein vorzüglich zugerittenes!«
Senkte sich dieses Mal die Waagschale der Ironie zu? Das Antlitz der Begleiterin blieb undurchdringlich.
Sie verließen die Halle, die in einen breiten Gang ausmündete. Das Dröhnen und Surren von Maschinen drang nunmehr deutlich vernehmbar in die Ohren.
Sie schwenkten zur Linken. Wenige Schritte noch, dann klopfte Gisela Verweer flüchtig an eine Tür und trat gleichzeitig, ohne die Aufforderung des Zimmerinsassen abzuwarten, ein.
»Ah! — Fräulein Verweer und unser verehrter Gast, Herr Doktor Damm! — Mingold ist mein Name! — Freut mich ungemein, Sie kennenzulernen, Herr Doktor Damm! -Herzlich willkommen, Fräulein Verweer!«
Doktor Mingold war von seinem Sitz aufgesprungen und den Eintretenden entgegengeeilt. Man schüttelte sich die Hände.
»Darf ich Sie bitten, hier Platz zu nehmen.« Mingold schob voller Eifer einen Stuhl für Gisela Verweer zurecht. »Und Sie, Herr Doktor Damm, vielleicht hier, wenn es Ihnen recht ist?« Der Leiter der chemischen Abteilung der Daumeninsel, klein, kugelig, behend, sprühte vor Entgegenkommen und Empfangsfreude.
Er ließ sich in seinen Bürosessel fallen und rieb sich raschelnd die Handflächen.
»Na! was sagen Sie zu unserem herrlichen Felsennest?« wandte er sich listig schmunzelnd dem Gast zu.
»Ge- und erschlagen, wie ich Herrn Doktor Sill eine ähnlich lautende Frage gestern abend beantwortete!« lachte Martin Damm.
»Sehen Sie, sehen Sie! — Ganz meine Meinung. Ein Jammer, daß Doktor Sill in einigen Jahren die Siedlung und die gesamten Versuchsstationen hier aufgeben will. Meine Frau, die Kinder, ganz zu schweigen von mir selbst, haben sich noch nie im Leben so wohl gefühlt wie hier. — Ungemein interessante, wissenschaftliche Arbeiten. — Schade, daß wir so im Geheimen arbeiten müssen, jammerschade! — Das Werk trägt sich finanziell durch den Export von künstlich hergestellten Hormonpräparaten, Vitaminen und mancherlei Medikamenten jetzt schon selbst. Sie, Herr Doktor Damm, sind doch sozusagen persona grata, gratissima bei unserem hochverehrten Chef. Sie könnten sich einen Lorbeerkranz verdienen, wenn Sie Ihren Einfluß dahingehend geltend machen würden, daß Doktor Sill derartige, verzeihen Sie, wenn ich das so freimütig ausspreche, hirnverbrannte Pläne, wie die Aufgabe dieses Werkes, einer Korrektur unterzieht und aus einem beabsichtigten Interim einen Dauerzustand macht. — Was mich anbetrifft — ich spreche damit wohl die Ansicht aller meiner Mitarbeiter, ja der gesamten Siedlung aus —, so bin ich gern bereit, meine Tage hier zu beschließen. Was will der Mensch denn mehr? — Gute Arbeitsbedingungen, wissenschaftlich interessante Tätigkeit, Ordnung, Disziplin, frohe und einmütige Kameradschaft bei allen Siedlern, ein schönes Heim, keine Krankheiten, ja zum Teufel, da kann mir die ganze Außenwelt den Buckel herunterrutschen mit ihren ewigen Alltagssorgen, Quengeleien, Hader und Zwist!«
Doktor Mingold hatte sich wahrhaft in Begeisterung geredet und mit entsprechenden Handbewegungen nicht gespart.
Gisela Verweer lächelte, als sie Doktor Damm anblickte.
»Na, was sagen Sie nun, Sie zwiespältiger Zweifler?« — Ihre Linke hob sich und strich eine widerspenstige Haarsträhne aus der Stirn, den Kopf leicht nach hinten werfend.
»Ich muß schon sagen, daß mich die Ausführungen Herrn Doktor Mingolds sehr beeindruckt haben!« Damm versetzte einen vor ihm auf dem Tisch stehenden Löscher in sanft schaukelnde Bewegung. Die Mittelfinger beider Hände tupften abwechselnd auf die gegenüberliegenden Kanten.
Mingold schaute etwas verdutzt drein.
»Sie zweifeln an der umstürzenden Realität der Arbeiten Doktor Sills?« fragte er plötzlich.
»Keineswegs!« entgegnete Martin Damm. »Dafür habe ich schon zu viel Proben seiner genialen experimentellen und organisatorischen Tätigkeit zu kosten bekommen, als daß ich noch irgendwelche Bedenken hätte.«
»Bravo! — Na endlich!« rief Gisela Verweer. Es war das erste Mal, daß Martin Damm ein derartiges Aussichherausgehen an seiner Begleiterin wahrnahm. Doch wie sollte er diese Äußerung deuten? Hatte in jenem lauten Beifall nicht ein Unterton mitgeschwungen, der genau so als Zustimmung, wie als Aufmunterung zu weiterem Widerstand zu deuten war? »Herr Doktor Damm ist etwas unfreiwillig hierhergeraten, das wissen Sie ja, Doktor Mingold« — Gisela Verweer wandte sich dem Leiter des Chemiewerkes zu —, »und daraus erklärt sich auch seine Skepsis, die ich vollauf unterstütze, um ihn endlich den wirklichen Tatsachen zugänglich zu machen. — Des Menschen Glückseligkeit hängt schließlich davon ab, seine Persönlichkeit in der ihm gemäßen Freiheit zu behaupten!«
»Das haben Sie glänzend ausgedrückt!« platzte Doktor Mingold heraus. »Trotz vieler Beschränkungen habe ich mich noch nie so frei gefühlt wie hier, und das danke ich Doktor Sill!«
Doktor Damm aber beschäftigten die Worte Gisela Verweers. Daß diese nur für ihn bestimmt waren, stand außer Zweifel. Mingold hatte den verborgenen Sinn nie und nimmer erfaßt. Oder — war das wieder Glatteis, das die Geliebte Sills vor ihm ausbreitete, ihn zu Fall zu bringen, seine wahre Gesinnung zu erforschen?
»Na, dann kann ich wohl nach dieser aufmunternden Einleitung zur Sache kommen!« Doktor Mingold lehnte sich behäbig zurück. »Die mir von Herrn Doktor Sill gestellte Aufgabe lautet, Sie, Herr Doktor Damm, in die Geheimnisse unserer Lebensmittelproduktion einzuweihen. Darf ich mit meinem kurzen Vortrag beginnen? — Anschließend besichtigen wir dann das Werk und die Laboratorien.«
Martin Damm nickte höflich zustimmend.
»Ich brauche Ihnen als Wissenschaftler wohl nicht besonders klarzulegen, daß der menschliche Körper zu seiner Ernährung in erster Linie Eiweiß, Fette und Kohlehydrate bedarf. Die chemische Analyse aller drei genannten Primärstoffe ergibt ausschließlich das Vorhandensein von Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Dazu kommen noch bei den Eiweißen: Stickstoff und Schwefel. Eine Reihe von Salzen und die sogenannten Spurenelemente sind außerdem erforderlich. Daß Vitamine ebenfalls aus den eben genannten Grundstoffen, Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, aufgebaut sind, ist Ihnen gewiß bekannt. Herr Doktor Sill ging nun bei seinen ersten Betrachtungen des Ernährungsproblems von folgenden Feststellungen aus: Die Natur ist launisch. Gewaltige Ernteerträge können durch Witterungseinflüsse oder Insektenfraß nicht nur beeinträchtigt, sondern sogar vernichtet werden. Was aber nicht vernichtet werden kann, sind die überall vorkommenden Grundstoffe.
Kohlenstoff, in überreicher Menge in Stein- und Braunkohle.
Stickstoff, in der Luft zu rund 75 Prozent.
Sämtliche erforderlichen Salze, im Meerwasser.
Daß Schwefel rein oder in Verbindungen häufig vorkommt, ist bekannt.
Gelänge es, ohne den Umweg über Pflanze und Tier lediglich aus den eben angeführten Grundstoffen Eiweiß, Fett und Kohlehydrate herzustellen, so wäre das Ernährungsproblem der Menschheit für alle Zeiten gelöst, mag ihre Zahl auch noch so anschwellen, und sie steigt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, trotz aller Kriege und Seuchen. Es ging also darum, der Natur hinter die Schliche zu kommen, wie sie zum Beispiel in der Pflanze die Kohlehydrate herstellt. Was einem simplen grünen Blatt gelingt, muß auch in der Retorte gelingen.
Daß das Sonnenlicht, das Chlorophyll und Spurenelemente als Katalysatoren in der Natur eine ausschlaggebende Rolle spielen, ist längst bekannt.
Herrn Dr. Sill gelang es nun als erstem, und soweit mir bekannt ist, als einzigem, den Werdeprozeß aufzuhellen und künstlich zu reproduzieren. Die Pflanzen, somit die Kohlehydrate, waren besiegt.
Von dieser gesicherten Erkenntnis aus nahm er Schritt auf Schritt die Eroberung des vielgestaltigen Reiches der Eiweiße und Fette vor. Er hatte eine unglaublich glückliche Hand in der Entdeckung der erforderlichen Katalysatoren.«
Mingold fuhr sich mit der Hand über das kurzgeschorene Kopfhaar.
»Doch zurück zu den Tatsachen! — Wir pumpen Seewasser in Verdampfungsapparate. Die gewonnenen Salze werden chemisch getrennt, Kochsalz für Speisezwecke bildet den Hauptanteil. Im weiteren Verlauf der Behandlung werden Jod und Brom, Kalzium, Magnesium, Mangan, Zink und Kupfer gewonnen, ja sogar Silber und Gold. In diesem Punkte sind wir, wie man sagt, autark, also vom Import unabhängig. Lediglich Schwefel muß in geringen Mengen eingeführt werden.
Sie wissen, daß aus drei Bohrlöchern Wasserdampf von etwa 180° Celsius entströmt, mit einem Druck von nahezu zehn Atmosphären. Die Energiefrage spielt also keine Rolle.
Stickstoff wird im Gefriertrennungsverfahren aus der Luft gewonnen, desgleichen Sauerstoff.
Durch Elektrolyse des kondensierten Geisirwassers erhalten wir zusätzlich Sauerstoff und Wasserstoff.
Die Gase werden in Hochdruckgasometern gespeichert. Das erfolgt während der Nacht, um unsere Dampfturbinen und Generatoren möglichst gleichmäßig laufen zu lassen.
Das durch Meerwasserumspülung in Kühlschlangen kondensierte Geisirwasser ist außerordentlich rein und kann sofort als Trinkwasser benutzt werden.
Kohlenstoff gewinnen wir aus unserem kleinen Bergwerk, das ist Ihnen gewiß auch bekannt.«
»Ja«, antwortete Martin Damm. »Dieses geologische Rätsel beschäftigt mich schon, seit ich zum ersten Male davon erfuhr!«
»Das will ich Ihnen gerne glauben!«
Doktor Mingold lächelte selbstzufrieden. »Hab mich während meiner Studienzeit auch ein wenig mit Geologie beschäftigt. Dampfgeisire in Urgestein, wie Gneis und Diabas, kommen vor, siehe Island. Daß dazu aber noch Kohle vorkommt, zumal unser Felsendom sicher vulkanischen Ursprungs ist, das dürfte wohl ein einzigartiges Kuriosum darstellen. Es ist aber so! Nach Angaben von Herrn Doktor Sill wurde die Kohle entdeckt, als es in den Anfängen der Besiedlung galt, Tiefbohrungen zum Herd der Dampfquellen niederzutreiben, um diese in Leitungen zu fassen. Bei 250 Meter Tiefe durchstieß man die Kohlenflöze, und erst bei 600 Metern erfaßte man die Dampfursprungsstätte. Was lag da näher, als einen Schacht niederzuführen, um auch die so dringend benötigte Kohle abzubauen.
Damit hätte ich Ihnen in großen Zügen die Bezugsquelle unserer Ausgangsstoffe für die Herstellung von Eiweiß, Fett und Kohlehydraten dargetan. Wenn es Ihnen recht ist, können wir jetzt zur Besichtigung des Werkes selbst aufbrechen.«
»Aber selbstverständlich!« entgegnete Martin Damm und erhob sich.
Die drei verließen sogleich das Zimmer.
»Sie gestatten, daß ich vorausgehe!« wandte sich Doktor Mingold auf dem Gang um. Er drückte die Klinke einer Tür nieder.
Eine weite Halle voller Apparaturen und seltsamer Geräte tat sich auf. Am stärksten fiel die Unzahl von verschiedenfarbigen Rohrleitungen auf.
Kompressoren stampften ihren gleichförmigen Takt, einige in sehr gemächlichem Hin- und Herschwingen der Kolbenstangen, andere in unentwegtem behendem Tücken. Getriebe brummten ihr tiefes oder helles Lied, übertönt von metallischem Klappern und Pochen von Nocken- und Ventilsteuerungen. Eine Fabrikhalle, wie es tausend ihresgleichen in allen Erdteilen gab! Doch diese hier war für den staunenden Besucher, der solchen Anblick nicht erwartet hatte, erfüllt von dem Geheimnis der Einzigartigkeit, denn aller Aufwand diente nur der Herstellung künstlicher Nährstoffe.
Doktor Mingold bog zur Rechten ab, in eine der Ecken der Halle. Vor einem mannshohen Zylinder von nahezu einem Meter Durchmesser blieb er stehen. Seine Gäste scharten sich um ihn.
»Hier sehen Sie die Keimzelle, wenn ich mich so ausdrücken darf, aller Sillschen Synthesen!« Er schrie fast, den Maschinenlärm zu übertönen. »Die künstliche Assimilation, also die Nachahmung der Tätigkeit der Pflanze, aus der Kohlensäure der Luft und des Wassers Stärke, beziehungsweise Traubenzucker herzustellen. Dieses dunkelblaue Rohr hier«, er klopfte mit der Hand dagegen, »führt Kohlendioxyd, dieses hellblaue«, die Rechte berührte das zweite Rohr, »Wasser. — Dort die Stromzuführung zur Erzeugung von Wärme und ultraviolettem Licht. Doktor Sill beschritt mit Erfolg den Weg, über Formaldehyd zu Traubenzucker zu gelangen. Die Kohlensäure, also H2C03, wird durch Lichtspaltung unter Verwendung eines geeigneten Katalysators an Stelle des pflanzlichen Chlorophylls in Formaldehyd CH20 und Sauerstoff zerlegt. Unter Zwischenschaltung weiterer Katalysatoren wird das Formaldehyd direkt in Traubenzucker C6H12Oe überführt. Unserem deutschen Landsmann, Professor Emil Fischer, gelang Ähnliches durch Verwendung schwacher Alkalien, doch sein Verfahren ist zu kostspielig, außerdem ist der so erhaltene Zucker nicht rein. - Ich schalte den Apparat ein!«
Mingold machte sich an verschiedenen Hähnen zu schaffen, wendete zuletzt den Stromschalter. Hinter einer kleinen, runden Rubinglasscheibe flammte ein intensives Licht auf. Dann nahm er einen bereitstehenden Topf und stellte ihn unter den seitlichen Ausflußhahn auf ein Metallbord.
»Augenblick Geduld bitte!« rief er Doktor Damm zu.
Schon begann eine erst wasserdünne, dann immer zäher werdende dampfende Flüssigkeit dem Hahn zu entströmen.
»So, jetzt stecken Sie getrost einmal den kleinen Finger hier in den Topf und kosten Sie! — Brauchen nicht fürchten, sich zu verbrennen!«
Martin Damm folgte der Aufforderung und führte den mit einer klebrigen Schicht überzogenen Finger zum Munde. Das war reiner Zucker, daran gab's nichts zu zweifeln.
»Donnerwetter, allerhand!« entfuhr es ihm. »Zucker aus Kohlensäure und Wasser!«
»Jawohl!« grunzte Mingold urvergnügt. Als er die ratlose Miene des Gastes sah, der immer noch an seinem Zuckerfinger leckte: »Bitte dort ist ein Spülbecken. Ein sauberes Handtuch ist auch da.«
Doktor Damm wusch sich sehr nachdenklich die Hände. Daß Mingold ihn hier unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zum Narren hielt, konnte er getrost als absurde Erwägung ablehnen. Doktor Sill war wirklich der große Wurf gelungen, den so viele Chemiker der Welt bisher ohne Erfolg versucht hatten. Er aß ja selbst tagtäglich die Produkte dieser Fabrik. Bedächtig trocknete er sich die Hände ab. Das alles hier war doch viel mehr, als er je erwartet hatte.
Doktor Mingold legte, als er sich umwandte, die Apparatur still.
Damm trat wieder zu ihm und Gisela Verweer, deren Augen ihn nur einmal kurz anblickten.
»Dieses veraltete Verfahren wird heute nicht mehr angewandt!« schrie der Chemiker. »Neueren Erkenntnissen folgend, beherrschen wir jetzt den Weg der synthetischen Zucker- und Stärkeherstellung über die Karboxylgruppen. Doch das hier war der erste Schritt in das Neuland! — Wir wollen jetzt zur Fettsäureherstellung gehen.«
Ihr Führer schritt behenden Fußes an einer Vielzahl Maschinen, Retorten und Kesseln, an denen eine große Menge Arbeiter tätig war, vorbei, bis er vor einer Reihe Stahlzylinder, die durch ein Gewirr farbiger Rohre verbunden waren, anhielt.
»Hier läuft im Augenblick die Butterherstellung. Sie wissen, daß bereits aus dem bei dem Fischer-Tropsch-Verfahren abfallenden Gatsch künstliche Butter hergestellt werden konnte. Gatsch ist aber ein Abfallprodukt des synthetischen Benzins. Den Umweg ersparen wir uns, indem wir nach dem Sill-Patent sofort aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff die erforderlichen Glyzerine und höheren Fettsäuren herstellen, Milchzucker sowie Eiweiß und Salze zusetzen. — Die Vorgänge hier sind äußerst kompliziert, und ich fürchte, Sie zu langweilen, wenn ich mich des längeren darüber ergehen würde, wie die einzelnen Bestandteile, zum Beispiel Oleopalmitin, Palmitodistearin, Tristearm, verschiedene Oleine, um nur einige zu nennen, synthetisiert werden. Doch sehen Sie hier das Fertigprodukt.«
Aus dem gläsernen Mundstück eines Kessels schob sich gut sichtbar eine weißlichgelbe Masse, die Butter darstellen sollte, um irgendwo im Gang der Weiterverarbeitung zu verschwinden.
»Meister Munk! — Bitte rasch einmal eine Kostprobe!« rief Doktor Mingold.
Munk erschien mit einem Glasteller, öffnete einen Hahn, die Buttermasse häufte sich kringelnd, wie beim Ausdrücken einer Tube, auf dem Teller. Dann schloß er den Hahn, und der kleine Quell versiegte. Er reichte dem Gast den Teller und den darauf liegenden Teelöffel.
Martin Damm dankte und versuchte ohne Zögern die Kostprobe.
»Das ist tatsächlich reine Butter! — Wenigstens dem Geschmack nach!« setzte er einschränkend hinzu.
»Nicht nur dem Geschmack nach«, lachte wiederum sichtlich ergötzt Mingold, »auch die chemische Analyse ergäbe genau das gleiche Resultat. Die Herstellungskosten, das möchte ich noch anführen, belaufen sich, da die Dampfenergie uns nichts kostet, auf etwa ein Zehntel des derzeitigen durchschnittlichen Preises für Exportbutter!«
Doktor Damm setzte versonnen den Teller auf einen Tisch.
Wenn dieser Sill frei schalten und walten könnte, wäre er in Kürze der Herr der Welt. Welche entsetzliche Revolutionen aber müßte er heraufbeschwören, und was könnte die Menschheit Positives gegen die unvermeidliche Arbeitslosigkeit, ja mehr noch gegen das Leben ohne jede Arbeit, eintauschen? Jetzt erst begann er die Tragweite des Abkommens zwischen Sill und den Regierungsstellen in vollem Umfang zu erfassen.
Die Stimme Doktor Mingolds riß ihn aus seinem Sinnen.
»Mit der Eiweißherstellung will ich Sie verschonen. Selbst der erfahrenste Chemiker außerhalb unserer Insel müßte umlernen, daß ihm der Kopf rauchte. Falls es Sie aber interessiert, kann ich Ihnen später einmal die völlig neuartigen Methoden und die Auslese der für den menschlichen Organismus spezifisch wichtigen Proteine und der Aminosäuren erläutern. — Recht so?«
Doktor Damm nickte.
»Jetzt wollen wir noch rasch unserer Exportabteilung einen Besuch abstatten. Bitte — hier!«
Sie schlängelten sich zwischen den Maschinen, Kompressoren, Behältern und dem Rohrleitungsnetz durch, dann öffnete Mingold eine Tür. Sie betraten einen fast ebenso großen Raum. Doch es war stiller hier. Nur das sanfte Klopfen von Tablettiermaschinen war zu vernehmen.
Endlich konnte man sich ohne Aufwendung erheblicher Stimmkraft verständigen.
»Hier haben sie gerade Glastuben mit Vitamin C!« meinte Mingold und wies ein Röhrchen vor, das er einem Karton entnahm.
Verblüfft betrachtete Damm das aufgeklebte Etikett. Es war in Druck und Aufmachung das gleiche, das von einem der großen Chemiewerke in den Exporthandel gebracht wurde.
»Hier weitere Vitamine B und D!«
Sie gingen den Gang zwischen den Fließbändern entlang. »Und hier einige unserer Glanzleistungen, synthetische Hormone und ganz besonders synthetisches Insulin gegen Zuckerkrankheit. Darin besitzen wir bis heute ganz uneingeschränkt eine der Welt völlig unbekannte Monopolstellung!« Brennende Genugtuung strahlte aus den Augen Mingolds.
Martin Damm aber sah nur, daß Verpackung und Aufmachung täuschend führenden Werken nachgeahmt waren.
»Verzeihen Sie, Doktor Mingold, die vielleicht indiskrete Frage«, hub er nach kurzem Schweigen an. »Warum schicken Sie diese Medikamente so auf den Weltmarkt, daß für den Käufer unbedingt der Eindruck entstehen muß, es handle sich um bekannte Markenerzeugnisse?«
»Ja! Wir können doch um Gottes willen nicht draufdrucken: Fabrikat Doktor Sill! — Aber ich kann Ihr Gewissen beruhigen. Ich weiß aus der Einsicht in die Akten, daß unser Chef Geheimabkommen mit den in Frage kommenden Werken getätigt hat. - Sehen Sie, hier die aufgedruckten schwarzen Zahlen ergeben für den Eingeweihten das Kennzeichen unserer Fabrikation. Die Abkommen garantieren den Firmen durch Mittelsleute geschickt zugestellte Deviseneinnahmen, und da halten die wenigen Werksdirektoren schon dicht, um sich eine derartige Einnahmequelle nicht entgehen zu lassen. Da überdies die Verträge gleichfalls durch Mittelsleute getätigt wurden, wissen selbst jene nicht, wo die Fabrikationsstelle sich befindet. — Alles bis ins letzte bedacht und glänzend eingefädelt!« Mingold rieb sich vergnügt die Hände.
Martin Damm fuhr sich nachdenklich durch seinen wilden Haarschopf, wie er es stets tat, wenn ein im Augenblick nicht zu lösendes Problem ihn beschäftigte. Als er aufschaute, trafen ihn die prüfenden Blicke Gisela Verweers.
›Kann ich nicht mehr logisch denken, oder bin ich zu leichtgläubig?‹ sann er und musterte das strahlende, runde Gesicht des ohne Zweifel geistig sehr regen Chemikers.
Selbst einen kleinen Kreis Profitgieriger ständig mit Lizenzabgaben zu versorgen, mußte doch im Laufe der Zeit zur Kenntnis eines größeren Kreises von Mitwissern führen, so, wie man einen Stein ins Wasser wirft und die kreisförmigen Wellen sich rasch, aber unhemmbar ausbreiten. Gegen solch elementare Wirkung half selbst die geschickteste Tarnung nicht.
»Tja!« plauderte Mingold weiter, »was die bis ins letzte ausgeklügelte Organisation anlangt, übertreffen die Maßnahmen Doktor Sills alles, was ich je erlebte, und das will schon etwas heißen, denn ich war früher in leitender Stellung in einem der größten Chemiekonzerne tätig!« Er rieb sich sichtlich zufrieden die Hände. »Vielleicht werfen wir rasch noch einen Blick in die Kläranlagen!« Er schritt voraus, und das Paar folgte. Wieder öffnete er eine Tür. Sie standen im anschließenden Raum vor gewaltigen Kesselanlagen.
»Hier mündet die Kanalisation der gesamten Siedlung. Die Fäkalien werden dort drüben in den Hochbehälter gepumpt, abgedampft und die stark konzentrierte Masse chemisch weiterverarbeitet. Um nur ein Beispiel zu nennen: Aus der anfallenden Harnsäure werden Schlafmittel ebenfalls für den Export hergestellt. Zuletzt bleibt reiner Zellstoff übrig, der vielfache Verwendung findet.«
Mingold ging auf einen der Kessel zu, öffnete eine Klappe und griff hinein. Auf der herausgezogenen Handmulde lag eine grauweiße, krümelige Masse.
»Bitte prüfen Sie, Herr Doktor Damm! — Völlig geruchfrei! Reinste Zellulose!«
Martin Damm überzeugte sich, daß, was die Geruchlosigkeit anbetraf, die Behauptung den Tatsachen entsprach. Chemie und Ekel, durchfuhr es ihn, ist nur etwas für Laien.
»Diese Zellulose wird in erster Linie zur Herstellung von Zeitungspapier benutzt. — Sie sehen, auch hier sind wir der Technik der übrigen Welt um einige Nasenlängen voraus. Wir benötigen allerdings, das will ich nicht verschweigen, Zellstoff zur Beimengung zu unseren künstlichen Nährstoffen. Doch dieser wird importiert. Magen und Darm des Menschen blieben auf die Dauer nicht funktionsfähig, würde man sie nur mit reinem Eiweiß und Fetten füttern. — So, und nun wollen wir die Fertigwarenfabrikation besichtigen!«
Wiederum ging Doktor Mingold behende voraus. Sie durchquerten einige Räume mit rätselhaften Apparaturen. Mingold schenkte ihnen keine Aufmerksamkeit.
Dann standen sie in einer strahlend erleuchteten Halle, deren Boden und Wände schneeweiß gekachelt waren. Aus weißem Leinen bestand die Arbeitskleidung, die die hier Tätigen umhüllte. Alle trugen sie auf den Köpfen gestärkte Mützen, die denen ähnelten, die Köche häufig in großen Gaststätten als Zeichen ihrer Würde aufgestülpt haben. Unvorstellbare Sauberkeit blitzte von Menschen und ruhelos summenden Maschinen.
Doktor Mingold steuerte der Schmalfront dieser sich zur gegenüberliegenden Seite konisch erweiternden Halle zu, deren Grundfläche etwa einem aufgespreizten Zirkel gleichkam.
Fließbänder liefen strahlenförmig auseinander.
»Hier aus der Wand führen die Rohre die verschiedenen Grundstoffe unserer Lebensmittel!« begann der Chemiker zu erläutern. »Je nach beabsichtigter Fabrikation werden sie in bestimmten Gewichtsanteilen auf den automatischen Waagen«, er deutete mit der Hand darauf, »abgewogen, dann hier in den Knetmaschinen gut durchgemischt. Die Rohmasse wird sofort von den Fließbändern aufgenommen und weitergeführt. An den einzelnen Arbeitsplätzen sehen Sie wiederum Waagen und dort auslaufende Rohrleitungen, die Würzstoffe und weitere Zutaten heranführen. Zehn Fließbänder sind dauernd im Betrieb. Wir stellen somit während eines einzigen Arbeitsganges stets zehn verschiedene Fertigprodukte her. In der Regel läuft ein Fabrikationsvorgang nur etwa zwei bis drei Stunden. Dann werden die automatischen Waagen am Anfang nach einem bestimmten Schema umgestellt, die Knetmaschinen ganz besonders gereinigt und nach etwa zehn Minuten, während denen jeder Arbeiter die ihm anvertrauten Geräte säubert, setzt eine neue Herstellungsserie ein. Auf diese Weise können die Hausfrauen täglich ihre Wahl zwischen rund vierzig verschiedenen Gerichten treffen. Die Grundzusammensetzung bleibt immer dieselbe, Fett, Eiweiß, Kohlehydrate und Zellulose. Die Geschmacksvarianten sind so zahllos, daß kein irdisches Restaurant etwas nur Ähnliches bieten könnte. Es gehört überdies zur Spezialität Herrn Doktor Sills, mit einem kleinen Stab von Mitarbeitern ständig neue Gerichte — man darf getrost sagen — zu erfinden. Wir wollen einmal dieses Fließband bis zum Ende verfolgen.«
——
»Hier zuerst vier automatische Waagen, die mit dem Verschlußhahn der Zuführungsleitungen gekuppelt sind. — Die Waageschalenkippvorrichtung zur Entleerung. — Wie Sie sehen, alles pulverisierte, dabei hochkonzentrierte Trockensubstanz. — Jetzt die Kneter und der geregelte Wasserzulauf. — Auspressung der Masse auf das Fließband. —« Sie folgten im Gänsemarsch dem Erläuternden. — »Ein neuer Kneter, Zugabe von Flüssigkeit, Fett und Würzstoffen. -Hier die Beimengung von feinen Bröseln. — Abermals ein Durchmischer. — Jetzt ein elektrischer Vorwärmer.« Das Band passierte einen kleinen Tunnel, ähnlich einer großen Backröhre. — »Nochmals Würzstoffe, Farbessenzen und Salze. — Ein Kneter. — Jetzt hier die Formpressen. Auch das Auge soll den Genuß steigern!«
Von links und rechts schoben sich nun Pappteller und Zellophanpapier an das gleichmäßig laufende Fließband heran. — »Die Glasurspritze!«
Dann sah Martin Damm, wie Hebelarme und drehende Bleche unheimlich rasch das Fertigprodukt ergriffen, in Zellophan einhüllten und auf die von unten auftauchenden Pappteller schoben. Menschenhände ergriffen diese und reihten sie auf dem Tisch am Ende des Fließbandes auf.
»Was ist das nun?« wollte Damm wissen und starrte voller Spannung auf die kreisrunde, etwa drei Zentimeter hohe Ware, die sich höchst appetitlich verpackt heranschob, um in Traggestellen zum Transport in das Kaufhaus eingestapelt zu werden.
»Die Hausfrau brät Buletten daraus, wie man in Berlin sagt. Sie schmecken genau wie Hamburger Beafsteak!« antwortete schmunzelnd Doktor Mingold.
»Teufel noch eins!« entfuhr es Martin Damm. »In knapp drei Minuten Gras, Rindvieh, Schlachthof, Metzgerei, Fleischwolf, Formgebung und Verpackung, alles überholt und künstlich aus den Grundstoffen hergestellt, das ist ein wenig viel für ein normales Fassungsvermögen. — Das ist mehr, als ich je erwartete! — Ich hatte mir doch alles viel primitiver vorgestellt.«
»Kann ich Ihnen nachfühlen!« Doktor Mingold lachte herzlich auf. »Was meinen Sie——.«
Ein leises Summen unterbrach den angefangenen Satz.
»Donnerwetter! — Schon Essenspause. — Ist der Vormittag rasch vergangen!« rief er. Dann überzog ein erwartungsfrohes Schmunzeln das runde, pfiffige Gesicht.
»Jetzt habe ich die besondere Ehre, Fräulein Verweer und Sie, Herr Doktor Damm, zu einen kleinen Imbiß einzuladen. Besonderer Auftrag von Herrn Doktor Sill! — Darf ich bitten, mir in mein Arbeitszimmer zu folgen?« Die listig blinzelnden Äuglein, die übertrieben untertänige Verbeugung ließen auf eine wohlvorbereitete Überraschung schließen.
Doktor Damm blickte sich im Davonschreiten noch einmal um. Er sah, wie den Arbeitern durch herbeieilende Mädchen Schälchen mit den bereits wohlbekannten weißen Tabletten und ein Glas orangegelber Flüssigkeit von fahrbaren Rolltischen dargeboten wurden. Sie schluckten die Pillen mit dem Saft und setzten Glas und Schale zurück. Die Fließbänder liefen weiter.
Als letzter verließ Damm die Halle und schloß hinter sich die Tür.
In Doktor Mingolds Zimmer war ein runder Tisch, den er vorher nicht wahrgenommen hatte, gedeckt. Der um seine Gäste rührend bemühte Gastgeber schob Gisela Verweer den Stuhl zurecht, komplimentierte mit fröhlichen Worten Doktor Damm auf den zweiten und nahm dann entgegen seiner sonstigen Art behäbig Platz, sofort ein Mundtuch auf den Knien ausbreitend.
Auf dem Tisch standen drei Kristallschalen. Drei darübergelegte Deckel, blütenüberhäuft, schimmerten nur an den Rändern silbern gleißend. Ein Kranz roter Rosen umsäumte die Schalen derart, daß auch von der Seite kein Einblick in den Inhalt möglich war.
»Meine lieben Gäste! — Verübeln Sie es mir bitte nicht, wenn ich bei meiner kurzen Rede sitzen bleibe. Pathetische Gesten liegen mir nun einmal nicht. Die geheimnisvolle Aufmachung wird Sie gewiß ahnen lassen, daß der Inhalt dieser drei Gefäße ganz besonderer Art sein muß. — Und so ist es in der Tat!«
Doktor Mingold hob die erste Silberplatte und streute vorsichtig die Blüten auf das Tischtuch.
»In den letzten Tagen gelang es unserem hochverehrten Chef, künstliches Röstbrot, gemeinhin Toast genannt, herzustellen. Es war ein schwieriges Problem. — Hier der greifbare Erfolg!« — Der begeisterte Redner hob den zweiten Deckel und ließ auch die darauf angehäuften Blüten in kreisender Bewegung auf den Tisch rinnen.
»Was Sie hier sehen, stammt nicht aus der harten Schwanzschale der so leckeren Meerestiere, vulgo Hummer genannt, sowie aus deren Panzerscheren, sondern wurde synthetisch zubereitet und in die dafür besonders angefertigten Formen gepreßt!«
Vor Martin Damms wahrhaft bestürzt dreinschauenden Augen häufte sich, täuschend ähnlich nachgemacht, das rosa Fleisch mit seinen charakteristischen Querstreifen von Hummerschwänzen und die saftroten zweispitzigen Keulen des Schereninhalts, denen ein so verlockender Duft entströmte, daß ihm das Wasser im Munde zusammenlief.
»Als dritte Überraschung!« Abermals verstreute Mingold fast feierlich die Blüten über das Linnen, »die erste hier hergestellte Majonnaise. Das Eigelb widerstand bis vor kurzem allen Angriffen der Synthese, hauptsächlich was den kernigen Geschmack anbetraf!«
Doktor Mingold legte die drei Deckel auf einen kleinen Nebentisch.
»Wir wollen feststellen, ob der leckere Anblick den Gaumen auch nicht enttäuscht. — Fräulein Verweer, darf ich Sie bitten, den Anfang zu machen!«
Der Gastgeber reichte ihr die mit Hummer gefüllte Schale. Mit raschem Griff legte er das Besteck auf den Inhalt.
»Herr Doktor Damm!« Auch dieser nahm, und jetzt bediente sich Mingold selber, während Gisela Verweer bereits der Majonnaise zusprach und nach einer der knusprigen Toastschnitten langte.
Sie reichte beide Schalen an ihren Nachbarn, Doktor Damm, weiter, ohne ein Wort, ohne aufzuschauen.
In seiner lebhaften Art unterbrach Mingold das vorgenießende Schweigen:
»Ich habe absichtlich Hummer und Majonnaise nicht mischen lassen, wie es sonst üblich ist, denn erstens mögen das viele nicht, und zweitens gilt es ja, den Geschmack der einzelnen Gerichte zu verkosten und festzustellen, inwieweit das Experiment als gelungen zu betrachten ist. — Auf denn, zum fröhlichen Schmausen! Ich wünsche guten Appetit!«
Fast gleichzeitig stachen drei Frühstücksgabeln auf das verlockende Fleisch und führten die Bissen zum Munde.
Martin Damm schüttelte von Staunen ergriffen den Kopf:
»Das ist einfach toll! — Ganz unfaßbar! — Sie wollen mich wohl zum Besten halten, verehrter Doktor Mingold. — Nie und nimmer kann das synthetischer Hummer sein! — Die naturechte Faserigkeit des Fleisches, die Körnigkeit, der geradezu frappant frische Geschmack!« Die Zunge tastete gegen den Gaumen, auch die letzten Feinheiten auszukosten.
»Ach, Sie Geologe!« lachte der Gastgeber. »Von Zoologie natürlich keine Ahnung, sonst dürfte Ihnen bekannt sein, daß im Indischen Ozean Hummer nicht vorkommen!«
»Gewiß, gewiß!« meinte Damm heiter. »Weiß der Kuckuck, wie Sie die Viecher hier herbekommen haben! — Daß die Künste Doktor Sills aber schon so weit fortgeschritten sind — verzeihen Sie, wenn ich das so offen ausdrücke —, das will mir nun doch nicht in den Kopf!«
»Aber mit großem Genuß in den Mund!« abermals lachte Doktor Mingold, jetzt in fast seliger Verzückung.
»Kann ich nicht leugnen!« antwortete Damm genießerisch. Seine Gabel glitt in die goldschimmernde Majonnaise, um auch diese zu erproben. »Schmeckt ganz vorzüglich, einfach herrlich!«
»Völlig echt! — Nicht zu unterscheiden von wirklicher Majonnaise! — Bei allen Göttern, eine chemische Meisterleistung!«
»Und Sie, Fräulein Verweer?« begehrte Doktor Mingold zu wissen.
»Ich bin schon an mancherlei gewöhnt. — Dieser Imbiß verschlägt aber auch mir die Sprache!«
»Sehen Sie, sehen Sie! — Eine glänzend gelungene Überraschung. — Nachdem Ihnen unser verehrter Chef bereits gestern abend ein Galasouper neuer Gerichte vorgesetzt hat, überließ er mir die Ehre und das Vergnügen, Sie heute bei mir mit dem dernier cri unserer Schöpfungen ein wenig aus der Fassung zu bringen, und — das dürfte wohl gelungen sein!«
»Kann man mit Fug behaupten!« bestätigte Martin Damm, sich eine neue Portion auf den Teller legend.
»Um Gottes willen, jetzt habe ich vor lauter Glückseligkeit und Überrumpelungsfieber den Sekt vergessen!« entschuldigte sich aufgebracht Mingold, holte das Versäumte aber sogleich nach, indem er eine Champagnerflasche aus dem neben ihm stehenden Eiskübel zog, sie rasch abtrocknete und unter drehender Bewegung den Korken herauszog.
Gisela Verweer ergriff unaufgefordert die Kelche von dem kleinen Nebentisch und setzte sie zurecht. Mingold goß das schäumend perlende Naß ein. Kleine Bläschen stiegen vom Grunde der Schalen auf und zerstoben an der Oberfläche.
»Ich heiße Sie, als unseren verehrten Gast, mein lieber Doktor Damm, besonders herzlich in der mir unterstehenden Abteilung der Sill-Siedlung willkommen!« lautete der Trinkspruch. Drei Kelche stießen klingend zusammen.
»Ebenfalls ganz ausgezeichnet!« meinte Martin Damm versonnen und tat noch einen Schluck. »Wie heißt die Marke?«
»S 52, unser Spitzenprodukt!«
»Na, ja! — Ich ergebe mich in mein Schicksal!« lächelte in leisem Verzicht Damm, als er das Glas zurücksetzte. »Wie lautet denn Ihre Bezeichnung für den köstlichen Hummer?«
»H312! — Sie ersehen aus der hohen Hausnummer die Anzahl der Versuche!« erläuterte mitteilungseifrig Doktor Mingold. »Fräulein Verweer! — Sie sind so schweigsam heute!« wandte sich der Gastgeber plötzlich seinem Gegenüber zu.
Gisela blickte erst Mingold, dann ihren Nachbarn an.
»War ich das?« fragte sie langsam. »Ich will's wieder gutmachen! — Sehr zum Wohl, meine Herren!« Sie führte das Glas zu den Lippen. »Ich war lange nicht mehr bei Ihnen, da hat auch mich der Ausbau der Abteilung in mancherlei Hinsicht überrascht, Doktor Mingold!« Jetzt erst trank sie hastig zwei kleine Schlucke.
»Am meisten wohl die merkwürdige Exportfabrikation«, sann Martin Damm und hatte damit tatsächlich das Richtige getroffen.
Erst als das Essen fast beendet war, kam eine ungezwungene heitere Unterhaltung zustande, für die nicht zuletzt der vorzügliche Champagner verantwortlich zeichnete. Sowohl Gisela Verweer als besonders Martin Damm stellten vielerlei Fragen, die von Doktor Mingold bereitwillig, häufig in begeisterten Redewendungen, beantwortet wurden.
»Wenn Sie noch die Kraftanlage besichtigen wollen, dann wird es langsam Zeit! Heute ist Samstag! — Wir machen früher Schluß. Verzeihen Sie bitte diesen Hinweis. Ich bedauere aufrichtig, daß——.« Mingold konnte den Satz nicht zu Ende führen.
»Wahrhaftig schon halb zwei!« rief Martin Damm. »Allerdings höchste Zeit!«
Gisela Verweer erhob sich:
»Gesegnete Mahlzeit!« Man reichte sich im Kreis die Hände.
»Also dann nichts als los!« Schon war Mingold an der Tür angelangt und öffnete sie mit fröhlicher Geste.
»Ich muß Ihnen mein aufrichtiges Kompliment machen und mein uneingeschränktes Lob zollen!« sagte draußen auf dem Gang Martin Damm zu Doktor Mingold. »Sowohl was Ihre Abteilung anbetrifft, als auch den selbst in den kühnsten Träumen nie erwarteten delikaten Imbiß aus Ihrer Zauberküche! Was ich heute erlebte, grenzt schon an Hexerei!«
Mingold wehrte das Lob bescheiden, doch sichtlich zufrieden ab.
Nach kurzem Weg standen sie in der Kraftzentrale.
»Ist Oberingenieur Murrstedt nicht da?« rief Doktor Mingold in das hohe Singen der Turbinen und Generatoren einem Arbeiter zu.
»Augenblick bitte!« schallte es zurück. Dann eilte der Rufer einer Schalttafel zu. Dreimal schnarrte ein Signalhorn.
»Aha! Da kommt er schon!« Mingold wies auf einen Glasverschlag, in dessen Türrahmen die große Gestalt des Gesuchten erschien.
Der Vorstellung des Gastes folgte ein kräftiger Händedruck des Hünen.
»Dann darf ich mich wohl verabschieden«, sagte der Chefchemiker. »Hier ist mein Reich zu Ende!«
Martin Damm bedankte sich nochmals herzlich, dann wandte sich Dr. Mingold rasch dem Ausgang zu.
Sogleich begann Murrstedt seine Erläuterung. Er wies zunächst auf die asbestisolierten drei starken Rohre, die den Dampf aus der Geisirquelle führten und drei generatorengekuppelte Turbinen speisten. Der Dampf enthalte so geringfügige Mengen mitgerissener Salzteilchen, daß er, ohne den Turbinen zu schaden, sofort ausgenutzt werden könne. Als Kühlwasser für die Kondensatoren würde aufgepumptes Meerwasser benutzt. Im eingeschränkten Nachtbetrieb würden ausreichende Dampfmengen kondensiert und als Trinkwasser den Druckbehältern zugeführt, die die gesamte Siedlung wie die Chemieabteilung versorgten.
Sie besichtigten die ausgedehnten Kondensationsanlagen und in einer anschließenden Halle zehn mächtige Stahltürme, die Trinkwasserbehälter.
Im Gegensatz zu Doktor Mingold sprach der leitende Oberingenieur trocken und sehr sachlich.
Seiner harten Aussprache nach zu urteilen, schien er Baltendeutscher zu sein.
Im Nebenraum zeigte Murrstedt die stampfenden Kompressoren der Tiefkühlanlagen zur Luftverflüssigung zwecks Stickstoff- und Sauerstoffgewinnung. Eine Vielzahl vereister Röhren durchquerten den Raum. Gasometerartige Kolosse standen längs der Wand.
Es folgte eine nur niedrige Halle. Viele elektrische Kabel verzweigten sich zu in dem Boden eingelassenen Trögen, die fest verschlossen waren. Rote und gelbe Rohrleitungen ragten aus diesen heraus und schwenkten an der Decke zu weiteren Gasometern. »Wasserstoff- und Sauerstoffgewinnung vermittels Elektrolyse«, erläuterte der Ingenieur.
Zuletzt besichtigten sie die Klimaanlagen der Felssiedlung. Die von draußen angesaugte Luft wurde hier filtriert, durch Erhitzen über mit Elektrizität gespeisten Heizspiralen keimfrei gemacht, die überschüssige Wärme der Luft ausgenutzt, um die verflüssigten Gase der Tiefkühltrennungsanlage auf normale Temperatur zu bringen. Tagsüber versorgte man die Siedlung mit Luft von zwanzig Grad Celsius, des nachts mit zwölf Grad, um einen gesunden Schlaf zu gewährleisten. Die verbrauchte Atemluft wurde oberhalb der künstlichen Sonne, die eine natürliche Zirkulation bewirkte, aufgefangen und ins Freie abgepreßt.
Martin Damm war auf vieles gefaßt gewesen; was er jetzt als glänzend durchdachte und ausgeführte technische Leistung sah, überstieg selbst utopische Phantasmagorien. Wo hatte Sill nur das Geld hergenommen, denn sein Werk mußte Unsummen verschlungen haben, bis es zu diesen Ausmaßen angewachsen war. Und alles nur seiner Experimente wegen, die er angeblich in einigen Jahren aufgeben wollte? Zweifel stiegen hoch.
Sie kehrten zum Ausgangspunkt ihres Rundganges zurück, der Turbinenhalle. Eingehend musterte Martin Damm nun die Schalttafeln. Hier war er auf alle Fälle als Physiker Fachmann. Nichts daran auszusetzen! Die Relais, vollautomatische Regler und Schalter, entsprachen modernster Bauart. Wie hatte man das alles nur hierhertransportieren und installieren können? Die Rätsel türmten sich zu Bergen. Eine Tatsache allerdings überragte alles Grübeln und Sinnen: Dieser Sill war bei allem Fanatismus, mit dem er seine Ideen durchführte, ein Genie, ein viel gefährlicheres Genie als die harmlosen Abendplaudereien erwarten ließen. Hier sprachen Taten eine sehr eindeutige und harte Sprache.
Während Doktor Damm noch einige Einzelheiten an der Schalttafel prüfte, sprach Murrstedt mit Gisela Verweer. Ein tiefes Summen durchdrang die Halle.
»Feierabend!« ertönte von irgendwoher eine Männerstimme.
Damm trat zu den beiden und gab seiner unverhohlenen Genugtuung über die technischen Anlagen, sowie seinem Dank für die Führung Ausdruck. Unter den lobenden Worten erhellte sich das bisher etwas bärbeißige Gesicht des Oberingenieurs.
»Hat auch verdammt viel Arbeit gekostet. Warr einer derr errsten hierr!« knurrte Murrstedt, und die baltischen R's rollten vernehmbar.
»Sie sind also zufrieden hier und glücklich?« fragte Damm harmlos.
»Serr! — Will es nie besser haben!«
Mit voller Überzeugung dröhnten die Worte aus dem mächtigen Brustkasten des Hünen.
Sie verabschiedeten sich mit herzlichem Handschlag. Murrstedt geleitete sie noch bis zur Türe auf den Gang, beugte sich über Gisela Verweers Rechte zu einem angedeuteten Handkuß und verneigte sich leicht vor Martin Damm.
Das Paar schritt schweigsam durch die herrliche Eingangshalle. Weit geöffnet standen jetzt die Pforten, aus denen bereits die ersten Arbeiter ihren Heimen zustrebten.
Sie bogen rechts zum Aufzug ab, dessen Führer sie schon erwartete und während der Fahrt Doktor Damm freimütig, doch keinesfalls aufdringlich, nach seinen Eindrücken befragte. Mit den Worten »Angenehmen Sonntag« schloß er hinter den Davonschreitenden oben die Gittertüre und fuhr wieder hinab.
»Ein eindrucksvoller Tag!« sagte Gisela Verweer. »Auch für mich!«
»Ja!« entgegnete Martin Damm, ihr den Kopf zuwendend. »Und was haben Sie jetzt vor?«
Sie schaute ihn unbefangen an.
»Erst mich ein bisserl schön machen. Dauert etwa eine Viertelstunde. Dann können wir uns in der gemütlichen Ecke im Eßzimmer zu einer Tasse Tee treffen, und Sie erzählen mir einmal von Ihren Abenteuern nach Ihrer Notlandung. — Einverstanden?«
»Sehr sogar! — Ich gestehe offen, daß ich nur ungern alleine geblieben wäre.«
Seine Begleiterin nickte nur, als ob sie volles Verständnis für seine seelische Verfassung nach der Vielfalt des Geschehenen und Erlebten habe.
»Also bis gleich dann!«
Als Martin Damm sein Zimmer betreten hatte, entledigte er sich des Overalls und warf sich lang auf sein Bett, die Glieder entspannt ausstreckend. In seinen mit aller Gewalt über ihn hereinbrechenden Grübeleien hätte er fast die Zeit vergessen, die Verabredung pünktlich einzuhalten.
Den folgenden Sonntag verbrachte Martin Damm allein, meist in dem an sein Schlafzimmer anschließenden neu eingerichteten Arbeitsraum. Reißbrettgestelle standen längs der einen Wand, während eine kleine Werkbank und das erforderliche Zubehör, Meßinstrumente und provisorisch verlegte Kabel die Ausrüstung ergänzten. Auf den Reißbrettern spannten sich Grundrisse der Daumeninsel, der Siedlung und Betriebsanlagen, die Sill früher schon einmal hatte anfertigen lassen. Sie sollten der Eintragung der Lotungsergebnisse dienen, während die technische Einrichtung für eventuelle Reparaturen der Peilsonde bestimmt waren. Auf beschränktem Raum entsprach alles wohldurchdachter Zweckmäßigkeit.
Am vorhergehenden Abend hatte Sill telefonisch sein Fernbleiben entschuldigt. Er sei einer neuen Entdeckung auf der Spur. In solch arbeitsbesessenem Zustand sei er ein zu zerstreuter Gesellschafter, und die Blöße, seinen Gast zu langweilen, wolle er sich nicht geben. Er bäte um freundliches Verständnis.
So saßen denn nach dem gemeinschaftlichen Abendessen Gisela Verweer und Doktor Damm allein in der Plauderecke, doch bestritt der Doktor fast ausschließlich die Unterhaltung durch seinen Bericht über die ersten Erlebnisse und Eindrücke auf dem Felseneiland. Erst, als er auf Befragen von seiner Tätigkeit als Geologe in verschiedenen Teilen des Erdenrunds erzählte, taute Fräulein Verweer sichtlich auf und zeigte starke Anteilnahme und Wißbegier. Wie einem geheimen beiderseitigen Übereinkommen folgend, wurden die Ereignisse des vergangenen Tages nicht berührt. Damm glaubte zu fühlen, daß seit jener Episode vor der umgearbeiteten Einschußöffnung in der Tragfläche des Flugzeuges, seit Gisela Verweers seltsamer Antwort, ihre Beziehungen sich gewandelt hatten, oder trug sein prüfendes Abwägen ihrer Worte die Schuld?
Undurchdringbar, unnahbar blieb dieses Mädchen wie eine Frau mit sehr großer Lebensreife. Und wie alt konnte sie schon sein? Ende Zwanzig etwa, mehr gewiß nicht! Zwischen Betragen und Alter bestand eine Kluft, die nach Martin Damms sich mehr und mehr vertiefender Einsicht nur als eine ungewöhnliche Selbstbeherrschung gedeutet werden konnte.
Anton hatte, offenbar auf Weisung Sills, eine reichliche Auswahl von Getränken in Griffweite zurechtgestellt, doch kam Damm wenig dazu, das Glas seiner Partnerin zu füllen. Er selbst legte sich keine Beschränkung auf. Zu stark machte sich bereits die Gewohnheit, mit Sill abends ein wenig zu zechen, bemerkbar. Schon vor Mitternacht verabschiedete sich Gisela Verweer. Doch Damm blieb. Es gab genug zu durchdenken.
Daß Sill ihn nach solchen Einblicken in seine Geheimnisse, wie sie ihm heute geboten worden waren, freiwillig ziehen lassen würde, war völlig unwahrscheinlich. Diese Erkenntnis schälte sich immer klarer heraus.
Soviel Vertrauen in seine — Damms — Verschwiegenheit zu setzen, konnte nie und nimmer der Art eines Menschen entsprechen, der ein solches Werk errichtet hatte. Zudem -was sich hier anspann, zielte auf eine Revolution der Menschheit ab. Die Daumeninsel stellte nur die Keimzelle dar.
Schon die höchst fragwürdige Exportabteilung bewies das eindeutig. Auch an dieser sich immer schärfer herauskristallisierenden Erkenntnis gab es nun keine Zweifel mehr. Das umgearbeitete Einschußloch, das, den wahren verbrecherischen Begebenheiten entgegen, einen naiv harmlosen Eindruck vermitteln sollte, redete eine zu eindeutige Sprache. Sein Schicksal war auf Gedeih und Verderb mit dem der Siedler verbunden. Flucht!
Doch wie konnte er sie anstellen? Nicht einen einzigen Weg aus diesem Felsenlabyrinth kannte er, und selbst, wenn auf den Karten in seinem Arbeitsraum Ausgänge eingezeichnet wären, sie wären genau so raffiniert gesichert wie die gesamte Anlage.
Und dann? Ohne jegliche Hilfsmittel, Boot und Proviant, irgendwo Land erreichen? — Absurde Vorstellung!
Sill täuschen, täuschen und nochmals täuschen, bis sich vielleicht doch eine günstige Gelegenheit bot.
Ein elendes Abwarten stand ihm bevor. Wenn er sich nur mit einem einzigen vertrauenswürdigen Menschen hätte aussprechen können! Die er bis jetzt kennengelernt hatte, schieden allesamt aus, denn sie waren von der Sillschen Propaganda, das war wohl das richtige Wort dafür, völlig chloroformiert.
Gisela Verweer?
Verstellte sie sich genau so wie er? Bot sich unter solchen Gesichtspunkten eine Lösung für ihre, wie er glaubte, nicht widerspruchsfreie Wesensart? Nun — die gemeinsame Arbeit mußte sie einander näher bringen. Also auch hier abwarten, abwarten!
Sill töten! Wie ein wütender, blutroter Rausch überfiel ihn dieser Gedanke. — Nein! — Verbrecherisch und obendrein sinnlos. Jener verfügte gewiß über eine ihm, Damm, noch unbekannte Geheimgarde treuester Anhänger, die wahnbesessen sich an dem Mörder rächen, das Werk selbst aber fortsetzen würden. Tarnung lautete sein Geschick, und damit hieß es sich zunächst abfinden. Allein war er machtlos!
Doktor Martin Damm wollte nicht wissen, was die Uhr zeigte, als er endlich aufstand und sein Schlafzimmer aufsuchte.
Der Sonntag brachte eine Überraschung. Auf dem Frühstückstisch fand er einen Zettel Gisela Verweers: ›Doktor Sill hat mich benachrichtigt, daß er seine Arbeit noch nicht abgebrochen habe. Ich selbst soll meinem Nachfolger im Dienst an der künstlichen Sonne noch einmal assistieren. Es klappt noch nicht alles, wie es soll. Das Abendessen wird uns wieder vereinen! Anton sorgt für Sie. G. V.‹
Die Anfangsbuchstaben ihres Namens standen da höchst unpersönlich als Unterschrift.
Die Sätze waren in Eile geschrieben. Das behagte Martin Damm offensichtlich. Er steckte das Blatt wie ein kostbares Dokument in die Brieftasche, da der Diener nahte.
Nach dem ungewöhnlich rasch eingenommenen Frühstück begab er sich in sein Arbeitszimmer. Dort konnte er sich ungestört seinem Vorhaben widmen.
Er zog den Stuhl näher, legte das beschriebene Papier auf den Tisch und vertiefte sich in die Schriftzüge, als ob es gälte, Hieroglyphen von unschätzbarem Wert zu entziffern.
Während seiner Studienzeit hatte er einem Dozenten nahegestanden, der ein ausgezeichneter Graphologe war. Damm war ein gelehriger Schüler gewesen und hatte später im Leben manchen Vorsprung aus der Deutung von Handschriften gewonnen.
Und jetzt offenbarte sich ihm Gisela Verweer, ohne es zu wollen. Gerade daß die Schrift ungekünstelt, einem eiligen Impuls ihren Ursprung verdankte, machte sie so geeignet zur Charakteranalyse bis zu feinsten Einzelheiten.
Eine gute Viertelstunde mochte vergangen sein, da schob Martin Damm das Blatt zur Seite. Es sah aus, als ob er etwas Gleichgültiges achtlos vergessen habe.
Die anfangs so bubenhaft zur Schau getragene Überlistung, die seine Gesichtszüge umspielte, überschattete zunehmende Verbitterung.
Dann stand er, vor sich hingrübelnd, auf und beschäftigte sich, nur um die Zeit totzuschlagen, mit seiner Peilsonde.
Später studierte er eingehend die Darstellungen und Zeichnungen auf den Reißbrettern. Wie er im stillen befürchtet hatte, boten sie keinerlei Anhaltspunkte über die Gesamtanlage. Nur der Grundriß der Insel — in Meereshöhe aufgenommen — stellte offenbar eine peinlich exakte kartographische Arbeit dar. Sill lieferte ihm augenscheinlich nur die Unterlagen, die zur Durchführung der geforderten Tätigkeit unbedingt unentbehrlich waren.
Nach Tisch vertiefte sich Martin Damm in die Zeitungen, die er in einem Fach des Bücherschranks entdeckte. Er mußte die gesamte Zergliederungskraft seines Verstandes zusammennehmen, um nicht der suggestiven Wirkung dieser Blätter zu verfallen.
Gegen fünfzehn Uhr erschien der Diener Anton und erlaubte sich, wie er sehr höflich bemerkte, Herrn Doktor Damm darauf aufmerksam machen zu dürfen, daß in wenigen Minuten der entscheidende Fußballkampf zwischen »Rot« und »Blau« ausgetragen würde. Ob Herr Doktor Damm vielleicht Interesse habe, dieses Spiel von der Galerie aus zu verfolgen.
›Warum nicht‹, dachte Damm. Je mehr er von der Lebensweise der Stadt unter dem Felsendom erfuhr, desto besser konnte er später solche an sich gewiß unbedeutenden Erlebnisse ausnutzen.
Er durchmaß den Gang und stand bald vor der Brüstung.
Tief unter ihm zogen sich die Straßen, kuschelten sich die kleinen Häuschen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Bildes lag der Sportplatz. Ameisengleich umsäumten ihn die Zuschauer. Die gesamte Siedlung schien an den sportlichen Ereignissen teilzunehmen.
Ein Räuspern riß Damm aus seinem Sinnen. Anton entschuldigte sich, den Feldstecher nicht sogleich gefunden zu haben, und überreichte ein handliches Prismenglas.
»Aus dieser Höhe können Herr Doktor das Spiel mit bloßem Auge sonst schlecht verfolgen!« meinte er und zog sich sofort zurück. Martin Damm wollte ihm noch nachrufen, ob er nicht selbst Interesse habe zuzuschauen. Doch die Tür hatte sich hinter ihm schon geschlossen.
Nach kurzem Einstellen der Gläser war das Bild klar und scharf gezeichnet. Damm hatte Muße, die gesamte Anlage unter sich in Ruhe eingehend zu mustern.
Und plötzlich überkam ihn ein Gefühl, zu den auserwählten Göttern zu gehören, selbst ein Gott zu sein im Vergleich mit jenen dort unten, dem Volk. Wie eine Himmelsleiter verband sie nur der Aufzug. Wahrlich genial ausgesonnen! Die Bauweise ermöglichte Sill, sein Privatleben vor den von ihm Beherrschten restlos zu verschleiern. Ihren Blicken entzogen thronte er unnahbar in seinem Olymp, leitete das Geschick der Ameisen dort unten nach seinem Willen. Wie ein Gott, dem Verehrung geziemt und vertrauensvolle Liebe.
Die bisher erlebten Tatsachen sprachen dafür, daß blinde Hingebung und Glauben an die übernatürliche Einmaligkeit seines Genies die Ahnungslosen beseelte.
Der Götter Glorie schwindet leicht, wenn sie des Menschen Hand betastet!
Dieser Erkenntnis schien sich der Herr der Insel wohl bewußt zu sein. Und die Nebengötter — Damm mußte sich jetzt selber dazu rechnen — durften für einige Stunden Boten des Unerreichbaren spielen! Eine entrückte Welt des Wahns trotz ihrer erschütternd menschennahen Wirklichkeit.
Der stille Beobachter wurde sich in dieser Stunde auch über sein eigenes Schicksal klar. Die dort unten kannten ihn nur als Gast. Würde er eines Tages nicht mehr auftauchen, so war der »berühmte Gast« nach Erfüllung »seiner Aufgabe« eben wieder abgereist, so stände es zumindest in der Inselzeitung. Sein wahres Geschick dürfte sich wohl anders gestalten, wenn er es nicht verstand, sich unentbehrlich zu machen.
Widerwillig schüttelte er die peinigenden Gedanken ab.
Das Spiel hatte noch nicht begonnen. Woraus bestand nur der Untergrund des Sportplatzes? Er betrachtete angelegentlich das menschenumsäumte Feld durch das vorzügliche Fernglas. Das war kein Asphalt, ähnelte stark einer riesigen Matte aus Faserstoff. Weiß der Kuckuck, was Sill da wieder gezaubert hatte!
Das Glas tastete die Felswand aufwärts immer höher. Jetzt erkannte er, daß die künstliche Sonne, in deren grelle Strahlen zu geraten er sorgsam vermied, nicht an der Kuppel des Felsendomes hing, sondern an einer über ihr eingezogenen Betondecke, deren Stahlträger an einigen Stellen deutlich hervortraten. Nach der Fläche der Decke zu urteilen, mochten da oben noch gut und gern zwei bis drei Stockwerke Platz haben, vorausgesetzt, daß die Felswände auch hier innen so gleichmäßig zusammenliefen, wie der daumenähnliche Anblick von außen es dartat. Und in dem obersten Raum dürfte sich wohl der Geschützstand befinden, aus dem der verderbenbringende Schuß sein Flugzeug getroffen hatte, lautete die naheliegende Folgerung, die Damm aus den soeben entdeckten Tatsachen zog.
Anschwellender Lärm ließ ihn das Glas auf das Spielfeld zurückrichten.
Die Mannschaften nahmen ihre Plätze ein. Ein kaum vernehmbarer Pfiff des Schiedsrichters. Der Kampf begann, mit einer nie erwarteten Heftigkeit. Um Fußball hatte sich Martin Damm herzlich wenig gekümmert, doch mußte er mit immer reger werdender Anteilnahme feststellen, daß dort unten sehr schnell, hart und doch überaus fair gerungen wurde. Bald fiel unter tosenden Jubelrufen das erste Tor für »Blau«! Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zur Halbzeit. Erst kurz vor Spielschluß gelang »Rot« der Siegestreffer.
Der einsame Zuschauer hatte, das Glas vor den Augen, nicht einen Augenblick Langeweile empfunden.
Jetzt strömten die Ameisen ihren Bauten zu. Diskutierende Gruppen ballten sich zusammen, lösten sich wieder auf. Der Spielverlauf schien die Gemüter stark zu beschäftigen. Leerer und leerer wurden die Straßen, nur Kinder tummelten sich noch dort.
Panem et circenses! sann Martin Damm. Gebet dem Volke Brot und Spiele! Schon die alten Römer kannten diese staatserhaltende Weisheit.
Ein Sonntagnachmittag unter der Felsenglocke.
Frösteln überlief Martin Damm, als er sich abwandte und sein Zimmer aufsuchte.
Als Doktor Sill zum Abendessen erschien, glaubte Martin Damm deutlich die Spuren der langen Arbeit festzustellen. Dann strahlten plötzlich die Augen Sills in warmer Wiedersehensfreude, der Zug der Abspannung in den Mienen verlosch schlagartig.
»Gisela! — Darf ich dir eine kleine Entschädigung für den traurigen Sonntag überreichen!«
Dann begrüßte er Damm mit einem kräftigen Handschlag.
»Oh! Eine Schachtel von deinen schönsten Pralinen!« meinte Gisela Verweer lächelnd. »Ich danke dir, Jose, für deine Aufmerksamkeit. Sehen Sie, Doktor Damm!« sagte sie, sich ihm zuwendend. »So hält er mich immer bei der Stange, wenn Außergewöhnliches in meine private Sphäre eingreift. — Sie dürfen nachher einmal eine Kostprobe nehmen. Einstweilen genieße ich allein den Vorzug solcher Leckereien!«
»Ja! Die Massenproduktion stößt noch auf einige Schwierigkeiten«, warf Sill ein, der bereits hinter seinem Stuhl stand.
Rasch legte Gisela Verweer den Karton beiseite und nahm am Eßtisch Platz. Die beiden Männer setzten sich nach einer kurzen Spanne höflichen Abwartens.
Sofort begann Sill zu reden.
Doktor Damm hörte zerstreut zu. Was bedeutete denn die Weglassung der sonst üblichen kleinen Zärtlichkeiten, mit denen Sill bisher seine Privatsekretärin bedacht hatte? Gisela Verweer schien von der Änderung keine Notiz zu nehmen. Doch kurz nach dem Abendessen bat sie, sich zurückziehen zu dürfen, die beiden Herren hätten gewiß viel zu bereden, und sie selbst fühle sich ein wenig abgespannt.
Nach einigen Worten ehrlichen Bedauerns beugte sich Sill flüchtig über ihre Hand.
»Es tut mir wirklich leid, daß du uns schon verlassen willst! — Gute Nacht, Gisela!«
»Gute Nacht, Jose — Gute Nacht, Herr Doktor Damm!«
Als die zwei Männer allein waren, warf sich Sill aufatmend in einen der beiden Klubsessel. Gerade trug Anton das Geschirr hinaus.
»Mich entzückt immer aufs neue, welches Verständnis dieses tapfere Mädel meinen oft bösen Launen entgegenbringt. — Anton!« Das schon bekannte hastige Händeklatschen verstärkte den Ruf.
»Ich komme sofort!« ertönte die Antwort aus dem Nebenraum, und schon schob der Diener eilfertig den kleinen Getränkewagen heran.
»Es ist gut so, Anton! — Für heute abend sind Sie beurlaubt! — Nein, bitte hierherstellen, neben Doktor Damm und mich.« Sill griff, sich vorbeugend, selbst zu, den Wagen auf den gewünschten Platz zu rollen.
»So!« sagte er nur.
Der Diener Anton schob mit unwahrscheinlicher Schnelligkeit die Untersätze auf den Tisch, setzte die Gläser darauf und verließ nach einer raschen Verbeugung den Raum.
»So!« sagte Sill abermals, »bedienen Sie sich bitte, lieber Damm, ganz nach Ihrem Belieben. — Ich ziehe meine Hausmarke vor, das kennen Sie ja bereits.« Er langte zu einer Flasche und goß sich ein.
Damm wählte einen Genever.
»Prost!« Mit einem Zuge leerte Sill das Glas, füllte es aber sofort wieder und trank genau so hastig.
»Gott sei Dank! — Jetzt fühle ich mich wohler. — Hab mir die Nacht und heute den Tag über doch wohl etwas zu viel zugemutet. Hat sich aber gelohnt! — Endlich ist mir ein Experiment gelungen, das bisher stets fehlschlug!«
Er goß sich ein drittes Glas ein, hielt es abwartend, wie in stiller Aufforderung, in der angehobenen Rechten, bis auch sein Gast sich erneut bedient hatte.
»Prosit! Trinken wir auf diesen Erfolg!« Sills Augen brannten in heißer Genugtuung.
»Ich beglückwünsche Sie! — Sehr zum Wohle!« entgegnete in herzlicher Anteilnahme Doktor Damm.
Als die geleerten Kelche wieder auf ihren Untersätzen standen, hub Sill an.
»Ich will Sie jetzt nicht mit weitschweifigen Erklärungen behelligen, welches Ziel ich mit den neu gelungenen Versuchen verfolgte. Es ist auch besser, wenn ich mich etwas ablenke. Bitte erzählen Sie mir doch, lieber Damm, von Ihren Eindrücken gestern im Werk. Ich möchte einmal ein objektives Urteil von einem hören, der bisher außen stand. Berichten Sie frank und frei von der Leber weg. — Auch Kritik!« setzte er, sich wohlig zurücklehnend, hinzu.
Es währte über eine Stunde, bis Martin Damm in sehr geschickter Darstellung der Wißbegier des Herrn der Insel Genüge getan hatte.
»Unsere Exportabteilung stieß Sie nicht vor den Kopf?« begehrte Sill nach kurzem Schweigen plötzlich zu wissen.
»Doch!« sagte Damm ruhig.
»Ihre verblüffende Aufrichtigkeit setzt mich immer wieder in Staunen!« lachte Sill. »Und die Zusammenhänge, wie deuten Sie die?« Sill beugte sich interessiert vor. In seinem Blick lag etwas Lauerndes.
›Jetzt gilt's‹, dachte Damm.
»Ihnen geht es weniger um den Geldgewinn, den Ihre Medikamente abwerfen, als um die Anknüpfung von weitverzweigten Handelsbeziehungen, um dann eines Tages das wohlorganisierte Netz zum Absatz Ihrer synthetischen Energiepräparate auszunutzen. Kurz gesagt: systematisch den Weltmarkt zu erobern!«
Sill starrte mit weit aufgerissenen Augen den kühnen Sprecher an.
Dann geschah etwas völlig Unerwartetes.
Mit einem jähen Sprung schnellte Sill vor, warf sich über Damm, riß, bevor dieser zur Besinnung kam, dessen Kopf an seine Brust und — bedeckte das umklammerte Haupt mit stürmischen Küssen.
Fassungslos ließ Damm den leidenschaftlichen Gefühlsausbruch über sich ergehen. Vor Sekunden wähnte er noch, in dieser bärenstarken Umschlingung erwürgt zu werden, und jetzt..........?
Schluchzen ertönte über seinen Ohren. Sill hatte die Wange in seine Haare gepreßt, Damm fühlte, wie warme Tränen auf seine Stirn tropften.
»Damm! — Martin Damm! — Endlich — ein Mensch der — mich versteht!«
Ein Weinkrampf schüttelte Sill, kurz, heftig. Dann sprang er auf, den inbrünstigen Griff lockernd, verbarg sein Gesicht mit verbissener Scham in dem aus der Brusttasche gerissenen Seidentuch und nahm hinter dem Rücken Damms einen ruhelosen Lauf zwischen den seine Bahn begrenzenden Wänden auf.
Martin Damm wischte sich Sills Tränen von der Stirn und fühlte, daß seine Haut feucht war.
Dieser Überfall war so elementar gewesen, daß selbst starke Nerven darauf mit einem Schweißausbruch überstandener Angst reagierten. Und sein Herzklopfen bewies ihm, daß er einen Augenblick lang um sein Leben gefürchtet hatte.
Die Entscheidung war gefallen, das wußte er!
Hinter ihm pochten die Schritte auf den Teppich.
Schweigen stand im Raum.
Tapp——tapp——tapp——die weitausholenden Schritte.
Damm wandte sich nicht um.
Jener sollte erst — nicht unter seinem Blick — die Selbstbeherrschung wiedergewinnen.
Das schluchzende Atmen hinter ihm verebbte.
Die Schritte brachen ab.
Eine Hand umklammerte seine Schulter.
»Damm!——Martin Damm!——.« Die Stimme bebte noch in kaum verhaltener Erregung. »Verzeihen Sie mir, ——meinem Temperament! Bleiben Sie hier!« Sill schrie fast. — »Gehen Sie nicht wieder fort!« Das war ein heißes, bettelndes Flehen. »Bleiben Sie hier——Sie verstehen mich wie nie ein Mann zuvor!——Bleiben Sie!——.«
Die Stimme hinter ihm flüsterte. »Zwei, drei Jahre noch, dann hebe ich die Welt aus den Angeln, bin i c h ihr Herr!
——Begreifst du, was das heißt, Martin Damm?——
Macht! — Macht!——Ich——Du——wir zwei sind ——Martin——Du——.« Die Hand rüttelte an der Schulter.
Da schwang sich Sill in seinen Sessel, beugte sich vor, ergriff die Hände Damms. »Hörst du mich?———Verstehst du mich——Martin?——Wir zwei, Herren der Welt!
——Ich alleine schaffe es nicht mehr!«
Und dann brach aus dem Herrn der Insel die Flut der Bekenntnisse, die sich seit Jahren aufgestaut haben mußten, mit so brutaler Gewalt und Ehrlichkeit hervor, daß sie den wie erschlagen Horchenden zutiefst erschütterten.
Am nächsten Morgen sprang in Gisela Verweer eine in den letzten Tagen leise aufgekeimte Hoffnung jäh entzwei. Sill und Damm sagten, wie verschworene Kampfgefährten, ›Du‹ zueinander. Sie sahen beide übernächtigt aus, doch in Sills Augen brannte ein unheimliches Feuer. Damms gezügeltes Wesen schien aus verborgener Kraft herrischen Auftrieb zu erhalten, und doch ließ er keine Gelegenheit entgehen, ihr mehr als einfache Aufmerksamkeit zu erweisen, und Sill nahm an allem mit einer morgendlichen Frohgelauntheit teil, die sie gerade in diesen Stunden nie bei ihm bemerkt hatte.
»Bis heute abend denn, Martin!« Sie hörte den harten Männerhandschlag hinter ihrem Rücken, als sie sich der Tür zuwandte.
»Ja, Jose! — Und frohe Arbeit!«
Da folgte ihr Doktor Damm.
»Wir wollen die Geräte holen! — Auch unsere Tätigkeit beginnt heute«, sagte er nur, als sie den Gang entlangschritten.
Zwei Wochen waren vergangen, in denen Doktor Damm mit seiner von Sill ihm überantworteten Mitarbeiterin gewissenhaft auf dem Grunde des Felsendoms, also im Bereich der Siedlung, Peilung auf Peilung durchführte, um den geologischen Untergrund der Daumeninsel zu erforschen. Auf den in seinem Arbeitszimmer aufgespannten Karten trug Gisela Verweer die Ergebnisse der Tiefenlotung ein. Die eine Hälfte der Insel, jene die dem kleinen Hafen zugewandt war, bestand, daran gab es keine Zweifel mehr, bis in die größten noch auslotbaren Tiefen aus einheitlichem Gestein, also Diabas. Die gegenüberliegende Seite verursachte Damm von Tag zu Tag zunehmendes Kopfzerbrechen. Hier lag, zog man die aus den Befunden gegebenen Schlüsse, der schwache Punkt, vermutlich sogar die Quelle des Erdbebenherdes, deren Wirkung Damm bisher nur einmal verspürt hatte.
Fräulein Verweer hatte eine erstaunliche wissenschaftliche Befähigung erwiesen, mehr noch, nach kurzer Zeit der Einführung in geologische Probleme, eine Kombinationsgabe gezeigt, die zu fruchtbaren Diskussionen Anlaß gab. Ihr Wesen blieb gleichförmig, kühl und abweisend. Seit jenem Montag, da in der vorausgegangenen Nacht die Ereignisse — Ereignisse, welche Gisela Verweer nicht zu deuten vermochte — sich überstürzt hatten, unterließ sie Bemerkungen, die irgendwie eine persönliche Note trugen. Sie war Damms Assistentin und nicht mehr Doktor Sills Privatsekretärin. Dieser klaren Tatsache trug sie offensichtlich Rechnung, nicht etwa als eine in ihr unabänderliches Schicksal Ergebene, sondern als eine an Selbständigkeit gewöhnte wissenschaftliche Mitarbeiterin, die ihre Pflicht mit Stolz und nie erlahmender Arbeitsbereitschaft erfüllte.
Eines späten Nachmittags betrat Doktor Sill unbemerkt das Arbeitszimmer, just in einem Augenblick, da Damm und seine Assistentin entgegengesetzter Meinung über die Auswertung der neuen Ergebnisse waren und jeder der beiden eine Fülle von Argumenten zur Untermauerung seiner Ansicht vorbrachte.
Sie wandten ihm den Rücken zu, vor einem Reißbrett stehend, auf dem ein Gewirr von Linien und Schraffierungen jeden Laien verwirrt hätte.
Sill rührte sich nicht, doch man sah seinem Gesichtsausdruck an, daß er mit zunehmender Aufmerksamkeit dem Streitgespräch folgte. Als Gisela Verweer sich schließlich überzeugen ließ, daß die Folgerungen des viel erfahreneren Geologen bisher unberücksichtigte, aber sehr ausschlaggebende Gesichtspunkte enthielten, stimmte sie seiner Ansicht nachdenklich zu.
»Der viel größere Vulkan ist bei einer urgewaltigen Eruption restlos zerborsten!« schloß Damm seine Ausführungen.
Sill gab seine Anwesenheit durch ein Räuspern zu erkennen und trat an die ausgebreiteten Zeichnungen heran. Durch die abendlichen Gespräche war er von Martin Damm auf dem laufenden gehalten worden.
»Ich möchte doch einmal deine Theorie über die Bildung dieser hohlen Felseninsel im Zusammenhang hören!« sagte er, sich zu Damm wendend. »Nach dem eben Gehörten scheinst du zu neuen Schlußfolgerungen gekommen zu sein. Oder hab ich euch falsch verstanden? — Verzeihung übrigens, daß ich mich nicht sofort bemerkbar machte! Ich fürchtete, durch eine Unterbrechung eures Disputes das Endergebnis zu beeinträchtigen.«
»Nett von dir!« erwiderte Damm. »Tatsächlich glaube ich selbst, erst in diesen letzten Minuten, angeregt durch Fräulein Verweers Gegenargumente, noch verschwommene Vorstellungen in eindeutige Fassung gebracht zu haben. -Komm, wir wollen uns setzen.«
Als die drei vor den Plänen Platz genommen hatten, legte Doktor Damm seine Gedanken dar:
»Ich habe dir gegenüber, Jose ja schon mehrfach betont, daß meines Wissens auf der Erde ein derartig gewaltiger Hohlraum im Urgestein, wie hier, nicht seinesgleichen hat. Die meisten unterirdischen Hohlräume, Grotten oder Hallen verdanken ihre Entstehung Auswaschungen in weicheren Sedimentformationen. Derartiges scheidet hier aus, da Diabas zu den härtesten Gesteinen zählt. Übrig bleibt somit nur noch die Erklärung vulkanischen Ursprungs. Äußerlich unserem Daumenfelsen ähnliche Gebilde, die dann allerdings durch und durch massiv und nicht hohl sind, gibt es mehr oder minder hohe und gewaltig viele. In erinnere an den bekannten ›Zuckerhut‹ bei Rio de Janeiro.
Man könnte nun annehmen, daß unter hohem Druck stehende Gasmassen in der Urzeit der Erde das damals noch zähflüssige Magma gewissermaßen durch einen Kanal in einer bereits erstarrten Umgebung gehoben hätten. Es müßte dann aber als eine schon mehr als seltsame Laune der Natur betrachtet werden, daß gerade in dem Augenblick der Druck der Gase aufgehört hätte, als der Hohlfelsen vollendet dastand. Eine solche Theorie zeigt zuviele Schwächen, sie gewinnt aber hohe Wahrscheinlichkeit, wenn man annimmt, daß diese Daumeninsel das Überbleibsel eines restlos zerborstenen, man darf schon sagen explodierten Riesenvulkans ist und lediglich eine seitliche kleine Beule darstellt. Die unfaßlich starke Gasspannung entlud sich mit verheerender Wirkung in der zersprengten Magmaaufwölbung des Muttervulkans, ein Vorgang, der sich zeitlich betrachtet in wenigen Minuten abgespielt haben dürfte. Ein im Verhältnis winzig kleiner Seitenkanal drückte Magma als Knospe oder Ast heraus. Man könnte anschaulicher von einem Dom sprechen. Bevor aber auch dieser das Schicksal an der Flanke des Riesen teilte, verpuffte die gesamte Kraft der Gase im Zerplatzen des Muttervulkans. Das Magma erstarrte, und unser hohler Felsen blieb zurück als Zeuge von den Urwehen der Erde.
Man darf sich heute nicht durch die an sich beträchtliche Höhe und Größe unseres Daumenfelsens täuschen lassen. Sein Erzeuger dürfte einige tausend Meter hoch gewesen sein in dem Augenblick, als er in Stücke gerissen wurde. In geologisch viel späteren Zeiten schoben sich wohl als Reste des sogenannten Gondwana-Landes, also der einstmals bestehenden Landbrücke zwischen Afrika und Australien, an die steile Flanke und in den Hohlraum des Gaskanals sedimentäre Karbonformationen, während der dem Hafen zugewandte Fuß noch auf Urgestein aufsitzt. Aus dem mit Vulkanherden in Verbindung stehenden Urgestein stammen unsere Dampfquellen, aus der eingepreßten Sedimentärschicht unsere Kohle. Die Eingangshöhle stellt einen bereits erfolgten Auspuff der Gase dar. Unfehlbar hätte sich dieser Stollen erweitert und die Existenz des Hohlfelsengebildes vernichtet, wenn nicht, wie schon gesagt, die Entspannung der Gase im Hauptvulkan gerade rechtzeitig eingetreten und dann die Erstarrung erfolgt wäre.
Ich gestehe offen, daß Theorie Theorie bleibt, und ich würde, wollte mir jemand diese Theorie, ohne daß ich das einzigartige Gebilde hier gesehen und zum Teil schon erforscht hätte, vortragen, sie mangels handgreiflicher Beweise ohne Zweifel als phantastisch abtun. Es gibt aber, die Tatsachen beweisen es, nun einmal mehr Dinge, als unsere Schulweisheit uns träumen läßt, wie Fräulein Verweer vor kurzem einmal den hochachtbaren Herrn Shakespeare zitierte.«
Martin Damm warf einen raschen Blick auf Gisela Verweer. Sie saß da, niedergebeugten Hauptes in die Zeichnungen vertieft. Ihm entging nicht, daß eine leichte Röte ihre Wangen überflutete.
Sill, der bis jetzt unbewegt mit einem Drehbleistift gespielt hatte, hob den Kopf.
»Danach stände unsere Insel nur mit einem Bein fest im Untergrund.«
»Ja!« lautete die rasche Antwort Damms, »und dieses eine Bein steht noch nicht einmal fest! Denn es ruht, wie du sagst, auf einem unruhigen Vulkanherd, der die zeitweiligen Erdbeben auslöst.«
»Du glaubst, wenn ich dich richtig verstehe, daß die Karbonschichten tragfähig sind?« forschte Sill weiter.
»Ohne diese wäre meines Erachtens der Fels längst umgekippt! Sie wirken gleichzeitig als Flankenstütze und Schwingungspuffer«, erwiderte Damm.
»Drohen uns in absehbarer Zeit Gefahren?« Sill pochte mit dem Bleistift auf die Stuhllehne.
»Ich beabsichtige, morgen mein Gerät in der Kohlengrube anzusetzen, um von dort aus weitere Lotungen vorzunehmen. Je tiefer ich die Ausgangspunkte der Peilwellen vortragen kann, desto mehr Unsicherheitskoeffizienten schließe ich aus!«
»Richtig!« sagte Sill. Er stellte das nervenaufreizende Pochen ein. »Wie lange glaubst du dort zu tun zu haben?«
»Zwei, höchstens drei Tage!«
»Und damit die endgültige Bestätigung deiner Theorien zu finden?« Jose Sill starrte den Freund an.
»Hoffentlich!« — Damm hielt den Blicken stand.
»Eine zuversichtlichere Antwort wäre mir lieber!« — meinte Sill nach einigem Zögern.
»Ich hasse jede Theorie! — Bevor ich nicht eindeutige Beweise bringen kann, betrachte ich diese einstweilige Aufgabe als nicht beendet. — Es steht zuviel auf dem Spiel.« Martin Damm sprach hart und eindringlich.
Da gewahrte Sill, wie sein Gegenüber mit fast unmerklichem Rucken des Kopfes auf Gisela Verweer deutete, als ob er zum Ausdruck bringen wollte, daß jene nicht mehr erfahren sollte.
Sill schloß als einzige Antwort auf Sekunden die Augenlider, und als er sie wieder hob, sprühte ein Blick heißer, dankbarer Genugtuung Martin Damm an.
»Gut so! — Habt ihr noch etwas zu erledigen? — Nein?
Dann schlage ich vor, wir essen in einer halben Stunde! — Gisela! — Die Zeichnungen scheinen ja magnetische Anziehung auf dich auszuüben, daß du geradezu entrückt davorhockst! Entschuldige den Ausdruck!«
Sie blickte auf, langsam den Rücken straffend.
»Jose! Ich hätte Geophysik studieren sollen! Daran hab ich eben gedacht!«
»Das kannst du bei diesem vorzüglichen Lehrmeister noch nachholen!« lachte Sill laut und schlug zur Bekräftigung Martin Damm schallend auf die Schulter, gleichzeitig mit dem ihm eigenen Temperament hochschnellend. »Gratuliere, Herr Professor, zum ersten Lernbeflissenen der Universität Insula Silliana!« Er schritt rasch zur Tür, wandte sich dort noch einmal mit heiterer Miene um. »Laßt mich nicht warten! — Ich hab Hunger! — Bis gleich!«
Die große Weckuhr zeigte genau die achte Morgenstunde, als Gisela Verweer und Doktor Damm den Eingang zum Kohlenschacht betraten.
Ein Hauer erwartete sie bereits.
Sie gingen gemeinsam eine Treppe hinab. Etwa fünf Meter unter dem Boden der Halle befand sich der Elektromotor der Fördermaschine. Seitwärts führte ein Ketteneimerband nach oben. Kohlenbrocken lagen in einer Ecke.
Der Hauer öffnete eine Eisentür.
Sie bestiegen den kreisrunden Förderkorb. Dieser hing zum Erstaunen Damms ohne Führung frei in der Luft.
Sehr langsam setzte er sich nach einem Hebelwenden des Begleiters in Bewegung.
Nach wenigen Metern bemerkte Martin Damm zu seiner Linken eine runde, starke Stahlklappe, die einer Tresortür ähnelte, in einer Aussparung der Wandung.
Er deutete fragend darauf.
»Zur Sicherheit!« erklärte der Hauer. »Diese fugendicht schließende Stahlklappe paßt genau in den gestuften Ring hier! — Im Falle eines unvorhergesehenen Wassereinbruchs unten im Stollen kann sie geschlossen werden!«
Jetzt wurde der Förderkorb durch einen sinnreichen Mechanismus in Führungsschienen gezwungen, metallisches Klappen ertönte.
»So, das hätten wir!« sagte der Hauer, wendete den Stellhebel weiter, und in rasch zunehmender Fahrt glitt der Korb abwärts.
»Ah! — Jetzt versteh ich die Zusammenhänge!« nickte Martin Damm. »Die Abdichtungsklappe kann nur geschlossen werden, wenn der Förderkorb oben ist, sonst würde ja das Seil geklemmt und müßte den Verschluß behindern. Aus dem gleichen Grunde beginnen auch erst unter der Klappe die Führungsschienen, und die letzten wenigen Meter schwebt der Korb frei nach oben, da die Führungsschienen ebenfalls einen dichten Abschluß unmöglich machen würden!«
»Ganz so ist es!« meinte der Hauer, der sichtlich erfreut war, daß sein Gast soviel technisches Verständnis zeigte. »Sieht jetzt ganz einfach aus!« fuhr er fort. »Hat aber manches Kopfzerbrechen und anfangs sogar eine Fehlkonstruktion gekostet. Herr Oberingenieur Murrstedt und ich haben diese Sache ausgeheckt!«
»Ganz ausgezeichnet! Einfach, und auf alle Fälle absolut zuverlässig!« lobte Damm. »Übrigens, wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, dann lassen Sie etwas weniger rasch absinken. Ich spüre die Druckänderung im Trommelfell! Wir haben ja Zeit!«
»Selbstverständlich!« erwiderte besorgt der Führer und verschob sofort den Hebel.
Jetzt glitten sie ganz langsam abwärts.
»Unten im Stollen ist noch so ein Sicherheitsschott!«
»Man sieht, es ist für alle Fälle vorgesorgt!« antwortete Martin Damm etwas zerstreut. Er machte sich Gedanken darüber, daß er den Luftdruckanstieg so unangenehm in den Ohren empfand. Als Flieger war er nie von dieser Erscheinung belästigt worden.
Seiner Begleiterin schien es ähnlich zu gehen. Sie schluckte Luft als Gegenmittel.
Ein gelbes Licht huschte vorbei.
Ein orangefarbenes folgte nach kurzer Zeitspanne.
Der Hauer legte den Stellhebel ganz herum.
Eine rote Lampe glühte auf, langsam nach oben entschwindend. Der Förderkorb machte nur noch sehr wenig Fahrt, dann ein leichtes Aufsetzen. Er stand.
Der Hauer öffnete die Gittertür.
»Darf ich bitten! — Dort stehen Ihre Geräte, Herr Doktor!« Er folgte dem Aussteigenden. »Gemäß meiner Dienstanweisung muß ich Sie noch mit der Arbeitsweise des Sicherheitsschottes vertraut machen. — Bitte, nur den Stollen entlang!« Höflich schritt er hinterdrein.
Martin Damm war aufs höchste erstaunt, daß der Stollen an Stelle der erwarteten Holzstempelstützen bogenförmig vollständig mit Beton ausgekleidet war. Die dunkelgraue Oberfläche ließ darauf schließen, daß eine beigefügte Bitumenmasse ihn wasserundurchlässig machte. Strahlend helle elektrische Lampen führten wie eine Perlenschnur längs der Decke schnurgerade in dämmrige Ferne.
Nach wenigen Schritten standen sie vor einem Kreisrund aus Stahl. Etwa vierzig Zentimeter mochte der sich konisch erweiternde Ring stark sein. Der Durchmesser erlaubte einem ausgewachsenen Menschen, ohne Bücken hindurchzuschreiten. In wuchtigen Angeln schwebte jenseits die Verschlußtür, gleichfalls konisch zulaufend.
»Vor Ort arbeiten wir unter dem Ozean!« begann der Hauer seine Erläuterungen. »Die kohleführende Schicht ist im Vergleich zu meinem früheren Arbeitsplatz in einer Ruhr-Grube ungewöhnlich mächtig. Es sind zwei Meter. Der Abbau ist leicht, zumal das umgebende Gestein sehr tragfähig ist. Außerdem führt sie mit sehr geringer Schwankung fast genau horizontal, was ebenfalls die Arbeit erleichtert. Da wir täglich im Höchstfalle zwei Tonnen fördern, meist wird weniger benötigt, wird der Stollen sofort mit Stahlbögen abgestützt und von Zeit zu Zeit ausbetoniert. Vor Ort prüft unser Steiger ständig auf Anzeichen von Wassereinbruchsgefahr. — Aber«, ein Achselzucken begleitete die Worte, »so was kann ja immer passieren. Für alle Fälle ist nun dieses Sicherheitsschott eingebaut. Es befindet sich an der Übergangsstelle vom Diabas zum Sediment. Hier ist der Bedienungsknopf. — Bitte treten Sie einmal zurück. — Sehen Sie!« Der Hauer drückte einen Knopf nieder. Mit ungeahnter Geschwindigkeit schlug die schwere, runde Stahltür dumpf hallend zu. »Der Förderkorb befindet sich während der Arbeit stets hier unten, damit wir uns retten können. — So, jetzt habe ich Ihnen alles erklärt!« Er betätigte abermals einen Schalthebel. Langsam schwenkte das Schottentor auf. »Ich fahre jetzt auf und lasse den Förderkorb dann wieder ab. Für die Dauer Ihrer Tätigkeit hier machen wir Feierschicht!«
Ein vergnügtes Grinsen überlief sein Gesicht, das kundtat, daß er mit dieser Regelung sehr einverstanden war.
»Glück auf!« lachte Damm, den der Anblick des biederen Mannes ergötzte.
»Glück auf!« tönte es zurück.
Der Hauer betrat den Förderkorb, der sich sogleich in Bewegung setzte.
Noch während Damm und seine Assistentin ihre Geräte zusammensetzten, langte der Korb wieder bei ihnen an.
»Sie sind ja heute außergewöhnlich schweigsam, Fräulein Verweer!« meinte Martin Damm nach einer Weile stummen Hantierens leichthin.
Gisela Verweer richtete sich aus ihrer gebückten Stellung auf und strich eine Haarsträhne aus der Stirn. Ihr Blick hing in dem seinen. Doch aus ihren Augen sprach nicht die stete ruhige Gelassenheit, die der aufmerksame Beobachter sonst an seiner Begleiterin gewohnt war.
Sie schwieg beharrlich, mit einem Ausdruck eindringlichen Prüfens, der verwirren konnte. Und plötzlich sagte sie zögernd:
»Diese Expedition bedrückt mich, seit Ihrem gestrigen, überraschenden Entschluß dazu!«
»Überraschend?« fragte Damm verblüfft.
»Nun, Ihre Arbeitspläne lagen doch in anderer Richtung, wenigstens für die nächsten vier Tage!«
»Das ist durchaus richtig!« entgegnete Martin Damm, »unsere lebhafte Diskussion jedoch führte mich auf die Idee, das Problem einmal von hier aus anzupacken!«
Sie zog die Augenbrauen hoch, daß die glatte Stirn sich in scharf abgezeichnete Falten legte und ungläubiges Staunen verriet. Martin Damm kam es vor, als ob er für eine Lüge bestraft würde. Er geriet gelinde außer Fassung. Nie zuvor war dieses Mädchen in solcher Art aus ihrer kühlen Zurückhaltung herausgetreten.
»Daran habe ich offengestanden nicht gedacht!« sagte sie nur und machte sich wieder an dem Gerät zu schaffen.
Die Stunden verrannen. Tiefer und tiefer drangen sie in den Stollen vor, mit einem Meßband jeweils den neuen Standort der Peilungen festlegend. Die Assistentin schrieb Zahlen auf Zahlen, die ihr Mitarbeiter angab.
Als sie wieder den Platz gewechselt hatten, arbeiteten sie in unmittelbarer Nähe von Holzbohlen und Brettern, die wohl zur Verschalung bei den Betonierarbeiten dienten. Sie waren sorgsam geschichtet, die Bahn der Transportloren nicht zu beeinträchtigen.
»Wollen wir hier unseren mitgeführten Imbiß einnehmen?« fragte Damm, auf seine Armbanduhr zeigend. »Es ist gleich eins! — Eine prächtige Sitzgelegenheit ist auch vorhanden!« Er wies auf die Holzstapel.
»Ich wollte gerade denselben Vorschlag machen!« entgegnete Gisela Verweer. »Das Stehen strengt mich heute ein wenig an. Gewiß liegt es nur daran, daß wir unsere Klappstühle nicht mitnahmen, die sonst immer eine kurze Entspannung erlaubten!«
»Bitte entschuldigen Sie, daran hätte ich denken müssen!«
»Wieso Sie? — Ich genau so!« Gisela Verweer ließ sich auf dem Bohlenstoß nieder, holte aus einer Aluminiumdose zwei kleine zellophanumhüllte Päckchen und reichte eins davon ihrem Begleiter, der neben ihr Platz genommen hatte.
Sie verzehrten schweigend ihr Mahl.
Damm zog aus einem kleinen Gerätetransportkoffer eine Thermosflasche und bot seiner Nachbarin den kühlen Trunk dar. Es war heiß hier unten.
»Noch einen Becher?«
Sie schüttelte verneinend den Kopf. Da trank er selbst.
»Ich denke, wir machen eine Weile Pause. — Es sitzt sich vortrefflich hier!« Martin Damm lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand, die Beine entspannt vorstreckend.
»Ja!« sagte sie.
Zu einem Gespräch oder einer wissenschaftlichen Diskussion scheint sie heute nicht aufgelegt zu sein, stellte Damm mehr im Unterbewußtsein fest, denn seine Gedanken beschäftigten sich mit ganz anderen Vorhaben.
Er zog seine Brieftasche heraus, die Zeichnungen und Skizzen enthielt, und suchte darin, als ob er eine davon als Gedächtnisstütze gerade jetzt benötige.
Gisela Verweer hatte es sich auf den harten Holzbohlen so bequem wie möglich gemacht, den Rücken gleichfalls angelehnt. Sie beachtete sein Treiben nicht.
Da entnahm Martin Damm den Blättern einen kleinen Zettel aus dünnstem Durchschlagpapier und steckte die Brieftasche wieder ein. Er überflog rasch die wenigen maschinengeschriebenen Zeilen.
Seine Blicke blieben für Sekunden auf dem Blatt haften. Fast schien es, als ob er mit einem letzten Entschluß ränge.
Langsam reichte er den kleinen Zettel seiner Begleiterin, dann beugte er sich vor und stützte den Kopf auf beide Hände.
Erstaunt ob des seltsamen Gebarens, hob Gisela das dünne Blättchen und las.
›Bitte sagen Sie mir, denn Sie müssen es wissen, ob hier, wie in meinem Arbeitszimmer, und vermutlich in allen Räumen, geheime Abhörmikrofone eingebaut sind!‹
Jähe Röte schoß der Leserin in die Wangen.
Der unbekümmert dahockende Damm bemerkte es jedoch nicht.
Sie las zum zweiten, dritten Male, sie war zutiefst aufgewühlt.
Eine geraume Weile verstrich, ehe sie die Sammlung zu einer Antwort fand.
Martin Damm rührte sich nicht aus seiner Teilnahmslosigkeit. Er starrte einfach vor sich hin.
Die Würfel waren gefallen.
»Nein!« hörte er neben sich ihre Stimme.
Da richtete er sich auf, nahm den kleinen dünnen Zettel aus ihrer zitternden Hand, steckte ihn zusammengeknüllt in den Mund und verschluckte die winzige Papierkugel.
»Das wissen Sie ganz genau?« Aus seinen Augen, die jetzt in einer erschreckenden Willenshärte funkelten, sprühte eine fast brutale Drohung.
»Ja!« Sie schluckte an der kurzen Silbe. Ihre Gedanken bebten in wirbelnder Betäubung vor der Entscheidung, die die nächsten Minuten nach solcher Einleitung bringen mußten.
Mit einem einzigen schnellen Griff umspannte der Mann die Schultern der Frau an seiner Seite, riß sie an sich und drückte seine Lippen auf ihren Mund, bevor die völlig Betäubte an Widerstand denken konnte.
»Gisa!——Du!«
Sie stieß ihn mit unvermuteter Kraft von sich und sprang zornbebend auf.
»Sind Sie so geschmacklos, oder von Sill zu diesem niederträchtigen Spiel beauftragt?«
Die Empörte schrie, die Fäuste zur Abwehr weit vorgestreckt. Die schlanke Gestalt überlief ein Zittern ohnmächtiger Demütigung.
»Weder — noch!——Und warum geschmacklos?« Martin Damm erhob sich langsam. »Warum geschmacklos?« Sein brennender Blick bestand auf Beantwortung dieser Frage. Er wollte einen Schritt nähertreten und sah, daß sie sofort zurücksprang. »Warum geschmacklos?« begehrte er zum dritten Male lauter.
»Die abgelegte Geliebte eines anderen zu werben, dürfte wohl der Inbegriff der Geschmacklosigkeit sein!« Hohn und Scham schwang in der Stimme.
»Bist du nie gewesen!« Ein jungenhaftes Lachen hallte durch den Stollen.
»Nie ge——wesen?« Gisela Verweer senkte die Arme. In ihrem Antlitz machte der Ausdruck wilder Empörung ungläubigem Staunen Platz.
»Nein, niemals!«
»Und solch eine Lüge glauben Sie Ihrem Auftraggeber, nachdem Sie selbst täglich Zeuge seiner Zärtlichkeiten waren?« Ihre Mienen spiegelten die spöttische Überlegenheit wider, zu der sie nun abwehrende Zuflucht nahm.
»Zärtlichkeiten? Wenn es die gewesen wären, hätte ich mich wohl zurückzuhalten gewußt. — Gisa! — Du! — Glaubst du denn wirklich noch, ich wüßte nicht, wie es in Wahrheit um dich steht?«
Sie schwieg verbissen.
»Männer wie Sill kennen nur eine Geliebte, und das ist ihr Machtwahn——Du warst für ihn eine liebliche Puppe, die den Kavalier in ihm täglich aufbügeln half, und deren Anwesenheit seine Einsamkeit verschönte, die elegante Dame am Abendtisch, die er aus der Fülle seiner Macht verwöhnen konnte und die als Gegengabe mit dem Duft ihrer Gepflegtheit seine Sinne berauschte, ihn auch in diesem Punkte seine eingebildete Vollkommenheit auskosten ließ. Zu einem tiefen Gefühl ist unser gemeinsamer Zwingherr nicht mehr fähig, war er wohl nie. Du aber fandest dich in diese Rolle, aus der es kein Entrinnen, keinen Ausweg mehr gab. So wurdest du mit der Zeit seine Vertraute, denn ein innerer Zwang nötigt ihn, seine Gedanken auszusprechen, seine Pläne wenigstens vor einem Menschen auszubreiten, und als du erkanntest, wie unrettbar das Geschick der Mitwisserin mit dem des Ausplauderers aller Geheimnisse verbunden war, überkam dich nicht einmal Haß. Ein grandioser Schauspieler hatte der von ihm erzogenen Schauspielerin alles Innenleben ertötet!«
Martin Damm schwieg wie erschöpft. Jetzt erst überkam ihn die klare Erkenntnis, daß er seinen lang zurückgestauten Gefühlen in einer Art Luft gemacht hatte, die von einer Frau eher als abstoßender Ausbruch von Sinnlichkeit, denn als Zuneigung oder gar als Liebe gedeutet werden mußte. Er hatte sich seine Überrumpelungstaktik so schön ausgemalt und war des raschen Erfolges sicher gewesen, als ihr Befreier und Retter, und nur durch die Zügellosigkeit einer jähen Gefühlsaufwallung waren alle gut vorbereiteten Pläne zunichte gemacht.
Gisela Verweers Haltung, den Kopf so tief niedergebeugt, daß er ihr Gesicht nicht sehen konnte, die Arme schlaff am Körper niederhängend, das Bild eines Menschen, der bis ins Mark getroffen war, beunruhigte, quälte ihn, der um eine Entschuldigung rang, bis zu heißem Mitleid.
Wütend riß er den Reißverschluß am Kragen des Overalls herunter bis zur halben Brust.
Die Hitze im Stollen schien ihm unerträglich, das Schweigen zermürbend. Luft!
Wie jetzt den neuen Weg anbahnen? Er fand die Worte nicht, fürchtete, mit einem neuen Geständnis nur neue Verwirrung anzurichten.
Der Schatten des Zwingherrn schien auch hier so gegenwärtig zu sein, daß das Aufkeimen persönlicher Beziehungen unmöglich war. Heimlicher Argwohn drohte seine verstrickenden Fäden zu spinnen.
Da enthob ihn die Frau jedes Grübelns.
»Weiter!« sagte sie, und das leise Wort schlug ihn wie ein Peitschenhieb. Verlangte sie, die Arbeit wieder aufzunehmen?
Er zögerte unsicher. Verletzter Mannestrotz bäumte sich auf.
»Weiter — Erzählen Sie weiter! — Hier hört uns keiner! Seien Sie ohne Sorge! — Machen Sie aus Ihrem Herzen nur keine Mördergrube, Herr Doktor Damm! — Der getretene Wurm verlernt mit der Zeit das Krümmen!«
»Gisa ——!——Ich————.«
»Das ›Ich‹ wird bei allen Männern sehr groß geschrieben.« Gisela Verweer hob brüsk den Kopf. In ihren Augenwinkeln hingen Tränen. »Wissen Sie, Martin Damm, daß Sie entweder ein bestochener Lump sind, oder ein verliebter Narr? Und mit beiden ist in dieser Umgebung nicht zu paktieren! Darauf lief doch wohl Ihre Zettelanfrage hinaus? Soviel Lebenserfahrung müssen Sie mir schon zubilligen! — Seitdem Sie gestern abend Ihren Entschluß kundtaten, hier im Bergwerk die Arbeit fortzusetzen, wußte ich, daß ich auf eine Überraschung gefaßt sein mußte. Meine Ahnung hat mich nicht betrogen! Weder Narren noch Lumpen kann man mit einer Drohung einschüchtern. Aber auf eines habe ich wohl Anrecht, zu erfahren, welchen Zweck Sie verfolgen.«
Die Frau sprach mit einer Schärfe, die jetzt noch jederzeit die Möglichkeit bot, den ungefährdeten Rückzug anzutreten, falls der Partner im Widerstreit eines Auftrags und seiner eigenen Gefühle versagte. »Welchen Zweck verfolgen Sie?«
Sie stampfte mit dem Fuß auf.
»Mit dir zu fliehen, Gisa!«
»Zu————fliehen?«
»Ja!«
»Zu——flie——hen?« Sie wiederholte die Worte in fassungsloser Überraschung.
»Ja, Giesa!«——.
»Und dazu benötigen Sie eine mehr als zweifelhafte Liebeserklärung?« Worte ungläubigen Staunens.
»Gisa! Ich bitte dich um eines, mir zu glauben, daß ich nach einem vorbedachten Plan handelte und überzeugt war, so am raschesten zum Ziel zu kommen!«
Er stand da, die Hand in der Hosentasche vergraben, während die andere in dem dichten Haarschopf beträchtliche Verwirrung anrichtete. Die Augen hob er nicht.
Ihr spöttisches Auflachen überhörte er in der Verworrenheit seiner Gedanken.
»So!——Am raschesten zum Ziele zu gelangen?——
Nach einem vorbedachten Plan!——Ein köstliches Eingeständnis! ——Sie scheinen ja eine recht eigenartige Eroberungstaktik bei Frauen anzuwenden. Hatten Sie bisher stets Erfolg damit?« Gisela Verweers überlegene Haltung verriet deutlich, daß dieser Zweikampf für sie bereits entschieden war. Sie war Sieger geblieben.
Wäre Martin Damm ein besserer Psychologe gewesen, als er nach eifriger Beobachtung und tüchtigem Schriftdeutertum zu sein vermeinte, so hätte er allein aus der Tatsache, daß die gekränkte Frau ihm noch Rede und Antwort stand, statt sich einfach abzuwenden, den Schluß ziehen müssen, daß er auf dem richtigen Wege war. Mit Flugzeugen wußte er umzugehen, genau so mit seinen glänzend erdachten geophysikalischen Geräten und Apparaten, dem hervorragenden Rüstzeug einzigartigen wissenschaftlichen Könnens und ———Gisela Verweer dachte nur: ›Du großer Junge!‹
»Gisa——ich kann dir nicht alles erklären——ich kann es einfach nicht——!« Wie ein Stöhnen entrangen sich die Worte seiner Brust.
»So — So!« Im tiefsten wußte sie jetzt um die Gemeinsamkeit des Weges.
»Du kannst das nicht?——Soll ich dir etwa behilflich sein?«
Damm, der durch seine eigene Dummheit alles verloren zu haben glaubte, vernahm nicht einmal das vertrauliche Du, verspürte nicht, daß sie nach wenigen leisen Schritten vor ihm stand.
Sie schob sachte die immer noch zausende Rechte aus dem Haarschopf.
Jäh hob der Erschreckte den Kopf.
Ihre Blicke tauchten ineinander, völlig verstört der seine, klar, voll unendlicher Wärme der ihre.
»Martin——!«
»Gisa!« Ein Schrei der Erlösung, der mehr besagte als tausend Erklärungen.
»Gisa!«
»Pst!——Martin! Leise!——Es könnten doch Mikrophone hier eingebaut sein——!«
Den Satz konnten ihre Lippen nicht beenden. Ein anderes Paar hatte sie in stürmischer Erlösung verschlossen.
In dem betonvermauerten, heißen Stollen spann sich die Perlenschnur der hellgleißenden Glühbirnen längs der Deckenwölbung, in der Ferne kleiner und verschwommen verdämmernd.
Die stählerne, glitzernde Spur der Gleise schob sich weit voraus zu einem einzigen breiten Strich zusammen.
Stumm blieb es im strahlend erleuchteten Stollen für eine lange, lange Zeit.
Und viel später brachte der Förderkorb mancherlei Geräte und zwei Menschen nach oben. Doch keiner hätte aus ihren gleichgültig gefaßten Mienen das jüngste Geschehen und ihren verbissenen Willen, die Freiheit zu gewinnen, ablesen können.
Noch in den letzten Nachmittagsstunden zeichnete Martin Damm nach dem Diktat Gisela Verweers die Lotungsergebnisse in die Pläne und Karten ein. Als das Werk beendet, die Auswertung eindeutig erkennbar war, mehrten sich die früher schon gehegten Befürchtungen erschreckend. Der hohle Daumenfelsen ruhte — wie eine große Goldkrone auf einem stark beschädigten Zahnbruchstück — nur mit höchstens einem Drittel auf massivem Untergrund, den Rest stützte die kohlehaltige Sedimentschicht, und in einer Tiefe von etwa 1200 Meter begann eine noch nicht zur Ruhe gekommene magmaähnliche Aufwölbung. Das charakteristische Bild, wie es einige vulkanische Inseln des Stillen Ozeans darstellen. Gisela Verweer warf das Wort Krakatau in die grübelnden Betrachtungen Doktor Damms.
Dieser nickte nur, und sie wußte nicht, ob es Zustimmung oder Ablehnung bedeutete.
Doktor Sill konnte es nicht entgehen, daß das Paar während des Abendessens schweigsamer als sonst war. Er unterließ jede Frage, als ob er darnach trachtete, eine höchst unliebsame Eröffnung so lange wie möglich hinauszuschieben. Nur die allmählich lebhafter werdende Schilderung Damms über die hervorragend durchgeführten technischen Sicherheitsmaßnahmen im Bergwerk erfüllte ihn mit solcher Genugtuung, daß auf einige Zeit der fühlbare Alpdruck wich.
Die Männer waren es schon gewöhnt, daß Gisela Verweer sich sehr bald verabschiedete. Sill bedauerte aufrichtig die Kopfschmerzen, die sie sich in dem heißen Stollen zugezogen hatte, und wünschte mit herzlicher Anteilnahme gute Ruhe und Besserung des Befindens.
Dann zogen sie sich in ihre Ecke zurück.
Anton räumte eilfertig das Geschirr ab und schob unaufgefordert den kleinen Wagen mit Getränken herein.
Müde hob Sill die Rechte und deutete zur Türe. Der Diener entfernte sich mit einer kurzen, stummen Verbeugung.
Mit geschlossenen Augen lehnte er das Haupt auf das kühlende Leder des Klubsessels.
Das Schweigen unterbrachen nur lange Atemzüge.
Damm langte zu einer der Flaschen, schenkte Sill ein und griff zu einer anderen, um sich selbst zu bedienen.
Sill schien von diesem kameradschaftlichen Entgegenkommen keine Notiz zu nehmen.
Seine Brust hob und senkte sich.
Und dann kam es langsam von seinen Lippen.
»Martin, du hast dich sehr gründlich mit Gisela unten im Stollen ausgesprochen!«
Die Augen blieben geschlossen.
»Ja! Jose!« Ruhig ertönte die Entgegnung.
»Und das Ergebnis————?« Sills Stimme blieb gleich teilnahmslos. »Darf ich es wissen?«
»Haben wir noch heute nachmittag in die Karten eingetragen!«
»Soooo——in die Karten——eingetragen!«
Sill öffnete träge die Augen.
Martin Damm verharrte in verborgener Angriffsbereitschaft, auf alles gefaßt. Wußte Gisa nicht, daß auch dort unten Abhörmikrophone eingebaut waren?
»Verzeih, Martin! — Ich hatte eine andere Antwort erwartet!«
»Eine andere Antwort?«
»Ja!« Sill lächelte, beugte sich vor und trank sein Glas mit einem hastigen Zuge aus.
»Ja!——« sagte er nochmals, fast enttäuscht.
»Du sprichst in Rätseln, Jose!«
»Na! — Lassen wir das. Ich glaubte so etwas wie eine liebe Vorsehung spielen zu können. Dort unten wart ihr ja endlich einmal allein!«
»Und?« begehrte ehrlich verblüfft Doktor Damm zu wisssen, der auf eine ganz andere Erklärung vorbereitet war.
»Es tut nicht gut, daß der Mensch allein sei!——Das steht wohl schon in der Bibel geschrieben!«
Damm, der bis in die letzten Nervenenden vibrierte, brach in ein befreiendes Gelächter aus:
»Jose! Ist deinem einsamen Herzen so kalt, daß du bereits ein glücklich liebendes Paar um dich sehen wolltest?«
Die erstaunt aufgerissenen Augen seines Gegenübers bewiesen Damm, daß jener von den Vorgängen im Stollen und der geheimen Absprache nichts, aber auch gar nichts wußte, und nur recht derb auf den Busch geklopft hatte, allerdings mit unvergleichlicher Schauspielergabe.
»Dann verstehe ich nicht euer bedrücktes Benehmen bei Tisch!« erwiderte Sill mit barscher Stimme.
»Und ich wiederum wähnte, daß die Ursache deiner offensichtlich zur Schau getragenen Interesselosigkeit an unserer heutigen Arbeit darin zu suchen sei, möglichst lange von einer unliebsamen Mitteilung enthoben zu bleiben! Diese Annahme schuf die etwas peinliche Beklommenheit, zumal mich Fräulein Verweer gebeten hatte, dir die nun einmal nicht mehr zu bestreitenden Tatsachen möglichst schonend beizubringen!«
»Ist lieb von ihr!« Sill nickte sinnend vor sich hin. »Aber glaubst du denn, Martin, ich hätte dich hierhergesehnt, dich als den erfahrenen Geologen, wenn ich nicht selbst schon geahnt hätte, daß meinem Werk Gefahr drohe, von einer Stelle, von der ich es am allerwenigsten erwartet hätte. — Mach's kurz! Sag mir, woran ich bin, und was wir vielleicht noch zur Abwehr eines drohenden Verhängnisses unternehmen können.——Wo liegt die Hauptgefahr?« Aus den Augen Sills lohte eine erschütternde Kraft, den Kampf mit einem ungewissen Schicksal aufzunehmen.
Die Zeit war vorbei, da das rein Menschliche des Gewalthabers noch Eindruck in dem Menschen Damm hätte auslösen können.
»Ein neuer, heftiger Erdstoß kann zum Bruch der Geisir- dampfröhre führen.....Über die Folgen bist du dir wohl klar!« Jetzt sprach hart und eindeutig der Wissenschaftler.
»Das wäre noch das Geringste!——Der gesamte Felsen kann sowohl umstürzen als auch versinken, wenn größere Verwerfungen in der magmanahen Erdkruste eintreten!«
»Du sagtest zweimal, kann.——Wären andere Möglichkeiten noch in Betracht zu ziehen?«
»Nur dann, wenn unter der Meeresoberfläche die Flanken des Daumenfelsens nicht steil, sondern schräg auslaufen, mit anderen Worten, seine Masse sich bei schrägem Verlauf derartig vergrößert, daß sowohl die Fundamentierung, wenn ich es so ausdrücken darf, eine flächenmäßig ausgedehntere ist, als auch, durch die Massenvermehrung bedingt, die Erschütterungsfestigkeit erhöht wird!«
—————
Sill griff zu seiner Flasche und goß sich das Glas bis zum Rande voll. Der Inhalt verschwand hinter den gierig geöffneten Lippen.
—————
»Kannst du das feststellen?«
»Ja, Jose! — Aber nicht von innen her. Ich müßte draußen mit irgendeinem Fahrzeug Peilungen rund um den Felsen vom Wasser aus senkrecht nach unten vornehmen!«
—————
Doktor Jose Sill saß, den Kopf in die Linke gestützt, stumm und unbeweglich da. Die Rechte drehte unentwegt den Stiel des Glases, und seine Augen verfolgten das Spiel der Farben im geschliffenen Kristall.
—————
»So kommt deiner Weisheit letzter Schluß zu dem gleichen Ergebnis, zu dem auch ich mich heute vormittag durchrang. — Verzeih! Ich hockte stundenlang in deinem Arbeitszimmer und studierte deine Zeichnungen, Aufrisse und angedeuteten Grundformationen. Ich gestehe ehrlich ein, daß ich so mißtrauisch war und sogar eure in den Heften niedergelegten Lotungsergebnisse mit den in den Karten eingetragenen auf das genaueste verglich. Es stimmte alles bis aufs letzte. Ich muß mich vergewissern! Du kennst mein Lebensziel! Ich bin kalt und krank vor Mißtrauen. Das ist wohl das Schicksal eines jeden Revolutionärs, immer fürchten zu müssen, daß selbst die Getreuesten in dem Augenblick, da man es am wenigsten erwartet, glauben, bessere Wege zur Verwirklichung oder — zur Vernichtung des fast fertigen Werkes gefunden zu haben. Ich hoffe, daß dieses ehrliche Bekenntnis, mag es auch erschüttern —« Sill blickte sein Gegenüber bezwingend an —, »unsere Kameradschaft nur festigt. Um auf deine Karten zurückzukommen — rund um die Insel gähnt unerforschte Leere! — Ich malte mir in Gedanken aus, wie dort die Grundrißkurven wohl verlaufen könnten, und wurde mir darüber klar, daß deine elektrische Peilsonde nur senkrecht nach unten hinreichende Genauigkeit ergibt, daß die weiteren Messungen nach draußen verlegt werden müssen! — Wir besitzen zwei große zerlegbare Paddelboote. — Glaubst du, daß von Bord dieser Nußschalen Peilungen möglich sind? — Der Einbau des Traggestells für deine Sonde in kardanischer Aufhängung bedeutet keine ernstliche technische Schwierigkeit. — Was hältst du von diesem Plan?«
Martin Damm schlug das Herz zum Zerspringen. Sill unterbreitete von sich aus den Vorschlag, den Gisa und er ausgesponnen hatten.
»In meiner Studienzeit habe ich viel gepaddelt! — Ich weiß, daß solche Boote seetüchtig sind, wenn man sie nur richtig bedient. — Somit bestehen meinerseits keine Bedenken gegen das Unternehmen.«
»Und Gisela?« fragte mit seltener Eindringlichkeit Doktor Sill.
Damm zuckte die Schultern.
»Es ist nicht jedermanns Sache mit Gummihautbooten auf dem Ozean herumzugondeln, geschweige denn — und das wird notwendig sein — in unmittelbarer Nähe einer gefährlichen Dünungsbrandung — sich auf exakte physikalische Messungen zu konzentrieren. Es gibt nur eine Möglichkeit, ich paddele und richte meine gesamte Aufmerksamkeit auf die Navigation, wenn ich mich so großsprecherisch ausdrücken darf, und sie bedient das Gerät.«
»Genau so dachte ich! — Mein Bedarf an Seeschiffahrt ist nach den dir bekannten Erlebnissen gedeckt!« lächelte Sill. »Bezeichne solche Einstellung getrost als Feigheit! — Es ist halt nicht jedermanns Sache! — Was Gisela betrifft, so rede ich morgen mit ihr. — Stimmt sie zu, so bezieht ihr übermorgen die Quarantäneabteilung. — Neben dem Zimmer, das du bewohntest, befindet sich ein zweites. Du kennst es nicht! — Auf alle Fälle ist damit in jeder Form der Rahmen gebotener Schicklichkeit gewährleistet. — Morgen sollst du selbst die Anfertigung der Aufhängevorrichtung überwachen. — Was ich noch sagen wollte! — Martin?« Sill stand auf und legte Damm, der nur unter Aufbietung allen Willens seine Erregung meisterte, beide Hände auf die Schultern. — »Wir haben zur Zeit zunehmenden Mond! — Ihr könnt nur des Nachts eure Tätigkeit durchführen. — Verstehst du mich? — Ein zufällig am Tag vorüberziehendes Flugzeug——reden wir nicht darüber, du weißt, was ich vermeiden muß. — Es geht nicht anders!«
Doktor Damm erhob sich gleichfalls.
»Martin!« Sill rüttelte an den immer noch fest umklammerten Schultern. »Ich weiß, welcher Gefahr ihr euch um meines Werkes willen aussetzt! — Das ist es nicht! — Es geht ja um viel mehr! — Um die mir anvertrauten Menschen! — Sie vor einem entsetzlichen Schicksal zu bewahren, ist meine heiligste Pflicht! — Ich alleine trage die Verantwortung. — Ich muß die Insel räumen, wenn du es für notwendig erachtest!«
Tränen standen in den Augen Sills. Er machte sich frei.
»Gute Nacht, Martin! — Vielleicht wird es dir schwer fallen, den erlösenden Schlaf zu finden. — Versuch's!«
Mit hastigen Schritten verließ Sill den Raum.
Als Martin Damm sein Schlafzimmer betrat, ekelte er sich vor sich selbst: Lüge, Verstellung, Betrug! — Tränen, Heuchelei, grandioses Theaterspiel bei jenem, der unter der Maske warmer Anteilnahme und Besorgnis den letzten Einsatz von ihnen verlangte. — Verlangte? — Vielleicht in der heraufbeschworenen Gewißheit, zwei lästige Mitwisser auf bequeme Art loszuwerden, nachdem er die letzten Erkenntnisse sich allein nutzbar gemacht hatte?
Die Bereitwilligkeit Sills, auf die feingesponnenen Pläne einzugehen, ja, sie vorwegzunehmen, lähmte tödlich alle Entschlußkraft.
Was würde morgen Gisa sagen?
Der Abschied, zwei Tage später im Quarantäneraum, war kurz gewesen. Doktor Sill hielt einige Sekunden die Rechte Martin Damms mit beiden Händen fest umklammert. Damm vermochte den herrisch fordernden und doch noch einmal eindringlich prüfenden Blick, ohne mit den Wimpern zu zucken, zu ertragen. Dann wandte Sill sich seiner ehemaligen Privatsekretärin zu, beugte sich über ihre Hand und berührte sie mit den Lippen. »Ich bewundere deinen Mut, Gisela! — Ein gnädiges Geschick möge euch behüten! Macht's gut und kommt mir gesund wieder! Ich werde mich etwas einsam fühlen in unserem schönen Eßzimmer. Gottlob, daß wir uns wenigstens am Fernseher ausplaudern können! Martin, sei nicht tollkühn, geh nicht zu nahe an die vernichtende Brandung heran! Noch einmal: Kommt mir gesund zurück!«
Rasch drehte Sill nach den letzten Worten den Verabschiedeten den Rücken zu und verließ mit den ihm eigenen hastenden Schritten den Raum. Damm schien es, als ob echte Rührung den Davoneilenden überwältigt habe.
Es währte nur kurze Zeit, da erschienen vier Männer in Gummianzügen, die das Paddelboot und noch einige Geräte trugen. Hinter ihnen schloß sich die Felsentür. Und bald darauf sprang das Felsentor auf, das den Weg in die ›Kammer der Schiffbrüchigen‹ und——in die Freiheit auftat.
In die Freiheit?
Martin Damm nagte an der Unterlippe. Seine Sinne bebten. Eine Flut wirrer Vorstellungen durchwogte die Gedanken.
Das war der erste kleine Schritt dem Ziele zu. Vielleicht der leichteste———der schwerste? Vielleicht nur ein vergeblicher Versuch? Ein kurzer, wild ersehnter Ausflug, der doch in das Gefängnis zurückführte?
Ich will erst einmal draußen sein! Diese unabdingbare Forderung überschrie alle zagen Einwände.
Die Gummimänner hatten längst das Boot aufgehoben, bemühten sich draußen bereits, das etwa acht Meter lange sperrige Ding aus der Außentür heraus auf den Felsenpfad einzuschwenken; wie mehrfache Versuche dartaten, ein nicht so einfaches Unterfangen.
Endlich gelang es!
Martin Damm ergriff die Peilsonde, Gisela Verweer die beiden kleinen Koffer mit Batterien und Zubehör.
Das Paar folgte schweigend den schon aus dem Blickfeld entschwundenen Männern.
Nach wenigen Schritten tat sich in der Abenddämmerung fast schwarzblau die Weite des Ozeans vor ihnen auf.
Sie verharrten stumm und ergriffen.
Gisela Verweer überwältigte der jahrelang entbehrte Anblick der freien, gewaltigen Natur.
Sie ließ die leichten Koffer niedersinken und lehnte sich an die sonnendurchwärmte Felsenwand. Ihre Augen tasteten in die unendliche Ferne des im tiefen Rubin streifig aufleuchtenden Horizonts. Abendrot!
Da senkte sich langsam ihr Haupt, und Tränen tropften aus den fest geschlossenen Lidern, perlten die Wangen hinunter und fielen lautlos auf den Felsenweg.
»Martin!« Wie ein Hauch traf das Wort sein Ohr.
Seine freie Rechte umfing kosend ihre Schultern und versuchte ihr Beruhigung zu geben.
»Komm, Liebste! — Bald sind wir ganz allein!« Ein liebes, inniges Flüstern war es nur. Beide kannten zu genau die hier noch überall verborgenen Mikrophone Sills.
Sie zog ihr Taschentuch aus dem Overall. Doch zart entwand es der Geliebte ihren zitternden Fingern und trocknete mit scheuer Andacht die letzten Spuren der grenzenlosen Erschütterung.
Sie nickte ihm dankbar zu, griff wie in gewaltsamer Ablenkung zu den zwei kleinen braunen Koffern.
»Komm! — Es ist wieder gut!« Und in dem unter Tränen lächelnden Antlitz leuchtete Seligkeit und unaussprechliche Zuversicht.
Unten trafen sie wieder auf die Gummimänner, die das Boot dicht am Hafen niedergesetzt hatten, genau an jener Stelle, an der einst Martin Damms Flugzeug verbrannte.
Einer von ihnen tat Damm mit Zeichen kund, daß er ihm noch einen Hinweis geben wollte. Eine mündliche Verständigung erschwerte der Aluminiumhelm auf dem Gummianzug. Zu zweit gingen sie etwa dreißig Meter den sanft geneigten Felsenhang aufwärts, bis zu einer kleinen Höhle, deren Gesteinstüre jetzt offenstand.
Damm nickte.
Er wußte Bescheid. Das war nach Sills ausführlicher Erklärung das Gelaß, in welches Gisela und er nach beendeter Fahrt das Paddelboot und die Geräte verstauen sollten, damit tagsüber keine Spur die Anwesenheit von Menschen verraten konnte.
Der Gummimann erklärte wiederum durch Zeichen den Schließ- und Öffnungsmechanismus und überreichte einen handfesten Dauermagneten, mit dem nun Doktor Damm hantierte, um sich mit der Arbeitsweise des ungemein geschickt angefertigten Schlosses vertraut zu machen.
Die Dämmerung verblich schon in nahender Nacht, als sie zu den Wartenden zurückkehrten.
Die vier verabschiedeten sich durch Kopfnicken und frohes Winken, schritten im Gänsemarsch den Weg aufwärts und entschwanden rasch den Blicken der Nachschauenden.
»Bitte, berühre mich jetzt nicht!« sagte Gisela, »Sill besitzt ausgezeichnete Radarfunksichtgeräte. — Oben in der Felsenkuppe stehen sie!«
»Der Teufel soll ihn holen!« entfuhr es Damm. »Dann kann er uns ja ständig bei der Arbeit beobachten?«
»Ist der Mond erst aus der Wolkenbank heraus, dann könnte er es mit seinen vorzüglichen Fernrohren sowieso!«
»Verfluchte Pest!« lautete die einzige Entgegnung.
»Komm! — Wir wollen die Geräte einbauen! — Ich sehne mich, auf das Meer hinauszukommen!« Gisela Verweer knipste eine der großen Stablampen an. Der strahlende Lichtkegel erhellte kreisrund den Arbeitsplatz.
Eine Viertelstunde währte es, bis das Boot startfertig war. Sie schoben es dem Wasser näher, das in kleinen regelmäßigen Wellen auf den Felsen spülte.
»So, jetzt quer zum Ufer legen!« rief Damm. »Ich glaube, wir können dann, ohne uns die Schuhe auszuziehen, einsteigen und vom Lande abdrücken. Auf den glitschigen Algen rutscht das Boot leicht ab, die Gummihaut erleidet so keinen Schaden durch Beschrammen!«
Das Werk gelang rascher und einfacher, als gedacht.
Beide saßen bequem auf den bereits aufgeblasenen Gummikissen. Damm ergriff eines der am Süllrand in Haken lagernden Paddel und stemmte es gegen den Grund.
»Nach Steuerbord etwas überlegen!« kommandierte er.
Da kam das Boot frei und schwamm.
Gisela wollte zu dem zweiten Paddel greifen.
»Laß nur! — Ich schaffe es allein!« sagte er.
Unter einigen kräftigen Paddelschlägen an Backbord kehrte das leichte Boot den Bug dem freien Ozean zu. Mit weitausholenden Bewegungen ruderte Damm. In stiller Genugtuung empfand Gisela Verweer, daß nur langjährige Übung ein so schnelles und geschicktes Manövrieren ermöglichte.
Als sie den Schutz des Molenkopfes verlassen hatten, fing die langgestreckte Dünung an, sie wie eine unsichtbare Schaukel zu heben und zu senken.
Leise strich der warme Nachtwind durch die Haare des Mädchens. Beide Arme hingen über Bord, und die laue Flut umspielte ihre Finger, die das Wasser gleichsam liebkosten. Sie hätte schreien mögen in jubelnder, inbrünstiger Freude.
Der fast halbe Mond trat hervor.
In seinem bläulichen Licht entsprangen dem rasch dahin-schießenden Kiel silbern aufleuchtende kleine Bugwellen, die sich immer wieder fächerförmig verbreiterten, tänzelten und in der Weite verebbten.
»Martin, lieber Martin! — Fahr weiter, immer weiter! — Ganz gleich wohin! — Nur nie wieder zurück!« Ihre Stimme ebbte in verhaltener Lebenslust und heißem Freiheitsdrang.
»Um morgen oder übermorgen elend zu verhungern und zu verderben, du liebe Törin, du!«
»Sei doch nicht so prosaisch!« Fast kläglich kam es zurück. »Ich weiß es ja selbst!«
Damm zog das Paddel ein. Das Boot trieb und stellte sich bald quer zur Dünung. Das große Schweigen umfing die beiden. Nur irgendwo an dem jetzt zu ihrer Seite im Mondlicht majestätisch aufragenden Felsendom grollte die Brandung.
Noch eine Weile stillen Genießens kosteten sie stumm aus. Dann begann die Arbeit.
Kurz nach Mitternacht versank die Sichel des Mondes. In ihrem letzten Licht hatte Martin Damm den Hafen angesteuert. Sie nahmen sich Zeit, das Boot in der Felsenkammer zu verstauen.
Die Nacht blieb warm, und sie badeten in scheuer Entfernung voneinander, unmittelbar am Rande der Mole, den Fels unter den Füßen, der drohenden Haifischgefahr so enthoben, denn niemals wagen sich diese gefräßigen Räuber in die seichte Nähe des Landes; das wußte Damm.
Das Trocknen überließen sie dem lauen, stetigen Wind.
Als sie später den Felsenpfad Arm in Arm hinaufstiegen, war noch kein Wort von ihren Fluchtabsichten gefallen. Zu stark wirkte das Erlebnis der endlich gekosteten, schmalen, kleinen Freiheit nach.
Sill empfing sie im Fernseher, kurz nachdem sie das Quarantänegemach betreten hatten. Er begehrte die ersten Erfahrungen der Fahrt und die Ergebnisse der Peilungen zu wissen. Wein und eine kleine Nachtmahlzeit standen in der Futterklappe bereit. Über eine Stunde gaben sie Auskunft, verplauderten nur die Zeit, bis sie sich trennten. Als Martin Damm lang ausgestreckt in seinem Bett lag, glaubte er noch nie zuvor in seinem Leben sich so wohl gefühlt zu haben. Eine unbändige Zuversicht durchpulste sein Sinnen, daß er sein Ziel doch irgendwie erreichen werde.
Das Tagewerk war von den Spätaufstehern schon um die Mittagsstunde vollbracht. Es galt lediglich, die Zahlen der Tiefenlotung in die Karten einzutragen, die nun auf den Reißbrettern in dem Quarantäneraum ruhten. Martin Damm suchte mit größter Genauigkeit auch hier eine wissenschaftlich saubere Arbeit zu leisten, hafteten doch den Einzeichnungen Unebenheiten an, die sich aus dem auf dem Meer nicht exakt bestimmbaren Standort ergaben.
Sill meldete sich nach dem Essen im Lautsprecher, teilte mit, daß er einen Fotoapparat durch die Futterklappe ihnen zukommen lassen würde. Damm möge täglich seine Karten fotografieren und die Kassetten mit den Platten in den Aufzug legen. Auf diese Weise könne er sich fortlaufend ein Bild von den neuen Feststellungen machen, ein Bild, das wohl umfassender und zuverlässiger sei, als die mündliche Berichterstattung es ermögliche. Vor ihrem Aufbruch, gegen sechs Uhr abends, wolle er im Fernseher noch etwas mit ihnen plaudern. Bis dahin möchten die kühnen Seefahrer getrost der Ruhe pflegen.
Gisela hatte vorher schon den gleichen Wunsch geäußert. Martin Damm langte sich ein Buch aus dem Schrank und meinte, er wolle in aller Beschaulichkeit etwas schmökern. Das Paar trennte sich, und jeder suchte sein Zimmer auf.
Der Lesende war schließlich doch eingenickt und wurde um halb sechs durch Giselas Klopfen und ihre Worte geweckt, das Abendessen stände schon auf dem Tisch.
Die Unterhaltung mit Sill währte nicht lange.
Die Dämmerung nahte, als sie den Felsenpfad hinabstiegen und das Paddelboot fertig machten. Der Mond war schon voller geworden. Die Nacht versprach ruhig und wolkenlos zu werden.
Bevor sie draußen auf See mit der Tätigkeit begannen, sagte Gisela Verweer:
»Martin! — ich hab' heute nachmittag nicht geschlafen, sondern geschrieben!«
»Geschrieben?« fragte erstaunt ihr Hintermann im Boot. »Etwa an mich? — Einen herrlich langen Liebesbrief?«
»Hör auf, du Spottvogel! — An dich schon! — Aber keinen Liebesbrief. So etwas verdienst du gar nicht, du ewig kühler Rechner!«
»O weh, o weh! — Das saß!« jammerte Damm in herzlich schlecht unterdrücktem Übermut, kostete doch auch er die Freiheit dieser sternenklaren Mondnacht aus.
»Schadet dir gar nichts, wenn du ein wenig in dich gehst! — Doch paß einmal auf! — Oben im Quarantäneraum können wir nicht ungestört miteinander reden, der Abhörmikrophone wegen. Hier auf dem Meer ist mir jede freie Sekunde zu schade. Während der Lotungen muß ich meine Gedanken auf die Arbeit konzentrieren, und diese längere Zeit unterbrechen hieße den Argwohn unseres Zwingherrn, der uns todsicher selbst beobachtet oder beobachten läßt, heraufbeschwören. Du mußt aber noch sehr vieles erfahren, bevor unser Fluchtplan greifbare Form annimmt. So nahm ich heute nachmittag eines unserer noch unbenutzten Eintragungshefte und schrieb im Bett liegend mit Bleistift. Das Kratzen des Füllfederhalters hätten die Mikrophone aufgenommen. Bleistift schreibt geräuschlos. Die Seiten habe ich so behutsam gewendet, daß nichts davon zu vernehmen war. Das Heft gebe ich dir nachher, wenn wir das Boot verstauen. Lies, bitte, nicht noch heute nacht, sondern morgen nach Tisch in deinem Schlafzimmer. Dort bist du sicher. Ein Abhörer kann nur annehmen, du arbeitest. Du mußt sehr eindringlich Satz für Satz lesen und den Inhalt dir einprägen, sehr genau einprägen! Morgen abend wickeln wir einen Stein in das Heft und versenken es weit draußen. Meine Aufzeichnungen etwa in Sills Händen würden unseren sicheren Tod bedeuten! Hast du alles verstanden?«
»Um Gottes willen, Gisa, du kannst einen wahrhaft das Gruseln lehren!« Der Stimme Damms war anzuhören, daß die unerwartete Eröffnung ihn stark beeindruckt hatte. Doch sie beschäftigte sich bereits damit, die Peilsonde in Betrieb zu setzen.
Beide schwiegen.
Da flammte gelbgrünlich das kleine Rund des Leuchtschirms der Braunschen Röhre auf.
Gisela Verweer schrieb das Beobachtungsergebnis nieder, während Martin Damm mit langsamen Paddelschlägen das Boot antrieb und nur von Zeit zu Zeit den aus den Umrissen des Daumenfelsens und der Entfernung geschätzten Standort angab.
Nach ihrer Rückkehr erwartete sie abermals Sill am Fernseher. Damm konnte seinem sichtlich erfreuten Zuhörer mitteilen, daß die bis jetzt untersuchte Flanke des Felsens sehr flach verliefe, weit weniger steil abfiele, als zu vermuten war. Dennoch wolle er systematisch auch in größerem Abstand vom Lande loten und erst in einigen Tagen sich der anderen Seite zuwenden, und diese sei ja wohl kritischer.
Es kostete ihn Überwindung, später, als er allein war, nicht sofort zu Gisas Aufzeichnungen zu greifen. Hätte sie weniger eindringlich gesprochen, würde er wohl der Versuchung erlegen sein. Doch den Schlaf störten wirre Träume, in denen Sill plötzlich wutentbrannt zu ihm trat und die Herausgabe des Heftes verlangte; sie rangen schließlich verzweifelt miteinander. Durch einen schmerzhaften Aufprall wurde er wach.
Er lag schweißgebadet auf dem Boden. Als er sich zur Nachttischlampe getastet hatte, bot sein Bett einen zerwühlten Haufen von Leinzeug, Kissen und Bettdecke dar. Er mußte es neu ordnen, und seine erregten Sinne fanden erst nach langem Wachen die Ruhe wieder. Übernächtigt erschien er gegen zehn Uhr zum Frühstück. Gisas besorgt fragenden Blick beantwortete er mit einem verneinenden Kopfschütteln.
»Ich hab' sehr schlecht geschlafen!« sagte er laut. »Joses Haifischabenteuer feierten eine niederträchtige reale Traumauferstehung bei mir. Ich kämpfte wie ein Löwe und bin dabei aus der Klappe gefallen!«
»Ach, daher Ihre liebliche Beule auf der Stirn. O Gott, Sie Ärmster!«
»Sehr viel Mitleid scheinen Sie ja nicht gerade zu empfinden!« knurrte Damm, aber immer noch genügend laut.
»O doch! Kommen Sie her!« Sie tastete sacht mit der Hand über die Schwellung. »Heile, heile Segen! — Drei Tage Regen! — Drei Tage Schnee! — Tut's dem armen Haifischringer gar nicht mehr weh!« Sie blies über seine Stirn, und Martin Damm empfand in aller Verstellung still beglückt ihre Liebe in diesem seltsamen Morgengruß.
Erst nach dem Mittagessen zog er in seinem Schlafzimmer das Heft hervor und schlug es auf. Die stark empfundene Müdigkeit schwand schlagartig nach der ersten Seite. Jetzt wollte er erst einmal in einem Zuge das Ganze durchlesen und später in der Wiederholung sich den Inhalt so einprägen, wie Gisa es verlangt hatte:
»————So brauche ich Dir also nicht darzulegen, daß in dem oberen Teil des Hohlfelsens eine Betondecke eingezogen ist. Über ihr befinden sich noch drei Stockwerke, unter ihr hängt die künstliche Sonne. Das über diesem Leuchtkörper befindliche Geschoß enthält, außer dem Privatlabor von Sill, Meßgeräte, Regelapparaturen, Umformer und Aggregate, die die verschiedenen Gleich- und Wechsel-spannungen erzeugen und zum Betrieb und Schalten der künstlichen Sonne dienen. Die technischen Einzelheiten zu beschreiben, gehört nicht hierher. Von diesem Raum führt ein aus dem Felsen gehauener Gang in Halbbogenform nach unten. Er endigt in Sills Privatzimmer hinter einem schwenkbaren Bücherschrank. Die eingehauenen Stufen zu ersteigen, würde bei der Höhendifferenz von nahezu dreihundert Metern menschliche Kräfte auf die Dauer zu sehr mitnehmen. Daher ist links der Treppe eine Zahnstange eingelassen, rechts davon eine Stahlschiene. Eine kleine elektrisch betriebene Zahnradbahn, ein Kasten, der im Höchstfall drei Personen Platz gibt, vermittelt rasch und mühelos den Auf- und Abstieg. Die Energiezufuhr erfolgt durch einen an der Deckenwölbung auf Isolatoren gespannten Fahrdraht. Du ersiehst aus der kurzen Beschreibung, daß auch in diesem Fall wieder mit allen Errungenschaften neuzeitlicher Technik gearbeitet wurde.
Doch laß mich jetzt bei dem oberen Stockwerk, dicht unter der Kuppel, mit meiner Schilderung fortfahren, denn dieses Gemach birgt all die Geräte, die unsere Fluchtpläne sehr, sehr stark gefährden. Außer einigen höchst modernen Funkmeß- und Sicht-Apparaturen der Radartypen stehen dort zwei vollautomatische kleinkalibrige Kanonen und ein 10,5-cm-Geschütz. Die Felsenkuppel ist in Wahrheit eine hydraulisch hochhebbare Stahlkalotte. Beobachtungsfernrohre ergänzen die bis ins letzte durchdachte Ausrüstung. Es befindet sich dort auch die Zentrale für drahtlose Telegrafie und Radioempfang.
Die Schnellfeuerkanonen sind analog den Flugzeugabwehrwaffen direkt mit den Funkmeßgeräten gekuppelt.
Wie hervorragend die Treffsicherheit der Waffen ist, weißt Du aus jenem kleinen Loch in der Tragfläche Deines in Brand geschossenen Flugzeugs, und solltest Du den Tatbestand wider mein Erwarten nicht richtig eingeschätzt haben, so weißt Du jetzt, wie das sogenannte Unglück geschah. Ein leichtes Anheben der Panzerkuppel genügt, um das Schußfeld freizumachen.
Bei Tage würde jeder Annäherungsversuch eines unbewaffneten Schiffes mit dessen Untergang enden, bevor nur ein einziges SOS-Funksignal seine Antennen verlassen hätte.
Nicht mehr bei Nacht!
Du erinnerst Dich, daß ich an einem Sonntag, vor etwa drei Wochen, angeblich einer neuen Arbeitskraft Anleitung zur Bedienung der künstlichen Sonne erteilen mußte. Tatsächlich aber waren Störungen in den Funkmeßgeräten aufgetreten. Ich behob sie und nahm die Gelegenheit wahr, den Kupplungsmechanismus mit den Schnellfeuerkanonen in einem unbewachten Augenblick so zu verstellen, daß ihr Treffpunkt jetzt, von der Insel aus gesehen, rechts von dem Ziel liegt. Bitte, merke Dir diese Tatsache, sie kann von ausschlaggebender Bedeutung sein, ja, muß es sein, denn sonst könnten wir jetzt schon jede Fluchtabsicht aufgeben.
Da wir sowieso nur des Nachts den Felsen verlassen dürfen, bestehen Aussichten, daß unser Vorhaben gelingt. Ein Einsatz auf Leben und Tod bleibt es dennoch. Aber lieber mit Dir draußen untergehen, als länger die luxusverbrämte Sklaverei ertragen. (Dieser Satz war in der Niederschrift dick unterstrichen.)
Es bedarf wohl keiner weiteren Erklärung, daß die Bedienungsmannschaft der Geschütze im Ernstfall mit den plumpen Gummianzügen nicht arbeiten kann. Sie lebt als einzige in ständiger Berührung mit der Außenluft. Ihre Unterkunft gewährt ihnen das Mittelgeschoß, von dem ich noch nicht sprach. Nur Sill und ich besitzen Spezialgummianzüge, in deren Helmen Mikrophone und Lautsprecher montiert sind, um uns verständigen zu können. Zwischen dem Mittelgeschoß und dem Stockwerk der künstlichen Sonne sind drei Schleusen eingebaut, so daß keine unfiltrierte Luft in das Werk dringen kann. In der mittleren Schleuse muß man sich bei der Rückkehr zehn Minuten in einer nach dem Eintritt zuströmenden Giftgasatmosphäre aufhalten, die selbst die dem Gummi eventuell anhaftenden Mikroben vernichtet. Übrigens müssen sich die Gummimänner, die den Felsen zur Entladung des regelmäßig eintreffenden Dampfers verlassen, jedesmal der gleichen Prozedur unterwerfen. Der Desinfektionsfanatismus Sills gegen Umwelteinflüsse erreicht hier seinen Gipfelpunkt. Das nur nebenbei vermerkt.
In kurzen Zügen ist das die Darstellung der Einrichtung des Obergeschosses.
Und nun krame einmal Deine Geschichtskenntnisse hervor! Versetze Dich über 400 Jahre zurück in die Zeit der Entdeckung Amerikas! Spanier unter Cortez' Führung eroberten das Reich der Azteken und vernichteten in ihrer Bekehrungswut zum Christentum ein gewaltiges, nach ihren Begriffen heidnisches Reich und dessen teuflische Götzen. Das heutige Mexiko war der Schauplatz fürchterlicher Gemetzel. Eine große Kultur versank. Nur Steinbauten zeugen noch von der Tatkraft der später Geknechteten. Doch diese Steinbauten geben unseren Archäologen manches Rätsel auf. Eines davon ist: Wie vermochten jene Azteken ohne Stahlwerkzeuge Felsblöcke so zuzuhauen, daß sie mit kaum begreiflicher Präzision auf- und ineinander paßten wie maschinell zugerichtete Flächen. Vergleiche einmal Deine Befunde der fast luftdicht schließenden Felsentore und -türen hier mit jenen der Ausgrabungen in Mexiko!
Und ein zweites! Die Gerüchte wollen nicht verstummen, daß heute noch, besonders in Mexiko, Nachfahren der alten Herrscher- und Priesterkaste existieren, die sich, in von Vorfahren und Nachfahren genährtem Haß gegen alles, was weißer Rasse ist, abkapseln und die Wiederkehr der alten Macht ersehnen.
Sill gehört zu jenen!
Ob er ihr Oberhaupt ist oder nur ihr Werkzeug, vermag ich nicht zu entscheiden.
Tatsache ist, daß jene fünfundzwanzig Einwohner des von niemandem außer Sill und mir je betretenen Obergeschosses, die Bediener der Geschütze, dieser Kaste angehören müssen.
Sie tragen alle grellfarbige, altertümliche Gewänder, wie wir sie nur aus überlieferten Berichten kennen. Stirn und Hinterhaupt umschließt bei jedem von ihnen ein fingerbreiter Goldreif. Schon in frühester Jugend müssen sie solche getragen haben, denn der Schädel der meisten ist eiförmig deformiert. Gewiß ist Dir aufgefallen, daß auch Sills Kopf ähnliche, wenn auch nicht so ausgeprägte Merkmale aufweist.
Verständigen durfte ich mich nur mit zwei von ihnen, die hinlänglich deutsch sprechen.
Ich weiß, daß Sill viele Stunden, die er angeblich in seinem Privatlaboratorium verbringt — einem von mir nur wenige Male betretenen Raum im ersten Obergeschoß, also über der künstlichen Sonne —, im Kreise seiner Rassegenossen verlebt. Er trägt bei diesen Zusammenkünften stets seinen Gummianzug. Die Indios trinken jenen fremdartigen, berauschenden Stoff, den Sill jeden Abend auch in unserer Gegenwart zu sich nimmt. Gewiß ist es Dir aufgefallen, daß Sill fast nie den Getränken zusprach, die er uns anbot. Er trinkt so gut wie nie Alkohol, und wenn Ihr gemeinsam Wein tranket, so ist Dir gewiß nicht entgangen, daß er seine und Du Deine Flasche vor Euch hattet, angeblich der Bequemlichkeit halber, daß jeder sich so bedienen konnte, wie es ihm beliebte. In Wirklichkeit aber, um unbehelligt seinem ureigenen Genuß nachzugehen.
Ich kann in dieser kurzen Aufhellung der Tatsachen nicht schildern, was ich im Laufe der Zeit noch mehr von dem priesterlichen Kult dieser Besessenen erfuhr. Später, später, Martin, wenn wir frei sind!
Etwa ein halbes Jahr nach meinem Eintreffen auf der Insel kam ein weiterer Physiker an. Ich war damals schon Sills Privatsekretärin. Der Neuankömmling erzählte mir eines Tages, daß ein gewisser Doktor Jose Sill, der Erfinder der künstlichen Ernährung, in seiner Heimat Mexiko durch einen Unglücksfall ums Leben gekommen sei. Eine kleine Notiz in der Chemikerzeitung habe das besagt, und um so erstaunter wäre er, daß der Tote jetzt hier noch quicklebendig seine Versuche fortsetze. Wenige Stunden später kränkelte der Schwätzer. Vierundzwanzig Stunden darauf verstarb er. Er wurde feierlich eingeäschert.
Trifft diese Aussage zu, dann bietet sie die einzige Erklärung dafür, daß Sill hier so ungestört arbeiten kann, denn den Vertrag kennst Du, genau so wie ich.
Die Geldmittel, die seine angeblichen Erben weiter beziehen, reichen aber bei weitem nicht aus, das ohne jeden Zweifel hervorragend organisierte Werk aufzubauen und zu unterhalten. Steckt jedoch hinter diesem utopischen Vorhaben eine weitverzweigte Geheimsekte, dann erst wird vieles Unerklärliche verständlich.
Haß, Wahn, Machthunger, Rache sind die Triebfedern. Ein nihilistisches Chaos das Ende!
Ich will nicht abschweifen! Deine Gedanken werden sich in ähnlicher Richtung bewegen.
Doch höre weiter!
Sill setzt alles auf eine Karte! Er weiß genau, daß der Insel beträchtliche Gefahr droht. Vor zwei Jahren versoff bei einem Erdstoß die gesamte Kohlengrube. Unter unerhörter Anstrengung gelang es, die Einbruchsteile des Wassers abzudichten und die Förderung wieder aufzunehmen. Schon zweimal geschah es, daß nach Erdstößen für mehrere Stunden die Dampfgeisire versiegten. Nur sehr langsam begannen sie wieder zu sprudeln, um erst nach Tagen ihre normale Tätigkeit zurückzugewinnen.
Sill ist das Schicksal seiner tausend Mitarbeiter völlig gleichgültig, nicht aber das eigene und jenes seiner goldbereiften Mitverschworenen.
Kurz nach dem Wassereinbruch im Bergwerk begann Tag und Nacht ein dauerndes Pochen und Bohren und, wie ich annehme, auch Sprengen im Fels. Ich durfte damals drei Wochen lang mein Zimmer — es war dasjenige, welches Du erhieltest — und den Eßraum nicht verlassen. Die Türen zum Gang waren verriegelt. Doch vernahm ich in fast regelmäßigen Abständen das sanfte Rollen von schweren, gummibereiften Fahrzeugen, die sich durch den Quarantäneraum entfernten. Ich habe wohl nicht fehlgeschlossen, daß Gesteinsmassen, die in dem neuerbohrten Stollen gebrochen, vom Felsenweg aus in den Ozean geschüttet wurden.
Einige Wochen darauf sollte der Dampfer wieder einlaufen. Ich wurde von Sill im Gummianzug zu dem wachhabenden Indio in die Kuppel beordert. In der Dämmerung erschien das Schiff am Horizont. Mir tauchten Zweifel auf, ob es sich auch wirklich um unseren Dampfer handelte, waren die Umrisse doch seltsam verzerrt. Überdies ließ das Flimmern der noch heißen Luft über dem Ozean keine exakte Beobachtung zu. Erst als ich eine kleinere Vergrößerung in dem Fernrohr verwandte, erkannte ich für Bruchteile von Sekunden, daß das Schiff längsseits ein großes Boot, der Form nach ein Motorboot, im Schlepp führte.
Ich erstattete Sill telefonisch Meldung. Er antwortete, ich müsse mich in meiner Wahrnehmung getäuscht haben, könne aber den Posten verlassen und zu ihm zurückkehren.
In dieser Nacht geschah Ungewöhnliches. Sill verließ mich eine Stunde später im Gummianzug. Stundenlang wurden dann Metallplatten durch den Quarantäneraum in den neuen Stollen transportiert, ich konnte das von meinem Schlafzimmer aus sehr gut wahrnehmen. Die Tatsache war mir insofern befremdend, als sonst sämtliche Güter auf den Rollprahmen in die große Desinfizierhalle gebracht wurden. Der naheliegende Schluß lautete: Die Platten sind nicht für die Siedlung bestimmt, sondern finden irgendwo im oder am Ende des neuen Stollens Verwendung.
Der Rätsel gab es für mich Neuling damals noch übergenug. Die Angelegenheit: Stollen, Metallplatten und Motorboot beschäftigte mich wohl deshalb mehr als andere, weil ich unmittelbarer Hörzeuge von Vorgängen war, die offensichtlich den Siedlern verborgen bleiben sollten.
Der Aufklärung wäre ich ganz gewiß nicht um einen Schritt näher gekommen, wenn Sill nicht einige Tage später fuchsteufelswild in seinen Akten gewühlt und nach einer Aufzeichnung chemischer Formeln gesucht hätte. Ich half. Schließlich sprang er wütend auf und befahl mir, den Papierkorb auf das gründlichste zu durchsuchen. Er selbst wolle in seinem Labor nachsehen. Dann rannte er fort. Ich blieb allein und tat, wie mir geheißen. Den Zettel mit den Formeln fand ich nicht, wohl aber auf einem Blatt zwei merkwürdige, recht primitive Handzeichnungen, die nur deshalb plötzlich meine Neugier wachriefen, weil neben viel Undeutbarem ein Pfeil auf eine schraffierte Spalte wies und daneben der Hinweis: Al-Platten. Ich hatte ein entsetzlich schlechtes Gewissen, als ich, mehr instinktiv als meiner klaren Vernunft folgend, den zerknitterten Wisch einsteckte.
Bald darauf erschien Sill freudestrahlend, das Papier in der Hand schwenkend. Oben im Labor habe er es vergessen. Wir arbeiteten friedlich weiter. Kein Wort fiel von dem Papierkorb. Der Sicherheit halber entleerte ich seinen Inhalt noch am gleichen Abend in den dafür vorgesehenen kleinen elektrischen Verbrennungsofen.
Abends vor dem Schlafengehen studierte ich die entwendete Skizze. Die eine Abbildung sollte wohl einen Spalt im Felsen vom Meere aus gesehen darstellen. Dieser Spalt war laut Darstellung und Maßangaben an der Meeresoberfläche vier Meter breit und verjüngte sich nach oben auf zwei Meter. Unten stand ein Hinweis: Tor. Oben: AI-Platten. Daneben sehr flüchtig gekritzelt und zunächst durch die Zerknitterung des Papiers kaum zu entziffern: Eloxierte Al-Platten, graugrün, zirka 10 mm.
Die zweite Zeichnung gab den Querschnitt der ersten wieder. Abermals unten: Das Wasser, und deutlich erkennbar die Umrisse eines Motorbootes. Am linken Rande wieder das Wort: Tür, darüber: Al-Platten-Abschluß. Der rechte Rand zeigte eine Leiter mit Podesten in etwa fünf Meter Abstand und neben dieser Leiter, mal rechts, mal links, ebenfalls von Podest zu Podest führend, wohl als Parallele gedachte, aber sehr verkrakelte Linien mit dem Pfeilhinweis: Rutschrohre. Am oberen Ende der Leiter wiesen zwei Striche in den schraffierten Felsen hinein. ›Stollenausgang‹ stand da geschrieben.
Es bedurfte wohl keines besonderen technischen Scharfsinnes, nachdem ich erst einmal Zeichnung und Beschriftung entziffert hatte, um mir ein Bild von den vorhandenen Tatsachen zu machen.
Der Zweck des Stollens war mir jetzt klar. Das im Fernrohr beobachtete Motorboot war keine Sinnestäuschung, sondern es liegt jetzt tatsächlich verborgen in der mit Aluminiumplatten verdeckten Felskluft. Die Leiter und die in Abstände unterteilten Rohre zum Hinabrutschen gewähren ein rasches, sicheres, von den unterirdischen Siedlern nicht bemerkbares Entkommen mit dem Motorboot im Falle der Gefahr.
Den mir alles verratenden Zettel habe ich aufgegessen, genau so wie Du den Deinigen im Bergwerk.
Die Zeit drängt. Ich muß Schluß machen. Präge Dir alles, besonders die Anlage des Bootsliegeplatzes, ein! Das Heft müssen wir heute nacht im Meer versenken. Eher hab ich keine Ruh!
Herzlichst
Deine
Gisa.«
Martin Damm konnte seine Aufregung kaum noch meistern, als er die Niederschrift zu Ende gelesen hatte.
Mein Gott, was wußte diese Frau alles! Mehr noch, wie hatte sie schweigen können, kühl und abwehrend unter ständig gleicher Maske, die einzige Vertraute Sills, nie seinem bezwingenden Einfluß erliegen, ihr Sinnen jahrelang auf ein Ziel gerichtet, ihre Kenntnisse auszunutzen zur Flucht! Und wie oft mußte sie enttäuscht worden sein! Denn all diejenigen, die neu angekommen waren, wurden nach kurzem Aufenthalt im ›Himmel‹, den der Zwingherr nur ausnutzte, die Charaktere zu erforschen und aus Menschen willfährige Objekte zu machen, auf die ›Erde‹ der unterirdischen Siedlung gesetzt. Von dort aus gab es kein Zurück, keine Mithelfer mehr! Der wohlbewachte Aufzug stellte eine nicht zu ersteigende ›Himmelsleiter‹ dar.
Und dann war er gekommen und durfte, mußte oben bleiben, damit kein Wort über den wahren Sinn des angeblichen Vermessungsvorhabens zu den Ohren der Siedler dringen konnte. Niemals hätte er trotz Vertrag und häufiger Beteuerung die Insel verlassen dürfen. Sill wollte auch ihn als engsten Mitarbeiter ausnutzen und hatte mit seiner feinen Witterung erspürt, daß Gisa ihm nicht gleichgültig geblieben war. Die Worte in jener Nacht: ›Es tut nicht gut, daß der Mensch allein sei!‹ erhielten nun einen neuen Sinn, ein verliebtes und später verheiratetes Paar noch bedingungsloser an sich zu fesseln.
Ein widerlich schreckhafter Gedanke sprang in ihm auf. Liebte ihn Gisa wirklich? Oder war auch hier Täuschung und Betrug, nur um des eines Zieles willen, die Freiheit wiederzuerlangen?
Damm schüttelte der Ekel vor sich selbst, vor diesem teuflischen Werk, ja, vor der geliebten Frau.
Hatte er diese Kühle und Beherrschte nicht rasch, sehr rasch, zu rasch erobert?
Er suchte in der zermahlenden Erinnerung ihre sparsamen Zärtlichkeiten, ihre wenigen gefühlstrunkenen Worte auf ihre Echtheit zu prüfen. Die Deutung verzerrte die sezierende Zweifelsucht.
Eiskalter, eisgefrorener Entschluß schob nach wenigen Sekunden brütenden Vorsichhinstarrens alle fahrige Zersplitterung zur Seite. Die Zeit drängte!
Lesen! Noch einmal lesen! Das, worauf es in erster Linie ankam, einhämmern, wie mit Meißeln in Granit!
Er wendete das Heft und begann von neuem.
Sein Herz aber pochte: Gisa, Gisa, Gisa! — Und er wußte später, daß in dieser Stunde des Zweifels eine unerschütterliche Liebe tiefe Wurzeln geschlagen hatte.
Die Nacht der Entscheidung nahte. Sill und Damm saßen sich im Fernseher gegenüber.
Gisela Verweer nahm, dicht neben Martin über eine Karte gebeugt, nur als aufmerksame Zuhörerin teil. Der Fluchtplan war bis ins letzte durchgesprochen. Es galt in dieser Stunde, Sills immer wachen Argwohn auf eine falsche Fährte zu lenken.
»Jose!! Du gibst den gestrigen Lotungsergebnissen eine geologisch nicht hinreichend eindeutige Erklärung!« hub Damm wieder an. »Du hast ja die Fotokopie vor dir! -Bitte betrachte die in ihrer Tiefe sehr schwankenden, unterseeischen Bodenerhebungen, die von der nördlichen Flanke sich im Bogen nach Nordwesten ziehen. Lege ich meine bisher noch durch nichts widerlegte Theorie des zerborstenen Vulkans in unmittelbarer Nachbarschaft der Insel zugrunde, so scheint auf den ersten Blick gerade diese Aufnahme meine Voraussetzungen zu bestätigen. Es kann sich aber auch anders verhalten!«
Gisela Verweer wußte, daß die jetzt angeführten Lotungsergebnisse nur um des einen einzigen Zweckes wegen sorgfältig gefälscht waren.
»Nichts liegt meines Erachtens näher«, erwiderte Sill, »als daß deine Theorie stimmt. Damit wäre die gefährdete Westflanke durch feste Urgesteine gestützt, so daß die Möglichkeit des Nachgebens der Sedimentschicht in diesem sozusagen ummauerten Kessel ausgeschlossen ist!«
»Verzeih, Jose! Du mußt dir immer vor Augen halten, daß die Kohle führende Sedimentschicht nur entstanden sein kann, wenn der Meeresspiegel der in Frage kommenden Spätkarbonzeit erheblich tiefer lag als jetzt, oder, was dasselbe bedeutet, das Land so weit aus dem Wasser ragte, daß Vegetation darauf bestand. Sonst konnte keine Kohle entstehen.«
»Das ist mir klar!« sagte Sill, aufmerksam der Erläuterung folgend.
»Weiter...« fuhr Damm fort. »Hat sich unsere Insel gemeinsam mit ihrer Umwelt gesenkt, so blieb ihr Untergrund in festem Kontakt mit dem umgebenden Urgestein. Diese Vorstellung bedeutet nahezu ideale Sicherheit. Verlief aber der Absenkungsprozeß ungleichförmig, dafür könnte man viele analoge Tatsachen in der Verwerfung der Erdkruste anziehen, dann müßte sich durch exakte Messungen ein Sprung im Gestein, ein Riß, eine Verschiebung der Urgesteinshorizonte ergeben. Bei den Peilungen vom Bergwerk aus waren diese deutlich nachzuweisen.«
»Und?« fragte Sill, als Martin Damm einen Augenblick schwieg, als ob er seine Gedanken sammeln wollte.
»Dann geht es darum, festzustellen, ob auch in den stützenden Kraterrandbögen ein Abgleiten erfolgt ist!«
»Das ist doch mehr als einleuchtend!« Sills Augen blickten verblüfft, fast erheiternd aus der Bildscheibe des Fernsehers.
»Einleuchtend schon«, lachte Damm. »Aber vielleicht sehr einfeuchtend!«
»Wieso?« stutzte Sill.
»Weil wir diese Messungen in unmittelbarer Nähe der westlichen Steilflanke vornehmen müssen, und gerade da erzeugt die Dünung eine scheußliche Brandung in dem Felstrümmergewirr, das dort liegt! — Wir müssen aber zumindest an zwei Stellen so dicht wie möglich heran, denn nur senkrecht nach unten, das weißt du ja, kann ich mich auf die Meßergebnisse wirklich verlassen, sonst hätten wir ja nicht die kardanische Aufhängung für die Peilsonde in das Paddelboot eingebaut.«
Es währte eine Weile, bis Sill sehr nachdenklich antwortete:
»Leider hast du recht! — Ich sehe das jetzt erst ein. — Die Lotungen weiter draußen——.« Er schwieg. Im Lautsprecher pochte das unentwegte Aufklopfen seines Bleistiftes. Sill hob mit Ungestüm den Kopf. »Martin, kannst du das verantworten?« Aus der Stimme klang eine geradezu bestürzende Sorge. Und dann sprudelte es aus ihm hervor: »Zum Teufel! — Ich weiß, daß alles, was mit Seewasser zusammenhängt, mir verhaßt ist. Der Haß des Feiglings, der mit diesem nassen Element nun einfach nicht zurechtkommt. Ich könnte mich vor dieser Selbstentblößung schämen. Ich kann es aber nicht! Ich muß es einmal aussprechen. — Seit nunmehr zehn Tagen bewundere ich mit Neid eure Gelassenheit, mit der ihr da draußen im Mondschein herumpaddelt, und gäbe was darum, es euch gleichtun zu können. Ich kann es nicht. — Ich kann es nicht!« Wütend hieb die Faust auf die Tischplatte, daß der Lautsprecher dumpf dröhnte.
Die beiden sahen im Fernsehbild, wie Sill in seiner üblichen Hast ein Glas einschenkte und den gesamten Inhalt in einem Schluck herabzwang.
Damm schwieg. Er fieberte um die Entscheidung.
Schon nach kurzem Abwarten tat das Narkotikum sichtlich seine Wirkung. Der rasende Gefühlsausbruch Sills machte stoischer Ruhe Platz.
»Martin! Du glaubst also wirklich das gewagte Unternehmen verantworten zu können?« fragte die Stimme aus dem Lautsprecher.
»Wir sind so aufeinander eingespielt, daß ich es ohne Bedenken kann!« antwortete Damm.
»Und du, Gisela?«
»Das Boot ist hervorragend wendig und seetüchtig, Doktor Damm ein vorzüglicher Paddler, da gibt's doch gar nicht so viel Aufhebens zu machen!«
»Na! — Wieder typisch Gisela Verweer!« meinte Sill kopfschüttelnd. »Angst kennt sie nicht, und zäh wie Hundsleder ist sie auch, wenn es gilt, eine einmal begonnene Arbeit durchzuführen. — Gut denn! Ich hab eingesehen, daß wir nur so zum Ziele kommen. Also los! Hals- und Beinbruch — und laßt mich heute nacht nicht zu lange warten!«
Im gleichen Augenblick verlosch die flimmernde Fernsehscheibe. Die brüchig gewordene Stimme zerbrach in einem kurzen Knacken des Lautsprechers.
Martin Damm und Gisela Verweer verließen stumm den Raum.
Der bereits wieder abnehmende Vollmond warf den gespenstisch harten Schatten des Daumenfelsens auf das silbrige Meer.
Stumm schritten beide nebeneinander den felsigen Pfad abwärts.
»Pfui Teufel!« raunte Martin Damm, plötzlich seiner Bitterkeit Luft machend.
Gisela tastete nach seiner Hand.
»Nicht davon sprechen, Liebster!«
————
»Gisa!«
»Ich weiß! — Sill vertraute uns!«
»Ja, Gisa!«
————
Und dann, nach einer Weile: »Lieber hätte ich ihm die Wahrheit ins Gesicht geschrien! — Gisa!« Er riß sie bebend an sich. »Es ist entsetzlich, lügen zu müssen!«
Das Paddelboot ruhte auf der glatten Felsfläche dicht vor dem leise plätschernden Meer.
»Reich mir bitte einmal den Schraubenzieher und stell dich so hinter mich, daß ich von oben nicht gesehen werden kann. Ich will die zwei Schrauben im Süllrand lockern, damit du nachher mit einem einzigen Griff den Peilsondenhalter aus seinen Schlitzen ziehen und auf das vordere Verdeck umlegen kannst. Nur so hast du genügend Bewegungsfreiheit, dein Paddel ohne Hindernisse zu betätigen.«
Gisela Verweer tat, wie ihr geheißen.
Das Werk war rasch vollbracht und das Boot in das Wasser geschoben.
Wenige Minuten später schon zog es außerhalb des kleinen Hafens seine Bahn durch die silberne Flut.
Wird es das letzte Mal sein, daß wir hier hinausfahren? Beider Gedanken waren die gleichen.
Martin Damm brach das zermürbende Schweigen.
»Du bist wirklich überzeugt, daß keine elektrischen Sicherheitsvorrichtungen an dem Liegeplatz des großen Motorbootes angebracht sind?«
»Ich halte es für völlig ausgeschlossen. Die Indios sind zwar recht anstellig beim Bedienen der gesamten Anlagen in der Kuppel, zur selbständigen Tätigkeit aber völlig unbrauchbar. Sill selbst ist gelinde gesagt zu faul, um derartige komplizierte Anlagen persönlich zu installieren. Außerdem hätte ich seine tagelange Abwesenheit bemerken müssen. Für solche Zwecke wäre nur einer unserer Mechaniker in Frage gekommen. Keiner von ihnen ist in dieser Zeit oder später verschwunden, und er hätte nach Sills sonst getätigten Prinzipien als Mitwisser eines derartigen Geheimnisses verschwinden müssen. Der Eingang zu dem Stollen befindet sich in Sills Schlafzimmer, hinter einer von keinem Uneingeweihten erkennbaren Tapetentür, das sagte ich dir ja gestern. Ich gehe sogar so weit, zu behaupten, daß Sill absichtlich jede Alarmanlage vermieden hat, um gegebenenfalls seine eigenen Rassegenossen zu verraten und sich selbst in Sicherheit zu bringen. Rechne nur, daß der Abstieg der fünfundzwanzig Azteken aus ihrem Turmgemach in rund fünfhundert Meter Höhe bis auf den Meeresspiegel im günstigsten Falle mindestens eine halbe Stunde beansprucht hätte. — Das ist viel Zeit, wenn eine Katastrophe droht! -Eine Alarmanlage hätte die sonst stoisch Ruhigen in begreifliche Aufregung versetzt, bin ich doch fest überzeugt, daß ihr Machteinfluß auf Sill so stark ist, daß sie verlangt hätten, daß auch bei ihnen eine Signalvorrichtung angebracht werden sollte, wie es bei allen im Werk vorhandenen üblich ist. Sill wird, sollten solche Pläne überhaupt angeschnitten worden sein, mit der ihm eigenen Überredungskunst sämtliche etwaigen Bedenken widerlegt haben, in der geheimen Absicht, sich selbst so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone zu retten. Das ist meine Ansicht!«
»Hm!« antwortete Damm nur, erschien ihm doch die Beweisführung bei dem Charakter des Zwingherrn durchaus stichhaltig.
Nach einer Weile des Schweigens fragte er:
»Wie groß schätzt du die Entfernung des toten Winkels von der Insel aus?«
»An der Westflanke verhindert ein Buckel des Daumenfelsens die direkte Einsicht derart, daß erst bei etwa achthundert Meter Abstand vom Eiland das Sicht- und Schußfeld frei wird«, entgegnete Gisela.
»Da hat er sich ja die Stelle vorzüglich ausgesucht. - Hoffentlich kommt auch uns der Tatbestand zugute!« meinte Martin Damm, und man konnte dem Ausdruck der Stimme entnehmen, daß seine Gedanken sich noch mit weit anderen Problemen beschäftigten.
Ruhig tauchte er die Paddel ein.
Das Boot zog einen Kreis um die Insel, doch immer noch weit außerhalb der gefährlichen Brandung, die an backbord im hellen Mondlicht sprühend aufblitzte.
Minute auf Minute verstrich.
»Ich gehe jetzt näher heran! — Bitte sage mir, wenn wir nach deiner Schätzung von oben nicht mehr eingesehen werden können.«
»Ja, Martin!«
Plitsch — platsch — plitsch — platsch, tauchten regelmäßig die Paddel ein.
Das Boot glitt in den Schatten des gewaltigen Daumenfelsens.
Gisela hob vorsichtig den Kopf. Nur ihre Augen spähten zur Kuppel.
Das Toben der Brandung dröhnte deutlicher und gefährlicher.
»Jetzt!« sagte sie.
»Dann setze bitte die Peilsonde in Betrieb, entferne sie aus der Aushängevorrichtung und richte sie freihändig gegen den Fels!«
Sie tat es.
Martin Damm beobachtete hinter ihr den Leuchtschirm der Braunschen Röhre.
»Halt! — Dort! —« keuchte er. »Der helle Streifen ist die Reflexion der Aluminium Verkleidung. — Halt das Ziel fest!«
Die Paddel schwangen rascher durch die Luft und versanken in kurzen harten Stößen im Meer.
»Dort scheint die Einfahrt zu sein. — Sie müssen die vorgelagerten Felsblöcke weggesprengt haben. — Das Wasser ist dort ruhiger, oder täusche ich mich?« flüsterte er, heiser vor Erregung.
————
Angestrengt spähte Gisa in die gewiesene Richtung. Hier im Mondschatten verschwammen die Umrisse sehr störend.
»Doch! -« sagte sie. »Es stimmt!« Ihre Stimme bebte. Die Peilsonde zeichnete die schmale Aluminiumwand im Felsen jetzt genau backbord querab.
Das Boot zog einen kurzen Bogen.
»Leg das Ding zwischen die Knie! — Greif zu den Paddeln!«
Das Wasser um sie herum begann zu quirlen.
Sie paddelten in schnell gefundenem Gleichtakt.
»Ich sehe die Fahrrinne! — Nur paddeln, nicht steuern!« forderte Damm.
Wenige Meter neben ihnen peitschte die Brandung um die Felsblöcke. Die hereingepreßten Wassermassen bildeten im Ausströmen Strudelfluten, die die Fahrt des leichten Bootes ruckartig hemmten und wieder jäh der Insel zuschnellen ließen.
Unmittelbar vor der steil aufragenden Daumeninsel wurde es ruhiger.
»Paddel einziehen!« Ein hartes Kommando.
Mit aller Macht bremste Martin Damm den letzten Schuß der verwegenen Fahrt.
Rumms!
Der Bug prallte mit unsanftem Aufschlag gegen eine Metallwand. Hohl dröhnte der Widerhall.
»Geschafft!« schnaufte eine brüchige Stimme hinter Gisela. »Braves Boot! — Hat durchgehalten!«
Das schlanke Fahrzeug stellte sich ohne jedes Zutun langsam quer, so daß es bald parallel zu der Aluminiumwand lag.
»Bitte etwas abstemmen!«
Gisela drückte mit beiden Händen das Boot ab.
Damm schwenkte sein Paddel nach steuerbord über und tauchte es, die Metallwand entlang gleitend, ein. Nach kurzem Niederschieben verspürte er keinen Widerstand mehr, legte die Rechte dicht über dem Wasser um das Holz und zog das Paddel wieder hinauf.
»Nicht einmal einen Meter tief, — das Tor im Wasser!«
Noch einmal senkte er das Paddel in die Flut, bis er auf Grund stieß. Wieder nahm er Maß.
»Etwa zwei Meter Fahrrinnentiefe!«
Die kurzen abgehackten Erklärungen besagten alles.
»Hast du die eingewickelte Stablampe?«
»Sie liegt neben deinem Sitz!« entgegnete Gisela.
Damm hatte die in wasserdichten Kunststoff eingehüllte Hülse bald ertastet.
»Hab sie!« sagte er. »Bitte bleibe jetzt still sitzen. Ich ziehe mich aus.«
Es war schwierig, in dem schmalen, hin und her schwankenden Boot sich der Kleidung zu entledigen.
Gisela Verweer verharrte in verbissenem Schweigen. Sie wußte, daß sie kurz vor der Entscheidung standen.
»Fertig!« tönte es hinter ihr. »Ich leuchte von innen gegen die Tür. Du wirst den Schein im Wasser erkennen können. — Dann ist alles in Ordnung!«
»Ja, Martin!«
»Geh dann mit dem Boot etwas weiter ab, für den Fall, daß sich die Torflügel nach außen öffnen!«
»Ja«
Damm steckte den zusammengedrehten Zipfel der Stoffhülle zwischen die Zähne. Er erhob sich vorsichtig, schnellte dann mit einer Geschicklichkeit, die auf viele Übung schließen ließ, über Bord.
Gisela Verweer hatte kaum den leichten Rückstoß des Bootes verspürt, sehen konnte sie nichts. Wasserspritzer übergossen sie.
Martin Damm war verschwunden.
Ihr Herz pochte zum Zerspringen. Die mühsam wiedergewonnene Ruhe zerstob vor der würgenden Angst, die den Hals zuschnürte.
Ihre Augen stierten auf die Wasserfläche dicht an der Metallwand.
Gib doch das Zeichen——das Zeichen!
————
Damm hatte mit wenigen Stößen das Tor untertaucht. Vorsichtig ließ er sich höhertreiben. Jetzt atmeten die Lungen wieder Luft. Pechschwarze Dunkelheit umgab ihn. Die geschützte Stablampe immer noch zwischen den Zähnen, suchte er mit langsamen Beinbewegungen und tastendem Paddeln der Hände irgendwo Halt zu gewinnen.
Nach einer ihm eine Ewigkeit dünkenden Zeit stieß die Rechte gegen etwas Kühles, Nasses, Hartes.——Stein!
Er ließ die Füße absinken.
Sie berührten Grund.
Da richtete er sich auf und riß mit den nun freien Händen die Schutzhülle von der Stablampe.
Ein Druck auf den Knopf.
Ein heller Lichtkegel traf auf das seitwärts vor ihm liegende Motorboot.
Jetzt der draußen Harrenden das Signal geben!
Einige Sekunden strahlte das Licht von der hocherhobenen Hand auf die stille Wasserfläche unmittelbar vor das jetzt deutlich erkennbare Tor, dann fuhr der Schein suchend die Umgebung ab.
Es war alles so, wie Gisa es ihm beschrieben hatte.
Er legte die Lampe auf den ebengehauenen Stein vor sich und schwang sich auf die Felsplatte.
In fiebernder Hast suchte er zunächst nach Drähten, Leitungen oder Kabeln, die nach oben führten. Sorgfältig, nun den schmalen Anlegesteg entlanggehend, prüfte er Felsritze um Felsritze. Er wollte sich restlose Gewißheit verschaffen. Die Sillschen Methoden kannte er bereits zu gut.
Nichts!
Das Motorboot war an ungefähr zwei Meter hochragenden blitzenden Rohren unter Zwischenlegen von Gleitrollen vertäut.
Er untersuchte die Rohre. Das war kein Aluminium, mußte Hydronalium oder eine ähnliche, seewasserfeste Legierung sein. Aber auch hier keine Spur einer Sicherungsvorrichtung.
Er schritt zu dem gewaltigen Metalltor. Die einfache Bedienung überschaute er mit einem Blick. Es galt, nur den ausladenden, nahe der Wand entlanglaufenden Hebel niederzuzerren.
Mit geschärftem Argwohn begann auch hier ein eifriges Prüfen.
Nichts, was auf eine Signalanlage deuten konnte.
Da betrat er vorsichtig das Motorboot, absichtlich auf dem Rand verharrend, um eine leise schaukelnde Bewegung zu verursachen.
Nichts rührte sich.
Er sprang auf die Bodenplanke.
In der Türe zum Maschinenraum steckte der Schlüssel.
Eine kurze Drehung, die Türe ließ sich leicht öffnen.
In dem Licht der Stablampe zeigte sich ein schwerer, sechszylindriger Dieselmotor.
Sehr geräumige Brennstoffbehälter befanden sich rechts und links an den Wänden.
Er klopfte dagegen.
Sie waren bis zum Rande gefüllt.
Eines war ihm klar, daß, wenn Sill das Boot zur Flucht nach der afrikanischen Küste benutzen wollte, er in seiner Vorsicht auch reichlich Rohöl getankt haben würde.
Hinter dem kleinen Maschinenraum ertastete der Lichtkegel eine sehr geräumige Kajüte.
Daß dort auch Proviant und Trinkwasser zu finden sei, stand außer Zweifel.
Sorge bereitete ihm einzig und allein die Anlaßvorrichtung des Motors.
Da entdeckten die suchenden Augen den Preßluftbehälter.
Gott sei Dank! Dieser unscheinbaren runden Stahlflasche hatten seine, Gisa verschwiegenen, größten Befürchtungen gegolten. Aber auch hier zeigte sich, daß Sill mit allem nur erdenklichen Vorbedacht gehandelt hatte, denn ein elektrischer Anlasser hätte durch Selbstentladung der Batterie eine böse Panne hervorrufen können.
Dem erfahrenen Flieger bereitete es keine Schwierigkeit, sich auf dem Armaturenbrett und den vielerlei Hebeln zurechtzufinden. Aus den Aufschriften erwies sich, daß zumindest der Diesel und die dazugehörige technische Anlage deutschen Ursprungs waren.
Eine gute Weile vertiefte er sich in die Betriebsvorschriften.
Dann stellte er Hähne, wendete einige Hebel.
Das Motorboot war startbereit, mußte nach seinen gesamten Erfahrungen sofort nach dem Anlassen des Diesels Fahrt aufnehmen.
Es galt, keine Zeit mehr zu verlieren.
Ihre Pläne lauteten, erst draußen den entscheidenden Versuch zu wagen. Mißlang er, so würde es nur geringe Mühe kosten, das Boot auf seinen Liegeplatz zurückzubugsieren.
Sill konnte nichts erfahren. Ein verzweifelter Rückzug bot auf alle Fälle den letzten Ausweg.
Die laute Brandung draußen aber mußte jedes Motorengeräusch verschlucken.
Martin Damm sprang zurück an Land.
Langsam drückte er den langen Hebel nieder.
Träge öffnete sich, dem Druck gehorchend, das zweiflügelige Tor.
Mit wenigen Bewegungen waren die Vertäuungen gelöst.
Mit einem Bootshaken schob Martin Damm das Boot hinaus.
Da blitzte vor ihm Giselas Lampe auf.
Einige wuchtige Stöße, die beiden Fahrzeuge lagen längsseits.
Gisela sprang über, nachdem sie die Peilsonde angereicht hatte.
Zu zweit wuchteten sie das leichte Paddelboot auf das Vorderdeck des weit größeren Bruders.
»Bleib hier, am Bug!——Beleuchte die Fahrrinne!«
Jetzt galt's.
Unter allen Umständen mußte das Motorboot so rasch wie möglich in Fahrt gebracht werden, sollte es nicht durch die heftige Strömung gegen die Felsen treiben.
Damm hastete in den Maschinenraum.
Den Anlaßhebel, der die Preßluft freigab!
Ein pfeifendes Zischen!
Wumm——wumm——wumm. Die Kolben begannen ihren pochenden, noch zaghaft unsicheren Takt.
Zurück zum Steuer, dort war der Brennstoffregler!
Aus dem langsamen Pochen wurde ein rasch zunehmendes helles Hämmern.
In dem kleinen Scheinwerferkegel der Stablampe Giselas zeichnete sich die Ausfahrt durch das Fehlen der Brandung ab.
Sie peitschte meterhohe Gischtflocken——röhrte, rechts und links.
Wenn eine Untiefe——?
Nicht daran denken!
Hinter sich vernahm Damm das Wühlen der Schraube.
Nur noch wenige Meter——
Noch ein paar Meter!
Das offene Meer war erreicht!
»Licht ausmachen!——Komm hierher!« schrie Damm laut. Er fühlte, wie kalte Perlen des Schweißes, von maßloser Erregung erzeugt, den nackten Körper herunterrannen.
Herrgott! Daß das so rasch geklappt hatte. Er konnte das Wunder kaum fassen.
»Halt das Steuer!——Ich muß mich anziehen. Der helle Körper könnte ein zu gutes Ziel abgeben.« Er streifte nur den Overall über.
Und nach wenigen Sekunden:
»Geh in die Kajüte!——Flach auf den Boden legen!«
herrschte er sie an.
Sie folgte ohne Widerspruch, turnte an dem Diesel vorbei.
Martin Damm legte den Hebel ganz herum.
Der Motor heulte auf vollen Touren.
Hoffentlich war die Maschine schon eingelaufen! Eine beängstigende Vorstellung.
Das Boot schoß mit einer Geschwindigkeit, die alle Erwartungen übertraf, dahin.
Wenn die Azteken in der Kuppel aufpaßten, mußte der Feuersegen bald beginnen.
Noch rührte sich nichts.
Da——!
Jetzt hämmerten hinter ihnen die Maschinenwaffen. Helles Singen zerschnitt die Luft.
Etwa fünfzig Meter zur Rechten stoben die Leuchtspurgeschosse in die Flut.
Serie folgte auf Serie in unheimlich rasch erfolgendem Nachschieben der Munitionsstreifen.
In fiebernder Hast suchte Damm den Motor auf noch höhere Touren zu bringen.
Umsonst!
Der Hebel ruhte schon im äußersten Anschlag.
Eine leuchtende Garbe flog über ihn hinweg.
Senkte sich!
Zwei, drei harte metallische Einschläge hackten ins Vorderschiff.
Ein leiser Wehschrei verschwamm in dem neu einsetzenden entnervenden Zirpen der Geschosse. Die Garben lagen rechts voraus.
»Gisa!« schrie Damm entsetzt. Wie oft hatte er das gleiche Spiel um Leben und Tod als Flieger an der Front erlebt, allein oder mit seiner Besatzung. Die Geliebte an Bord zu wissen, raubte ihm die sonst klare Besinnung des Kampfgeistes.
»Gisa!« Ein neuer Schrei verzweifelter Not.
Er wollte ihr zu Hilfe eilen, erfaßte sofort den Wahnsinn solcher Tat.
Durchhalten! — Durchhalten!
Doch ehe er sich über das Geschehene klar werden konnte, heulte plötzlich ein schweres Geschoß heran.
Aus! dachte Damm. Sill schießt mit dem Langrohrgeschütz.
Eine Wasserfontäne sprang hell im Mondschein glitzernd vor ihm aus dem Meer auf.
Ww — uih!
Das zweite Geschoß.
Es währte einige Sekunden, bis abermals der gleißende Springbrunnen emporschoß.
Ein dritter folgte in kurzem Abstand.
Nach wenigen Sekunden das gleiche Schauspiel.
Auf Verzögerungszünder eingestellte Munition verwendet der Narr, durchfuhr es Damm, der hinter dem Steuerrad geduckt hockte. Zum Teufel, wenn die Brocken mit Aufschlagzünder krepieren würden.
In der Mondnacht mußte die schäumende Bugwelle ein vorzügliches Ziel abgeben.
Wumm!
Hinter ihm platschte etwas.
Sie beherrschen auf diese Entfernung die Schießtechnik nicht!
Motor, Motor! ——— Halte mir nur noch auf kurze Zeit dieses rasende Tempo aus. Fünfzig Kilometer, sechzig Kilometer in der Stunde. Damm wußte es nicht.
War da eine Ladehemmung eingetreten? Jetzt erst bemerkte er, daß die feurigen Spuren der Maschinenkanonen aufgehört hatten.
Mein Gott, sollten wir schon dem Bereich auch des großen Geschützes entronnen sein?
Wuuh — wumm.
Unmittelbar rechts vom Boot lag der Einschlag.
Das Feuer verstummte.
Minuten fiebernden Bangens.
Kein Schuß mehr.
Der Motor hämmerte ruhig sein wohltuend gleichförmiges Lied.
Martin Damm wandte sich um.
Von der Daumeninsel erkannte er nur noch im Mondenschein die Kuppel.
Warum schoß Sill nicht?
Abermals eine Ladehemmung durch unsachgemäße Bedienung?
Die einzige Lösung des Rätsels.
Und wieder vertropften Minuten.
Sind wir wirklich entronnen?
Als er sich nach langem Zögern abermals umblickte, war von der Daumeninsel nichts mehr zu erblicken.
Ruhig und still gleißte das Meer im Licht des Mondes bis zum fernen Horizont.
Da befestigte der Einsame das Steuerrad mit einem Tauende und turnte an dem heißen Diesel vorbei in die Kajüte.
Im Dunkel suchte er den am Türrahmen angebrachten Lichtschalter, den er vorhin bei der Durchsuchung des Bootes wahrgenommen hatte.
Ein leichtes Knacken. Die Deckenbeleuchtung flammte auf.
»Gisa!——«
Auf dem Boden hingestreckt lag die Geliebte. Ein dünnes, rotes Rinnsal überquerte die blasse Stirn.
Er kniete neben ihr, richtete sie auf.
»Gisa!« Ein inbrünstiger Jubelschrei entrang sich seiner Brust. Er hielt den lebenswarmen Körper im Schoß gebettet.
Ein Stück zersplitterten Holzes entfiel den Haaren.
Er suchte vorsichtig nach der Wunde.
Ein kleiner Riß in der Kopfhaut.
Nur ein Schlag mußte sie betäubt haben.
Er hob die Bewußtlose auf eines der unteren Kojenbetten, eilte zurück, stellte den Motor auf halbe Kraft, tauchte sein Taschentuch in das Meerwasser und hastete zurück.
Martin Damm hatte nach sorgfältiger Prüfung der kleinen Kopfwunde nur einen kleinen Hautriß feststellen können, mehr eine Schürfung, die niemals der Anlaß zu solcher Betäubung sein konnte. Erst ein zufälliger Blick zum Kajütendach bot die Lösung. Dort war eine schmale Planke aus dem Verband gerissen worden und hing geknickt herab. Da kein Schußloch zu entdecken war, konnte es sich nur um die Wirkung eines Querschlägers der etwa zwei-cm-kalibrigen Maschinenwaffe handeln. Die wenigen Holzsplitter entstammten der herausgerissenen Nut und Feder der Holzplanke.
»Na warte, Freundchen!« knurrte er vor sich hin. »Unfolgsam gewesen! — Hättest du dich schön platt auf den Boden gelegt, wäre das Malheur nie passiert. — Du aber hast gestanden!«
Gisa in ihrer Betäubung zu helfen, war sinnlos. Es galt unter allen Umständen festzustellen, ob die Geschosse irgendwo den Bootskörper leck geschlagen hatten.
Im Lichte der suchenden Stablampe fand er drei weitere Durchschußlöcher am Rande des Kabinendaches und in der Holztäfelung.
Über der Wasserlinie im Vorschiff entdeckte er die Ausschußöffnungen. Durch die hohe Bugwelle quoll in dünnen Strahlen die Flut ein. Jetzt wurde ihm auch das ununterbrochene Speigeräusch der Bilgenpumpe klar. Er hatte es auf leichte Undichtigkeit des Bootskörpers während der langen Liegezeit zurückgeführt.
Etwas kürzer visiert und——der Motor wäre unrettbar verloren gewesen!
Mit einem Beil, das er dem Handwerkskasten entnahm, schlug er eine Sprosse der Rundbank los und sägte drei Enden zurecht. Das Taschenmesser schnitt sie zu. Dann trieb er die drei so gewonnenen Holzstopfen in die Schußlöcher. Dumpf hallten die Schläge in den Eisenplanken.
Das Boot war abgedichtet. Bei Tageslicht würde er es einer gründlicheren Überprüfung unterziehen. Das Paddelboot, das lang auf dem Vorschiff lagerte, schien seltsamerweise nichts abbekommen zu haben. Auf alle Fälle vertäute er es fest.
Als Martin Damm, das Beil in der Rechten, wieder die Kajüte betrat, schauten ihn die großen Augen Giselas an.
Vorsichtig legte er das Werkzeug nieder.
War sie wirklich schon aus ihrer Betäubung erwacht?
»Martin——Wasser——bitte!«
Ein unruhiges Herumwerfen des Körpers, als ob sie sich aufrichten wollte. »Wo——sind——wir, Martin?«
»Außer aller Gefahr!« Er kniete vor ihrer Lagerstatt nieder, streichelte und küßte die zu neuem Leben Erweckte.
Sie ließ sich matt mit geschlossenen Augen zurückfallen.
»Wasser——bitte!«
»Ja, Gisa! — — Einen Augenblick!« lautete die feste Zusage.
Er sprang auf.
Woher Trinkwasser nehmen?
Gewiß gab es solches an Bord!
Aber wo?
Tür auf Tür der eingebauten Kojenschränke rissen die suchenden Hände auf.
Büchsen, nur Büchsen entdeckten die tastenden Augen.
Was war das hier unten noch für ein Blechfach?
Die Hälse von Mineralwasserflaschen, grün mit dem goldschimmernden Kronenkorkenverschluß schwankten und hüpften sacht unter der Wirkung des vibrierenden Schiffskörpers in ihren quadratischen Holzgattern.
Er riß eine der Flaschen hervor.
›A. M. + A. C.‹, lautete die Aufschrift auf dem Papieretikett.
Damm kannte Sills Manie der Beschriftung in Buchstaben.
Aqua mineralis plus acidum citricium, dürfte das wohl heißen, also kohlensaurer Sprudel mit Zusatz von Zitronensäure. Gerade das Rechte zur Erfrischung! Die Flasche beschlug sogleich. Irgendwo mußte sich demnach eine noch nicht entdeckte elektrische Kühlanlage befinden, deren Kraftquelle die Lichtmaschine des Diesels hergab.
»Wasser———Martin!«
Kurzentschlossen preßte Damm den Rand des geriffelten Metallverschlusses gegen den winkligen Eisenrahmen eines Kojenbettes.
Ein Ruck.
Das emporquellende Naß überschäumte die Finger.
Gläser waren dort oben auf dicke Holzdorne gestülpt, wie es auf Schiffen üblich ist.
Das noch auf dem Tisch liegende, feuchte Taschentuch ersetzte ein Staubtuch.
Damm führte, behutsam mit der Rechten den Kopf Giselas anhebend, das halb gefüllte Glas an ihre Lippen.
»O———schön! — Mehr———bitte!«
Abermals goß er das Glas voll.
»Dank dir!« Sie sank auf das helle Kunststoffkissen zurück.
»Mehr?«
»Nein!——Martin!«
»Hast du Schmerzen?«
»Etwas——im Kopf——oben.———Wenig nur!«
Wie eine Entschuldigung klangen die abgerissenen, leisen Worte.
»Kannst du schlafen?«
»Ja!———Ich — bin — sehr — müde!«
»Schlaf, Liebes!——Morgen ist alles wieder gut!« Er berührte streichelnd ihre Wangen. Doch die Kranke schlief bereits. Tiefe, gleichmäßige Atemzüge bewiesen ihm, daß der leichten Gehirnerschütterung durch den Aufschlag der schmalen Deckenplanke keine ernste Bedeutung zuzumessen sei. Da hatte er im Laufe des Krieges schon andere, viel ernstere Fälle erlebt. Eine sehr natürliche Nervenreaktion, als Folge der alle Begriffe übersteigenden Anspannung, hatte durch den Schlag auf das Scheitelbein des Schädels ihre Auslösung gefunden. Bei Gisas verbissener Beherrschung konnte man den an sich unglücklichen Zufall nur begrüßen. Er verschaffte dem überanstrengten Organismus die Ruhe, die er sonst im Verlauf der noch manche Gefahren bergenden Fahrt niemals gefunden hätte.
Eine Nachtwache war hier nicht nötig, wenigstens nicht, solange das Meer ruhig bliebe.
Martin Damm kehrte nach einem kosenden Blick auf die geliebte Frau, deren Körper er mit einer leichten Decke eingehüllt hatte, zu seinem Platz am Steuerrad zurück.
Er suchte sich an den glitzernden Sternen des über ihm klar ausgespannten Himmelsgewölbes zu orientieren, dann machte er die vorhin angebrachte Vertäuung los und änderte den Kurs.
Was bedeutete der mit einer Segeltuchhaube verhüllte Kasten vor ihm?
Die Verschnürung war rasch gelöst.
Doch die Überraschung stieg, als er bei näherem Hinsehen erkannte, daß es sich nicht um eine einfache Magnetnadel handelte, sondern um einen, während der vielen Stunden der Fahrt bereits voll angelaufenen, elektrisch angetriebenen Kreiselkompaß.
Mattes, grüngelbes Licht beleuchtete die Windrose.
»Dieser durchtriebene Bursche hat selbst hier ganz sicher gehen wollen!« entfuhr es ihm.
Er brauchte den aus dem Sternenbild ermittelten Kurs nur geringfügig zu korrigieren. Fest stand für ihn, Kapstadt anzulaufen, und sein Gedächtnis kam ihm zu Hilfe, den Rückweg zu finden, den er bei dem Hinflug gewählt hatte.
Ein fahler Dämmerstreifen kündete am östlichen Horizont den nahenden Morgen. In diesen subtropischen Breiten konnte es nicht mehr lange währen, bis der heiße Sonnenball den Fluten entsteigen würde.
Damm saß zurückgelehnt achtern im Boot. Er hatte inzwischen herausgefunden, daß ein einfacher Mechanismus gestattete, eine Sperrklinke in den Antrieb des Steuerruders zu legen, derart, daß auch ohne Betätigung der Kurs nach einmaliger Einstellung recht gut gewahrt blieb, wenigstens solange der Motor die gleiche Tourenzahl einhielt.
War das eine Täuschung?
Er horchte angestrengt zur Kabine.
————
»Martin!« erklang der laute Ruf jetzt sehr deutlich, die Geräusche der Maschine übertönend.
Voller Sorge eilte er nach vorne.
Zu seiner Überraschung saß Gisa in einem Rohrsessel.
»Martin! — Hilf mir doch an dem scheußlichen Motor vorbei. — Ich hab' Angst vor ihm! — So recht wollen die Beine noch nicht!« Sie lächelte ihm verzagt zu.
»Kranke gehören ins Bett!« lachte er. Eine schluchzende, nicht zu bezähmende Freude und liebevolle Besorgnis sprühte aus den bisher von der langen Nachtwache übermüdeten Augen.
»Kranke gehören ins Bett!« wiederholte er noch einmal, den Arm um ihre Schultern schlingend, doch die Ermahnung verstummte in einem glücklichen Stammeln.
»Martin!« Sie machte sich sachte frei. »Ich will zu dir, auf die Holzbank, in die frische Luft!«
Frische Luft hörte er nur und begriff ihren Wunsch. Mit der Linken riß er rasch die Wolldecke von der Koje und klemmte sie unter die Achsel, mit der Rechten stützte er Gisa, die noch sehr unsicher auftrat. Behutsam geleitete er sie an dem stampfenden Motor vorbei, breitete die Decke über den taufeuchten Sitz aus und bemerkte jetzt erst, daß auch sein Overall an einigen Stellen von kleinen Perlen blinkte, an anderen verwischte dunkle Streifen der Nässe aufwies. Ihn fröstelte.
Sie schmiegte sich an ihn.
»Martin!——Ich wollte——die Sonne sehen!——Die richtige Sonne sehen!——Wie sie aufgeht!«
Ergriffen schwieg er. Was mußte es für sie bedeuten, nach vielen Jahren künstlich erhellter Kerkerhaft die wahre Sonne wieder erblicken zu können.
Da schob sich ein gelbrot blendender Streifen strömenden Lichts aus dem Meer, wuchs, wuchs zur feurigen Halbkugel, entstieg vollends den glitzernden Fluten als Sonnenball und begann seine sonst so alltägliche Bahn zu ziehen.
Gisela Verweer weinte, weinte still vor sich hin, von des Geliebten Arm umschlungen, das Haupt an seine Schulter geschmiegt.
»Die Sonne!« schluchzte sie. »Wie sie wärmt!——«
Es erwies sich, daß die angenommene Gehirnerschütterung weit geringere Folgen nach sich zog, als er befürchtet hatte.
Gisa gestand etwas bedrückt ein, daß sie der Weisung, sich auf den Boden zu legen, nicht nachgekommen sei. Alles in ihr habe gegen solche Feigheit aufbegehrt. Und plötzlich habe sie ein Schlag am Kopf getroffen, etwa so, wie wenn man sich unachtsam den Schädel an dem Rande einer Kellerluke beim Hinaufsteigen stoße. Dann aber sei sie zusammengeklappt. Sie wisse noch, daß sie gerufen habe.
Martin Damm lachte nur tief beglückt zu diesem Geständnis. Er untersuchte vorsichtig, die Haare zur Seite schiebend, die schmale Wunde. Sie verharschte bereits.
»Kleiner Nervenkollaps, sonst nichts!« meinte er zuversichtlich. »Auf alle Fälle hast du den groben Beschuß nicht miterlebt! — Und das war gut so!«
Auf ihr dringliches Bitten erzählte er alles, was er erlebt hatte, und verschwieg nicht, daß nur die verkehrte Zündereinstellung die Flucht hatte gelingen lassen.
»Wie fühlst du dich jetzt?« schloß er seinen Bericht.
»Hunger hab' ich, entsetzlichen Hunger! — Keine Schmerzen mehr. Lediglich die Kopfhaut brennt etwas! Die Schwäche ist völlig geschwunden!« Sie stand auf und bestätigte ihre Behauptung. Mühelos glich der Oberkörper die durch die Dünung des Meeres hervorgerufenen Schwankungen aus.
»Traust du dich ohne meine Hilfe an dem Motor vorbei?«
»Ganz gewiß!« lautete ihre Versicherung.
»Dann geh bitte in die Kajüte. Der Elektroherd ist neben der Koje, auf der du schliefst. In den Schränken befinden sich so viel Lebensmittel, daß wir zwei sie in Wochen nicht vertilgen können. — Kennst du dich auch in der Sillschen Buchstabenbezeichnung aus?« Eine letzte besorgte Frage.
»Ich kenne alle seine Präparate!«
»Sei so lieb und sorg' für ein anständiges Frühstück! — Ich hab's wahrhaftig nötig!«
»Wird gemacht, du armer Nachtwächter!«
Sie beugte sich nieder, drückte einen Kuß auf seine Stirn und wandte sich der Kajüte zu.
Die gründliche Durchforschung des mit gleichbleibender Geschwindigkeit dahinjagenden Motorbootes hatte nach dem Frühstück viele Annahmen Damms bestätigt und zwei Überraschungen gebracht. Weitere Einschußspuren konnten nicht entdeckt werden. Außerdem war die sich automatisch einschaltende Bilgenpumpe verstummt. Unter den Kojen und im Kielraum befanden sich Brennstoffbehälter in solcher Zahl, daß Damms letzte Befürchtungen, selbst bei widrigem Wetter die afrikanische Küste nicht zu erreichen, schwanden. Es kostete allerdings einige Zeit, bis ihm die Technik der Anlage restlos klar wurde, galt es doch, die Tanks nach dem Verbrauch des Rohöls mit Seewasser zu füllen, um dem Boot die erforderliche Zulast zu verschaffen.
Süßwasser zu Kochzwecken fand sich ebenfalls. Die peinlich sorgfältige Überprüfung der Zylinder des Motors mit dem aufgefundenen Horch- und Kompressionsmeßgerät verlief zur vollen Zufriedenheit. Wenn nicht geradezu ein Orkan eintrat, mußte die Fahrt nach Kapstadt gelingen.
Gisela blieb es vorbehalten, zwei Überraschungen zutage zu fördern. Die außergewöhnliche Breite des Tischrahmens hatte ihre Entdeckerlust wachgerufen. Damm erbrach mit einem Stemmeisen die geschickt verborgenen Schubladen.
In der ersten befand sich sehr aufschlußreiches Kartenmaterial, in der zweiten eine große Stahlkassette, deren Deckel Hammer und Meißel nicht lange standhielt. Sie war bis zum Rande vollgepfropft mit Bündeln von Dollarnoten.
Während Martin Damm sich sofort dem Studium der Seekarten hingab, zählte Gisela Verweer unbekümmert die Geldscheine.
Nach geraumer Weile nannte sie eine Summe, die alle Erwartungen übertraf.
»Wirf den Dreck ins Meer! — Ich will den Blutsold nicht haben!« begehrte Damm auf.
»So! — Und an unsere Zukunft denkst du nicht? — Hast du nicht Anrecht auf Schadenersatz für dein in Brand geschossenes Flugzeug, auf dein Gehalt und ich auf das meine, welches mir laut Vertrag bei meiner Entlassung zusteht?«
»Ich benötige kein fremdes Geld, um unsere Existenz neu aufzubauen!« brauste Damm auf. »Ich will das Zeugs nicht mehr sehen!«
Nach erbittertem Diskutieren gab sich der Mann geschlagen. Gisela rechnete auf Heller und Pfennig aus, was ihr zustand und was er nach ihrer Meinung zu beanspruchen habe. Sie nahm die Kassette an sich und verschloß sie in einem geschwinde ausgeräumten Fach.
Als sie sich umwandte, zeichnete der zukünftige Eheherr, wie es schien, eifrig einen neuen Kurs in die Seekarte ein.
»Martin!« Sie beugte sich über ihn und zauste in seinen Haaren.
»Hm?«
»Sei wieder lieb!« Sie schob sich auf seinen Schoß. So konnte er nicht weiterarbeiten.
»Martin——?«
»Ja?«
»Weißt du was? — Wir übergeben in Kapstadt diese eklige Kassette einem Richter! — Er soll entscheiden! — Nicht du -nicht ich! — Aber ich sag' ihm alles!«
Da lachte der Bezwungene so herzlich auf, wie Gisela ihn noch nie hatte lachen hören.
»Du scheinst ja deines Erfolges im voraus sehr sicher zu sein!«
»Bin ich auch!« Ihre Wange streifte unentwegt die seine.
»Dann soll er meinetwegen die Mohrenkinder mit dem Geld beschenken. Auf alle Fälle gehörst du dann wieder ganz mir!« flüsterte sie.
Aus dem Mittagessen war nach bekanntem Vorbild ein wahrhaftes Galadiner geworden, welches Giselas Kochkünsten nicht nur Ehre, sondern auch begeistertes Lob des übermütig zulangenden »Kapitäns« eintrug.
Als sie von den reichlichen Speisen, in ihren Korbsesseln zurückgelehnt, ausruhten, meinte Damm:
»So! Das war das letzte Mal, daß wir die gesamte Tischplatte nur lukullischen Genüssen dienstbar machten. — In Zukunft benötige ich mindestens die eine Hälfte für andere, nicht weniger wichtige Zwecke!«
»Nanu?« fragte Gisa erstaunt.
»Ich hab' mir vorhin«, fuhr Martin Damm fort, »die Seekarten nur flüchtig angesehen. Die größte von allen muß ich fest aufspannen, um ständig unseren Kurs unter Kontrolle zu halten. — Komm, wir wollen erst einmal das Geschirr forträumen, dann erkläre ich dir alles.«
Heißes Wasser lieferte ein Elektroboiler. So war die Arbeit bald getan.
Dann spannte Damm die Karte auf der Tischplatte auf. Kleine Blauköpfe befanden sich im Werkzeugkasten.
»Schau her!« hub er an. »Diese gerade Linie hatte Sill als Fluchtroute vorgesehen. Sie führt von der Daumeninsel, deren Lage, wie du siehst, ziemlich genau achtzig Grad östlicher Länge und fünfundzwanzig Grad südlicher Breite ist, auf das afrikanische Festland zu. Die Mündung des Limpopo in Portugiesisch-Ostafrika war das Ziel. Irgendwo in dieser Gegend muß der hohe Herr Helfershelfer stecken haben. Sehr bezeichnend bleibt, daß er nicht das viel näher gelegene Madagaskar oder eine der noch leichter erreichbaren Inseln der Maskarenen ansteuern wollte. Der Grund dürfte hinreichend klar sein. Auf Inseln, selbst in der Größe Madagaskars, ist man ein seltener Gast, zumal wenn man mit einem Motorboot dort landet. Das weite Festland verschluckt sozusagen jeden Fremdling, und die Spur ist leicht zu verwischen. Unter solchen Voraussetzungen erklärt sich auch der überaus große Brennstoffvorrat, denn ich habe inzwischen noch weitere Tanks entdeckt. Seine angeborene Vorsicht mahnte ihn auch hier zu größter Sicherheit.
Der angesetzte Kurs muß von einem erfahrenen Fachmann ausgearbeitet sein. Du siehst hier«, er wies mit dem kleinen Finger auf Zahlen, »daß sogar die jahreszeitbedingten, unterschiedlichen Versetzungen des Südäquatorialstromes, wie des Kapstromes berücksichtigt sind.
Unter solchen Voraussetzungen kann man es tatsächlich unternehmen, ohne Sextanten und Chronometer zu navigieren.
Beide Instrumente befinden sich, obwohl ich jedes Fach durchgestöbert habe, nicht an Bord.
Doch auch für diese an sich befremdlich wirkende Tatsache gibt es eine einfache Erklärung. In gewissen Jahreszeiten müssen hier ausgedehnte Nebelbänke jede Sonnen- und Sternenbeobachtung tagelang unmöglich machen. Ein von allen magnetischen Störungen unabhängiger Kreiselkompaß ist unbedingt zuverlässig.
Wie du hier aus dem am Rande der Karte angebrachten Vermerk ersiehst, zeigt die im Armaturenbrett angebrachte Loguhr den zurückgelegten Weg an. Die gesamte Errechnung des Zieles beruht in Einbeziehung der Versetzung durch die Meeresströmung und den Wind auf einer gewissen Tourenzahl des Diesels, die etwa fünfzig Kilometer pro Stunde ausmachen soll. Leider ist ein Apparat durch den Beschuß zum Teufel gegangen, der Winddruck- und Richtungsmesser. Ein Geschoß hat eine der Schalen des Winddruckmessers gestreift, wurde dadurch zum Querschläger, und die Folgen davon hat dein armer Kopf zu spüren bekommen!« Sie lächelte und legte die Hand auf seine Schulter. Die Aufmerksamkeit der Physikerin galt ausschließlich seiner Erläuterung, war es doch äußerst interessant, zu erfahren, wie man ein Boot ohne tägliche Positionsbestimmung auf tausende von Kilometern einem im voraus bestimmten Ziel sicher zulenken konnte.
»Auf die Messung der Windversetzung, deren Berechnung diese Tabelle angibt«, Damm zog ein Blatt hervor, »müssen wir verzichten. Aber auch ohne diese glaube ich Kapstadt zu erreichen. Die Hauptsache ist, ich kann die Stromversetzungen aus der Seekarte entnehmen!«
»Warum willst du gerade nach Kapstadt?« unterbrach Gisa impulsiv seine Darlegungen.
»Sills Kurs zu verfolgen, halte ich für bare Torheit. Er hat todsicher längst an seinen werten Bruder Don Antonio auf dem Zubringerdampfer gefunkt, uns zu kapern. Nähergelegene Häfen wären Lourenco-Marques, Durban, East London und Port Elisabeth, alle in Südafrika. Hier.« Er deutete auf die genannten Plätze. »Sie behagen mir alle nicht! Vermittels eines Flugzeugs — und auch über ein solches könnte der gute Don Antonio verfügen — wäre unser Kurs leicht auszumachen. Von einem solchen droht uns übrigens die einzige noch mögliche Gefahr, nämlich durch Beschuß aus der Luft. Unser Motorboot ist dank der Vorsorge unseres ehemaligen Kerkermeisters so seetüchtig, daß wir bei geschlossenen Stahlblenden vor den Bullaugen schon allerhand Seegang vertragen. Rohöl reicht nach meiner sorgfältigen Prüfung der Behälter für fast achttausend Kilometer bei fünfzig Durchschnittstempo.
Aus diesen Gründen habe ich mich vor dem Essen bereits entschlossen, hart südlich der Antarktis zuzuwenden. Dann, nach etwa vierundzwanzig Stunden, Kurs West anzulegen und auf der errechneten Höhe von Kapstadt dieses mit Nordkurs anzusteuern.
Der Umweg bedeutet allerdings eine Verlängerung unserer Fahrt auf etwa sechstausendfünfhundert Kilometer. Wenn wir infolge diesigen Wetters den weit sichtbaren Tafelberg bei Kapstadt nicht ausmachen können, so müssen wir trotzdem irgendwo auf das Festland stoßen. Navigationstechnisch bedeutet dieses Unterfangen gewiß ein größeres Risiko. Sill wird todsicher annehmen, daß wir den in der Karte eingezeichneten Kurs verfolgen. Findet uns ein dort suchendes Flugzeug nicht, so hält er uns für abgesoffen, durch die Einwirkung seines Beschusses. So weit südlich nach den Ausreißern zu fahnden, dürfte dem Seeangsthasen schwerlich in den Sinn kommen. Auf solche Voraussetzung baute ich den dir eben entwickelten Plan auf!«
»Einverstanden, Herr Kapitän!« lachte Gisa. »Du wirst es schon schaffen!«
»Und du mit!« In verstellter Kommandostimme herrschte Martin Gisela an. »Denn von jetzt an werden die Wachen eingeteilt!«
»Jawohl, Herr Kapitän!« bellte in strammer Haltung die Schicksalsgenossin zurück.
Martin Damm wühlte mit der Rechten in seinem dichten Haarschopf.
»Übrigens eines ist mir noch völlig unklar!« brach er sein nachdenkliches Schweigen. »Es gibt hier an Bord so gut wie keinen Komfort, der nicht vorhanden wäre. Darum verstehe ich einfach nicht, warum das große Motorboot keine Funkanlage besitzt! — Kannst du das erklären?«
»O ja!« entgegnete Gisela ohne längeres Besinnen. »Sill kann nicht morsen. Er hat diese Kunst, wie er es nannte, in den Abendstunden der ersten Zeit meines Aufenthaltes mit geradezu erstaunlicher Zähigkeit so oft geübt, daß ich vom Zuhören allein das Morsealphabet erlernte. Ihm fehlte aber jeglicher Sinn dafür. Am nächsten Tage hatte er das mühselig Eingeprägte bereits vergessen!«
»Und die Azteken?«
»Mir ist nicht bekannt, daß je einer von ihnen sich an dem Radio und den Funkgeräten zu schaffen gemacht hätte. Die gesamte Wartung und Bedienung unterstand Heinrich Peters, übrigens der einzige Weiße, wenn ich so sagen darf, der dort oben noch hauste, aber nie mit den Siedlern in Berührung kam. Ein ausgefuchster Nachrichtenmann und ein Stück Journalist, wohl der größte Vertraute Sills. Ich sah ihn nur, wenn technische Mängel in den Apparaten auftraten, die ich beheben sollte, ein unausstehlicher Zyniker, dem es ein geradezu teuflisches Vergnügen bereitete, neben Sill den allmächtigen Herrgott zu spielen!«
»Dann wäre ja auch das Rätsel gelöst. Die dreizehn Kojenbetten beweisen, daß wenigstens pro forma nur für Sill und seine fünfundzwanzig Azteken, macht sechsundzwanzig, vorgesorgt war, Schlaf in zwei Schichten!«
»Dürfte wohl so sein!« sagte sie.
Im weiteren Verlauf der Unterhaltung teilte das Paar die Wachen ein, nachdem Damm den Kurs in die Seekarte eingezeichnet und Gisela mit der Bedienung des Diesels, wie der Ablesung der Instrumente vertraut gemacht hatte. Sie drang darauf, daß er zunächst einmal gründlich der Ruhe pflegen sollte.
»In dem Schrank dort hängen übrigens zwei vorzügliche Ölmäntel!« rief er ihr noch zu, es sich schon in der Koje bequem machend. »Zieh bitte einen davon bei Einbruch der Nacht des Taues wegen an. — Und dann — um zwei Uhr früh wecken!«
Sie weckte ihn nicht, denn er war ihrer Meinung nach viel zu überanstrengt.
Es war bereits heller Tag, als Damm nach tiefem, kräftigendem Schlaf endlich erwachte.
In der Mittagsstunde des sechsten Tages saß Gisela Verweer oben auf dem Dach der Kajüte, das große Marineglas vor den Augen.
Das Meer war zum ersten Male recht unruhig. Brander auf Brander überspülten das Vorschiff. Die Stahlklappen verschlossen wasserdicht die Bullaugen. Mit dem linken Oberarm preßte sie die niedrige Maststange an den Körper, um sich so den erforderlichen Halt zu verschaffen. Die freie Hand hielt gemeinsam mit der Rechten das Fernglas.
Den emsig abgesuchten Horizont im Blickfeld zu behalten, bereitete nicht geringe Schwierigkeiten.
Doch Martin, das wußte sie, war bei solchem Wetter als der Erfahrenere zur Bedienung des Diesels und Einhaltung des Kurses geeigneter als sie.
Schon zweimal glaubte sie, in dem kaum ausgleichbaren Pendeln die Umrisse eines fernen Berges erspäht zu haben. Die Luft war klar.
Da! Jetzt zum dritten Male der Berg, oben flach wie ein Tisch mit steilen Flanken.
»Martin!« schrie sie in das Tosen des Meeres. »Der Tafelberg voraus!——Das muß er nach deiner Beschreibung sein!«
»Bist du dessen sicher?« rief er zurück.
»Ja! Dreh ein wenig mehr nach steuerbord über! Ja! Gut so, jetzt!——Halt den Kurs!«
Das Boot stampfte und schlingerte heftig. Wie eine Erlösung überfielen Martin Damm ihre zuversichtlichen Worte. Sie ahnte nicht, daß die Lage recht kritisch war und noch böser werden konnte, wenn der Sturm an Stärke zunahm. Schon seit geraumer Weile hatte er den Motor gedrosselt, um die Wucht der schräg von Backbord anlaufenden Wogen zu mindern. Längst war das auf dem Vorderdeck vertäute Paddelboot zerschlagen und die Trümmer über Bord gespült.
An die tausend Meter ragte der Tafelberg auf, dessen erinnerte sich Damm. Gisa sah schon die Flanken.
Bei der verringerten Geschwindigkeit mußte er noch mindestens eine starke Stunde ansetzen, bis der schützende Hafen erreicht sein würde.
Er stand auf, fest das Steuerrad umklammernd, und konnte mit bloßem Auge den Rettung verheißenden Berg erkennen.
»Komm herunter!« rief er. »Ich sehe das Ziel!« Keinen Augenblick länger sollte sie sich dort oben der Gefahr aussetzen.
Im geheimen bewunderte er die Unerschrockenheit und Geschicklichkeit, mit welcher sie sich in dem recht durchnäßten Overall von dem Mast loslöste, die Beine über den Rand des Kajütendaches schob und im rechten Augenblick mit einem Schwung vor ihm auf dem Rost stand.
Sie saß, glitt neben ihn und wickelte sich rasch in den unter der Bank hervorgezogenen Ölmantel.
Ihre Augen strahlten in begeisterter Entdeckerfreude.
Es währte mehr als eine Stunde, bis sie die False Bay erreichten.
Im Schutze der Landzunge wurde die See ruhiger.
Ohne Bedenken konnte Damm den Hebel auf Vollgas niederdrücken.
Das Boot schoß in rascher Fahrt dahin.
Das Häusermeer Kapstadts, in wenigen Kilometern Abstand, lag vor ihren Augen.
Ein hellgrau gestrichenes Fahrzeug mit niederen, weißen Aufbauten und einem hohen Kreuzmast, den sonst nur Kriegsfahrzeuge führen, schob sich ihnen entgegen.
Am Heck flatterte im seitlichen Winde deutlich erkennbar die Dienstflagge der Südafrikanischen Union.
Zwei quadratische Wimpel gingen an der Signalleine hoch.
»Gilt das uns?« fragte erregt Gisela.
»Stoppen Sie, heißt das, soviel ich weiß!« entgegnete der Gefragte, riß sofort den Hebel herum und löste die Kupplung aus dem Wendegetriebe.
Nach wenigen Minuten lag der Zollkreuzer längsseits.
»Ihre Papiere, bitte!« ertönte die Stimme eines Uniformierten in englischer Sprache.
»Bitte!« sagte Damm, holte seine Brieftasche hervor und reichte den Paß hinüber.
Nach kurzem Blättern, währenddessen das Gesicht des vermutlichenKommandanten. dem der Paß übergeben wurde, sichtlich zufrieden ein Grinsen überflog, kam die Frage:
»Verstehen Sie englisch?«
»Ja!« antwortete Damm zuversichtlich.
»Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, daß Sie sich als verhaftet zu betrachten haben.——Die Dame ist wohl Miss Förwir?«
»Ja!«
»Allright! — Folgen Sie uns. — Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß ein Fluchtversuch Ihrerseits sofortige Anwendung unserer Waffengewalt nach sich ziehen würde. — Haben Sie verstanden, was ich sagte?«
»Ja!« entgegnete verbissen Martin Damm.
Der Zollkreuzer legte ab, umfuhr das Motorboot und nahm Fahrt in Richtung des Hafens auf.
»Was soll das?« fragte bestürzt Gisela.
»Weiß ich's?« sagte Damm und hielt sein Boot im Kielwasser des Zollkreuzers.
»Wir haben doch nichts verbrochen?« begehrte sie auf.
Martin Damm verließ seine Beherrschung. Zu sehr hatten besonders die letzten Stunden seine Nervenkraft verbraucht. Er brüllte plötzlich:
»Verdammt!——Den Empfang habe ich mir anders gedacht!——Das ist ja vollendeter Wahnsinn!«
Eine Stunde später saßen Gisela Verweer — Miss Förwir, wie sie bezeichnet wurde — und der angebliche Doktor Martin Damm, der seit vielen Wochen spurlos verschwundene Geologe, in zwei getrennten Zellen des Gefängnisses von Kapstadt. Das Motorboot lag unter ausdrücklich angeordneter Bewachung im Zollhafen.
Doktor Martin Damm lief ruhelos in seiner Zelle auf und ab. Ein zebrastreifiger Sträflingsanzug schlotterte um seinen Körper. Das Zeug hielt wenigstens warm, das heiße Bad, das darauffolgende Abrasieren seines Sechstagebartes hatten seine Laune ein wenig gebessert. Sogar den Haarschopf hatte der eifrige Barbier auf seinen Wunsch nachgeschnitten. Insofern war er der Anstalt dankbar, daß sie ihn laut Vorschrift seiner Privatsachen, darunter des reichlich durchnäßten Overalls und der Unterwäsche, beraubt hatte.
Wie mochte Gisela ihr Schicksal hinnehmen?
Von einem Gefängnis nach knapp sechs Tagen Freiheit in ein neues!——Welchem unglaublichen Mißgriff der Behörde waren sie nur zum Opfer gefallen?
Seine unentwegten Proteste hatten die Beamten mit stummem Achselzucken hingenommen, höflich korrekt, aber unbeteiligt.
Als die Dämmerung nahte, vernahm er Schritte und das Knirschen des Schlosses. Zusammen mit einem Topf Essen übergab ihm der Aufseher ein Schreiben.
Damm erbrach den Umschlag sofort.
Das Blatt enthielt in dürren Worten die Hauptpunkte der Anklageschrift und die Aufforderung, sich binnen vierundzwanzig Stunden dazu zu äußern. In deutscher Sprache folgte ein Nachsatz: ›Falls Sie des Englischen nicht genügend mächtig sind, steht Ihnen morgen früh ein Dolmetscher zur Verfügung!‹
Was war das?
Damm glaubte seinen Sprachkenntnissen nicht mehr zu trauen:
Diebstahl eines Motorbootes?
Benutzung fremder Papiere?
Mord an zwei Eingeborenen?
Ermordung des Doktor Damm und Versenkung der Leiche im Meer?
Er las drei-, vier-, fünfmal den unfaßlichen Text, auf dem Hocker niedergesunken, wie einen irrsinnigen Spuk.
Wo sollte das geschehen sein?
Der Name der Polizeistation an der Küste von Portugiesisch-Ostafrika war nicht gut zu entziffern.
Dieser unerwartete Schlag traf zu niederschmetternd. Die Überanstrengung der letzten Tage machte sich geltend.
Wie kann man einen Gegenbeweis antreten.——Wie kann man einen Gegenbeweis antreten.——Einen Gegenbeweis, mahlten wie schwere Kollergänge die Sinne. Wie soll er Zeugen, ein Alibi erbringen, wo er und Gisa sich in den letzten Tagen aufgehalten hatten?
Das war Tells Geschoß——Sills Geschoß——Tells Geschoß——Nein Sills Geschoß, die Gedanken quirlten wirr durcheinander.
Er schob das Schreiben auf den Tisch.
Und in einem plötzlichen Entschluß erwachte die alte Tatkraft. Er schnellte zur Tür und drückte den Klingelknopf nieder.
Es währte eine Weile, bis abermals der Schlüssel im Schloß knarrte und die vergitterte Eisentür sich auftat.
»Sie wünschen?«
»Ich bitte, wenn irgend möglich, sofort den Direktor des Untersuchungsgefängnisses oder dessen Stellvertreter zu sprechen!«
»Das können Sie morgen auch noch!« tönte es unwirsch zurück.
»Mein Anliegen ist äußerst dringend!«
»Sagen sie alle!« war die brummelnde Antwort.
»Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß das Leben von eintausend Menschen auf dem Spiel steht. Die Anklageschrift beweist es!«
»Bluffen Sie doch nicht!«
»Ich weise mit größter Dringlichkeit darauf hin, daß ich die Regierung der Südafrikanischen Union für alle Folgen haftbar machen werde!« In den letzten Sätzen schwang bei aller Beherrschung eine so lodernde Empörung, daß der Beamte stutzig wurde.
»Ich will sehen, was ich für Sie tun kann!« Damit schob er die Tür mit dem Fuß zu und verschloß sie sorgfältig.
Etwa zehn Minuten später erschien mit dem Schließer ein Herr in Zivil, der, wie der Mantel bewies, bereits zum Ausgehen entschlossen schien.
»Sie wünschen mich zu sprechen?« Ein geringschätziges Abwägen glomm hinter den halbgeschlossenen Augenlidern.
»Wie lange darf ich Ihre Zeit in Anspruch nehmen?« fragte Damm höflich.
»Fünf Minuten!« lautete die kalte Antwort.
»Dann bitte ich um Tinte und Papier, damit morgen Ihre vorgesetzte Dienststelle über Ihren Mißgriff im Bilde ist!«
»Unmöglich!« Der Herr im Mantel zog eine Zigarette hervor und zündete sie an, während aller Bewegungen den Inhaftierten beobachtend.
»Warum, wenn ich um Auskunft bitten darf?«
»Sie wissen doch wohl selbst am besten, daß man sich mit einer Stahlfeder und Tinte die schönste Blutvergiftung beibringen kann!« Die spöttisch vorgebrachten Worte glitten mit dem Zigarettenrauch von den Lippen.
»Dann wäre wohl gegen einen Bleistift nichts einzuwenden?«
»Ich verstehe nicht, was Ihr Begehren mit einer schweren Verantwortung meiner Regierung zu tun haben soll!« kam es zurück.
»Das werden Sie morgen früh aus dem Schriftstück ersehen, welches ich heute nacht noch anfertigen muß!« erwiderte Damm. »Ihre Zeit ist ja, wie Sie sagten, sehr bemessen!«
»Allright!« sagte der Herr im Mantel, sich mit flüchtigem Gruß abwendend.
Damm hörte noch, wie jener sagte:
»Bringen Sie ihm einen Schreibblock und einen Bleistift. Das Licht bleibt brennen! — Beordern Sie einen der Wachhabenden in diese Zelle, bis die Arbeit beendet ist! - Morgen früh sofort die Akte dem Chef zuleiten!«
Doktor Martin Damm schrieb bis kurz nach Mitternacht.
Oliver Aston, der Chef der Kriminaldirektion, war als Frühaufsteher bekannt, eine Eigenschaft, die ihm nur das geteilte Wohlwollen seiner Untergebenen eintrug.
Seinen Schreibtisch pflegte er des Abends vor Verlassen seines Zimmers stets säuberlich zu ordnen und von allen Akten freizumachen.
Nichts haßte er mehr, als morgens unerledigte Arbeit vom Vortage auf der Tischplatte vorzufinden. — Zu sehr mahnte ihn ein solches Bild an die Unzulänglichkeit menschlicher Tätigkeit.
Er pflegte sich zunächst einmal geruhsam niederzulassen und die Zigarre in Brand zu stecken. Das geschah stets umständlich und mit sorgsamem Bedacht, nicht mit einem gewöhnlichen Sreichholz, sondern vermittels eigens zu diesem Zwecke zugerichteter Zedernholzspäne, davon er jeweils einen aus einer festschließenden Büchse entnahm. Wer ihn bei dieser, einem Kult gleichkommenden Handlung beobachtet hätte, wäre der Vorstellung erlegen, ein freudenseliger Bacchant opfere dem jungen Eros, damit er das Tagewerk segnen möge.
Sein im Nebenraum hausender Sekretär wußte, daß Hyppo so lange nicht mit der Außenwelt Verkehr aufzunehmen wünschte, bis das Aufflammen einer gelben Glühbirne dieses Begehren kundtat.
Doch diesen Morgen ereignete sich etwas Außergewöhnliches.
Der Chef steckte plötzlich, was nie vorkam, höchstselbst den mächtigen Kopf durch die halbgeöffnete Tür, die Klinke in der Linken, die gerade in Brand gesetzte Zigarre zwischen den Lippen.
»Morgen, Hardfield!——Was Neues im Falle Damm?«
Der verstört Aufspringende griff hastig zu einigen schon bereitgelegten Akten und überreichte sie seinem Chef.
»Was Neues?« bestand dieser eindringlich auf die Beantwortung seiner Frage.
»Ja, Mister Aston! — Der Inhaftierte fertigte heute nacht ein sechzehn Seiten langes Schriftstück an. — Der Gauner verfügt über eine geradezu sensationelle Phantasie!«
Der Sekretär lachte ergeben, rieb sich vergnügt die Hände und freute sich auf die Wirkung seines wohlüberlegten witzigen Hinweises.
»So, so!« grunzte Aston hinter seiner Zigarre und zog vor dem verdutzt Nachschauenden die Tür ins Schloß.
Hardfield begab sich verdrossen auf seinen Platz.
Im Nebenraum ließ sich Oliver Aston schwer in den Armsessel fallen, daß das Holz in den Fugen ächzte.
Seite auf Seite blätterten die fleischigen Finger um, jedesmal den Daumen schon bei den letzten Zeilen anfeuchtend. Die Zigarre begann im Aschenbecher zu erlöschen.
»Damned!« fluchte er kurz, als er die Tätigkeit beendet hatte.
Mit einer seinem sonstigen Wesen widersprechenden Hast schnappte er nach der Zigarre. Leichtes saugendes Schmatzen erscholl. Gottlob, sie brannte noch! Seine Stirnfalten glätteten sich wieder.
Er riß einen dicken Umschlag auf. Er enthielt die Brieftasche und, gesondert in einem Bogen Papier, den Paß. Letzteren legte er beiseite und widmete sich dem Studium des amtlichen Untersuchungsergebnisses über die Echtheit der Ausweispapiere.
›——X-Strahlen-Durchleuchtung: negativ. Keinerlei Radierungen oder Falsifikate——Paß ohne jeden Zweifel echt!‹ lautete der Schluß des Befundes des kriminaltechnischen Institutes.
»Dachte ich mir!« brummte Hyppo nachdenklich.
Dieser angebliche oder echte Doktor Damm hatte da eine Menge Namen bekannter Persönlichkeiten angegeben, die ihn identifizieren sollten, darunter auch Captain Cross vom Flughafen.
Hum! — Wenn die Gegenüberstellung so verlief, wie Damm in seinem Schriftsatz sehr siegesgewiß voraussagte, dann wäre der Fall Damm in wenigen Stunden erledigt, aber für Oliver Astons kriminaltechnisches Gewissen noch höchst unvollständig.
Der viel gewichtigere Fall »Daumeninsel« verblieb.
Von wo war denn eigentlich der Fahndungsbefehl ausgegangen?
Für Hyppo gab es jetzt nur ein Ziel, die gesamte Bande, die hinter dem von Damm geschilderten Herrn der Insel stand, auszuheben.
Halt! Ich will doch erst einmal die Unterschrift unter dem Schriftsatz Damms und der im Paß vergleichen.
Er blätterte in dem Ausweis.
Und hier das letzte Blatt der Aussage.
Oliver Aston griff zu einer Lupe.
Sorgfältig verfolgte er jeden Strich, jede Schleife der beiden Unterschriften.
»Hö, hö!« knurrte er nach einer Weile zufrieden. »Jede Täuschung ausgeschlossen! ———Beides schrieb derselbe!«
Er rieb sich vergnügt die Hände. Der seit Wochen spurlos verschwundene, von aller Welt gesuchte Geologe Doktor Damm saß in seinem Untersuchungsgefängnis, und dort saß er zunächst einmal sicherer, als irgendwo in Freiheit. Wenigstens stand diese Tatsache für ihn fest.
Von wo stammte der drahtlose Fahndungsbefehl?
Wie hieß die Polizeistation? Die Portugiesen könnten sich auch vernünftigere Namen ausdenken.
Oliver Aston hielt das Original der englischen Übersetzung des Funktelegramms mit beiden Händen.
Merkwürdige Geschichte, sann er, auf den Text abgleitend:
›Peter Schmitt, österreichischer Nationalität, mit seinem Flugzeug unweit der Mündung des Limpopo bruchgelandet. Mit Insassin namens Verweer nach tagelangem Herumirren von Eingeborenen in erschöpftem Zustand zur Polizeistation —›‹ »Der Teufel soll den Namen holen!« schnaufte Aston und las weiter, ›gebracht. Papiere in Ordnung. Ermordete in der Nacht vom siebzehnten zum achtzehnten zwei Eingeborene, die das Motorboot eines gewissen Doktor Damm bewachten. Entfloh damit. Draußen auf der Reede liegender Dampfer Donna Tonio sah im Scheinwerferlicht großes Bündel, aller Vermutung nach Leiche Doktor Damms, über Bord werfen. Sofort eingesetzte Suchaktion vergebens. Wird erwartet, daß Flüchtling sich der Papiere Damms bedient. Ersuchen um Festnahme.‹ Es folgte eine eingehende Beschreibung des Motorbootes.
Hyppo kraulte sich die Schläfe und drehte mehrmals sein wahrhaft mächtiges Ohr durch den Zeigefinger der aufgestützten Linken.
»Bin ein verdammter Esel gewesen! — Hätte den Wisch etwas eingehender studieren sollen, bevor ich die Verhaftungsanweisung an die Häfen erließ!«
Das Ding strotzte ja von Unwahrscheinlichkeiten, deren gröbste die angebliche Überbordwerfung einer Leiche, ausgerechnet im Scheinwerferlicht eines Dampfers, darstellte.
Abgesehen davon! Woher sollte der richtige Doktor Damm ein Motorboot erlangt haben, ohne Wissen irgendeiner Behörde, und warum hatte er nicht, zumindest einer Hafenpolizei, sein Wiederauftauchen gemeldet?
Je mehr Oliver Aston sich in den Text vertiefte und sich als erfahrener Kriminalist mit dem Für und Wider der Angaben auseinandersetzte, desto klarer wurde ihm, daß seine Selbstbezichtigung, ein ausgewachsener Esel zu sein, dem Tatbestand entsprach.
Was sonst nie geschah, er zündete sich eine zweite Zigarre an diesem Vormittag an. Dann drückte er den Signalknopf nieder. Sein Sekretär erschien.
»Hardfield! — Hier auf diesem Zettel steht der Name einer in Portugiesisch-Ostafrika befindlichen Polizeistation. Rufen Sie sofort unsere Funkstelle an und geben den Auftrag, die Verbindung herzustellen, dann mich verbinden! — Ich bin für keinen zu sprechen!«
Die Augen des Gewaltigen ließen auf sehr schlechte Stimmung schließen. Eilfertig entfernte sich der Beauftragte.
Hyppo rauchte und dachte angestrengt nach.
Wenn das alles zutraf, was der angebliche oder richtige Doktor Damm in seinem Bericht niedergelegt hatte, dann standen ihm eine Reihe recht aufregender Tage bevor.
Im stillen beglückwünschte er sich nur, daß er an alle ihm unterstellten Hafenbehörden die strenge Anweisung gegeben hatte, im Falle der Festnahme der beiden Mordverdächtigen keine Silbe darüber den ewig nachrichtenhungrigen Presseleuten verlauten zu lassen. Der Name Doktor Damm hatte ihn stutzig gemacht.
Hyppo rauchte jetzt recht bedächtig.
Die Akten interessierten ihn nicht weiter.
Er besaß ja Zeit zum Rauchen und Nachdenken.
Allmählich formte sich ein Bild aus den allein in Frage kommenden Vermutungen.
Die Bestätigung mußte in spätestens einer Stunde in seinen Händen sein. Sie kam viel früher.
Oliver Aston rauchte und gab sich dem geliebten Spiele hin, formvollendete Rauchringe in die Luft zu hauchen.
Der Fernsprecher summte:
»Hallo, Aston!«
————
»Wie?——Besitzt keine Funkeinrichtung?«
————
»Auch keine Fernsprechverbindung?«
————
»Nur selten besetzte Küstenwachstelle an der Flußmündung? ——Von wann datiert Ihr Stationsregister?«
————
»Das neueste?«
————
»Danke für die Bemühungen!«
Grinsend wie ein Faun drückte Hyppo eine Weile die Gabel des Fernsprechers nieder und verlangte bald eine neue Verbindung, der eine weitere kurz darauf folgte.
Martin Damm überraschte es, als er gegen zehn Uhr, bedeutend höflicher als am Vorabend, von zwei Beamten aufgefordert wurde, ihnen zu folgen. Am Hofausgang des Gefängnisses reichte man ihm einen Mantel.
Es regnete draußen, wie er durch die Glasscheiben sah.
Ein geschlossener Kraftwagen stand unmittelbar vor der Freitreppe.
Sie stiegen zu dritt ein.
Nach einer Fahrt durch mehrere Straßen bog der Wagen wiederum in einen Hof ein.
Sie stiegen aus, nachdem ihm bedeutet wurde, den Mantel zurückzulassen.
Ein Aufzug brachte ihn und seine Bewachung rasch in das erste Stockwerk des Gebäudes.
Ein langer Gang tat sich auf, doch schon bei der ersten Tür traten sie ein. ›Hardfield, Sekretär——› die weitere Amtsbezeichnung vermochte Damm nicht mehr zu lesen.
»Untersuchungsgefangener Damm!« sagte der eine seiner Begleiter recht gleichgültig, schnappte sich einen Stuhl und ließ sich darauf nieder.
»Doktor Damm!——Der Chef wünscht Sie zu sprechen!
——Allein!« fügte der Insasse des Zimmers hinzu, da der eine der Kriminalbeamten sich anschickte, dem Sträfling zu folgen. »Dort bitte, die Tür!«
Martin Damm berührte es wunderlich, daß der anscheinend hier Befehlende eilfertig aufsprang und selber die Tür vor ihm öffnete.
Er betrat einen in dunklem Holz getäfelten Raum.
»Morgen, mein lieber Doktor!——Wie geht es Ihnen?«
Eine Gestalt selten erlebter Ausmaße erhob sich geradezu freudestrahlend von ihrem Sitz und bot die Rechte dar. Martin Damm durchzuckte nur die Vorstellung: Um Gottes willen, wen d i e Hand als Faust trifft, der ist Kleinholz. Dennoch ergriff er sie und erwiderte den Morgengruß.
»Aston!——Oliver Aston ist mein Name, Chef der Kriminaldirektion.«
»Sehr erfreut, Sie zu sehen!« antwortete Damm mit den üblichen englischen Begrüßungsworten.
»Nehmen Sie Platz!——Sie wünschen zu rauchen?«
»Danke vielmals, ich rauche nicht!«
»O——schade!——Ziehen Sie einen alten Portwein vor?«
»Da kann ich nicht nein sagen!«
Der Dicke öffnete eine Tür seines Schreibtisches, brachte eine Flasche zum Vorschein, zwei Gläser und putzte diese in andächtigem Behagen mit einem Leinentuch, das er ebenfalls einem der Fächer entnommen hatte.
Dann schenkte er die Gläser voll ein.
»Ihre Gesundheit, Doktor!——Ich freue mich aufrichtig, Sie, den wir bereits in den ewigen Jagdgründen wähnten, hier begrüßen zu können!«
»Ich danke Ihnen!« antwortete Martin Damm, hob ebenfalls sein Glas, trank dann aber vorsichtig, während sein Gegenüber mit geradezu urweltlichem Schnaufen kundtat, daß er das seine restlos und mit großem Behagen geleert hatte.
»Sie werden erstaunt sein, Doktor, daß sich Ihre Lage so rasch geändert hat!« röhrte mit verschmitzt zugekniffenen Augen das immer neues Erstaunen erweckende Ungetüm.
»Wenn Sie erlauben, empfinde ich eine Änderung meiner unverdienten Lage nur in Ihrem zuvorkommenden Verhalten!«
»By Jove!« lachte Aston dröhnend. »Das nenne ich eine liebliche Abfuhr!——Aber ganz so hab ich mir einen Doktor Damm vorgestellt!«
Damm nickte verbindlich, als ob er die Worte bestätigen wollte.
»Wissen Sie, Doktor, ich bin nicht für lange Umschweife. Erzählen Sie mir doch einmal ausführlich Ihre Erlebnisse seit Ihrem Start von dem hiesigen Flughafen——. Verzeihen Sie!——Ihr schriftlicher Bericht klingt so unglaubhaft, daß ich gerne aus Ihrem Munde die näheren Einzelheiten hören möchte.——Daß Sie tatsächlich jener vor Wochen verschollene Doktor Damm sind, steht bereits fest. Die Ihnen gestern abend zugestellte Anklageschrift ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Es geht jetzt darum, hinter die Schliche eines angeblich längst begrabenen Doktor Jose Sill zu kommen. ——Ich verstehe übrigens sehr gut deutsch.
Nur bitte ich Sie, langsam zu sprechen. ——Bin etwas außer Übung! ——Und nun los, bitte!«
Der Sprecher lehnte sich gemütlich in seinem Armstuhl nach hinten, daß Damm schreckerfüllt jeden Augenblick das Zusammenkrachen der Lehne befürchtete. Alle Geräusche deuteten darauf. Doch sie brach nicht.
Es entging ihm nicht, daß sein urfriedlich lächelndes Gegenüber sachte einen unter der Tischplatte angebrachten Schalter betätigte. Er wäre nicht Physiker gewesen, um nicht genau zu wissen, daß jetzt irgendwo ein Magnetophonband lief, welches seine Aussagen registrierte. Das zu der Einrichtung gehörige Mikrophon barg gewiß die Stehlampe auf dem Tisch.
Ohne Zögern begann er langsam, deutlich und mit Bedacht. Er versuchte die Vielfalt der Geschehnisse knapp und eindeutig zusammenzudrängen, schilderte die technischen Einrichtungen des Werkes unter dem Felsen einfach, sachlich und einprägsam in der Sprechweise des Wissenschaftlers, der an Vorträge über schwierige Themen gewöhnt ist.
Aber gerade diese Art der Darstellung löste bei Oliver Aston eine atemberaubende Spannung aus.
Damm war bereits bis zu dem Beschuß bei der Flucht im Motorboot angelangt, als ein Schnurren des Fernsprechers ihn nötigte, seine Aussage zu unterbrechen, bis der Chef der Kriminaldirektion das Gespräch beendet hatte.
»Ja!——Ich lasse bitten!« vernahm er nur.
Die Tür hinter ihm öffnete sich. Schritte kamen näher. Damm hielt es nicht für erforderlich, sich umzublicken.
Da erscholl dicht neben ihm ein Schrei:
»Doktor Damm!——«
Er sprang auf. Das war Cross, der Kommandant des Flughafens.
»Doktor?—— Sind Sie es ——oder Ihr Geist?« Ein Ausruf unbeschreiblicher Bestürzung. Es fehlte wenig, da hätte ihn Cross umarmt. Es blieb bei einem harten Schlag auf die Schulter und einem begeisterten Schütteln der Hände.
»Doktor, ——Sie leben!—— Lieber Gott und in diesem Anzug?« ——Cross war keines Wortes mehr fähig; starrte abwechselnd seinen Freund Hyppo und die gespensterhafte Erscheinung des Totgeglaubten an.
Oliver Aston zog seinen breiten Mund zu einem Grinsen, vor Verzückung bebend, beugte sich dann mit der Behendigkeit, die niemand dem mächtigen Fleischkoloß zugetraut hätte, vor, langte nach einem weiteren Glas, putzte es genau so hingebungsvoll wie vorher und schenkte den golddunklen Portwein ein.
»Hier, mein lieber Cross! ——Stärken Sie sich erst mal! ——Stuhl steht dort!«
Der Kommandant trat wenige Schritte zurück, schleifte den Stuhl an der Lehne heran und ließ sich auf den Sitz fallen.
Aston schob ihm den funkelnden Kelch mit seiner Pratze vorsichtig über die Tischplatte, bis Cross danach griff.
»Auf guten Willkomm unseres Doktors!«
Er stieß mit seinem Sträfling an, und auch Cross hatte sich nun wieder so in der Gewalt, daß er der Aufforderung nachkommen konnte. Seine Augen leuchteten, als er dem verschollen Geglaubten zutrank.
»Und nun wollen Sie natürlich wissen, wie unser Doktor in meine Fänge geriet und wo er sich aufhielt, Cross?« fragte Oliver Aston bedächtig.
Dieser hustete, nickte zustimmend mit dem Kopf. Er hatte sich offensichtlich durch zu hastiges Trinken verschluckt. Er preßte das rasch hervorgezogene Taschentuch vor die Lippen.
»Also, da muß ich Sie enttäuschen, guter Freund!« fuhr der Kriminalchef unberührt fort. »Nur eines kann ich Ihnen verraten! ——Dieser ganz gewiß unverständliche Zebraanzug unseres lieben Doktors ist nur eine kleine Maskerade. — Sozusagen aus Sicherheitsgründen! — Ich muß Sie daher auch in meiner Eigenschaft als Amtsperson bitten, lieber Cross, daß Sie kein Sterbenswörtlein über das soeben Erlebte irgendwo verlauten lassen. ——Ich weiß, ich kann mich auf Sie verlassen, sonst hätte ich nicht gerade Sie, alter Knabe, hierhergebeten, die immerhin erforderliche Rekognoszierung eines lebendigen Toten vorzunehmen. Wir verstehen uns! ——All right! ——Ich schätze, in vier bis fünf Tagen werden wir drei uns einmal gemütlich hinter einige Flaschen klemmen, und dann soll Mister Damm erst so richtig auspacken. ——Einverstanden?«
»Sehr sogar, wenngleich mich begreiflich die Neugier lockt, schon jetzt wenigstens die Hauptdetails zu erfahren. Ist aber besser so! Wissen ja, Hyppo, daß ich mich nur nach Ihren dringenden Bitten entschlossen habe, hierher zu kommen. -Verdammt viel zu tun bei mir draußen!«
Cross erhob sich, drückte den zwei Zurückbleibenden die Hände und schritt zur Tür. Dort wandte er sich noch einmal um. »Aber es bleibt bei unserer Verabredung in einigen Tagen?«
»Ganz gewiß!« brummte Oliver Aston friedlich.
»Dann also alles Gute!«
Die Polstertür schloß sich hinter ihm.
————
»So!« schnaufte Aston nach einer Weile. »Die letzten Zweifel wären hiermit behoben, Doktor Damm! ——Formell sind Sie und Miss Förwir nunmehr aus der Haft entlassen. Die Behörden benötigen einige Zeit, bis Ihnen die offizielle Bestätigungsurkunde zugehen wird. Das macht auch nichts, denn ich möchte Sie und Ihre Begleiterin herzlich bitten, noch einige Tage Pensionäre unseres vorzüglich eingerichteten Gefängnisses zu bleiben.«
Du hast die Ruhe weg, dachte Damm, doch war er gespannt, zu erfahren, was diese Maßnahme bezwecken sollte.
»Sehen Sie!« hub Aston wieder an. »Mir ist noch nicht ganz klar, wie groß das von Ihnen angedeutete und von mir als gewiß vorhanden angenommene Netz der Agenten Sills ist. ——Es handelt sich demnach nur um eine Vorsichtsmaßregel meinerseits, die ich aber in Ihrem Interesse für unvermeidbar erachte. Bei Fanatikern stecken Kugeln verflucht locker im Pistolenlauf. ——Sie verstehen mich!«
»In der Tat!« antwortete Damm überzeugt.
»Dann darf ich Ihnen zunächst einmal Ihre Brieftasche und Ihren Paß zurückgeben!« Er reichte beides dem entlassenen ›Sträfling‹. »Wie ich sah, besitzen Sie über fünftausend Dollar Barmittel. Ohne Ihrem Entschluß vorzugreifen, würde ich vorschlagen, daß Sie einen Teil dieser Barschaft benutzen, sich und Miss Förwir neu einzukleiden. Schließlich können Sie nicht für alle Ewigkeit in Overalls herumlaufen. ——Wollen Sie mir es überlassen, daß ich heute nachmittag zu Ihnen einen Schneider und zu der Dame die Direktrice unseres besten Modewarenhauses in Kapstadt schicke. Ich hoffe, dadurch dazu beitragen zu können, den unterlaufenen Mißgriff unserer Behörden wieder wettzumachen.«
»Wirklich sehr entgegenkommend von Ihnen!« entgegnete Damm dankbar.
Man konnte den Eindruck haben, daß der letzte Bann zwischen ihnen gebrochen und die Brücke zu einer guten Kameradschaft geschlagen war.
Aston erläuterte gerade noch die Einrichtung der für das Paar vorgesehenen beiden Räume, die sonst nur für politische Häftlinge bestimmt und daher recht komfortabel eingerichtet waren, als er plötzlich ein Formular aus dem Aktenstoß zog und es Martin Damm zuschob.
»Lesen Sie bitte! Sagen Sie mir Ihre Meinung! Mir liegt viel daran! Es heißt jetzt für mich, diesen Sill zu erwischen. Vielleicht können Sie mir einen Fingerzeig geben!«
Es war das Telegramm, welches Anlaß zu der Verhaftung gegeben hatte.
Damm las, bedächtig, wie es seine Art war. Er legte das Blatt auf den Tisch zurück.
»Wirklich reizend! ——Glänzend ausgedacht, uns auf absehbare Zeit kaltzustellen, bis sich die Angelegenheit aufgeklärt hätte. Nur eines dürfte nicht zutreffen, der Name des Schiffes!«
»Nanu!« Oliver Aston schwang sich voller Interesse vor.
»Ja!« meinte Damm. »Es dürfte nicht Donna Tonio, sondern Don Antonio heißen. Kann ein Fehler infolge mehrfacher Weitergabe des Textes sein. Glaube ich aber nicht, denn Don Antonio heißt der Zubringerdampfer Doktor Sills!«
»Wie bitte? ——Augenblick Ruhe! ——Nicht reden!« rief Aston. Er hielt mit der Linken Augen und Stirn bedeckt, als ob er sich von der Umwelt ganz abschließen wollte, um schärfer nachdenken zu können.
In dieser seltsamen Stellung verharrte er eine gute Weile. Damm störte ihn nicht, nutzte die Muße, um die gigantische Gestalt seines Gegenübers, die Hände, den Kopf, Ohren, Hals, Schultern und den einer Tonne gleichen, noch sichtbaren Unterleib in Ruhe zu mustern. Ein einmaliges Exemplar, lautete sein Urteil.
»So!« schnaufte Aston und ließ die Hand dröhnend als Faust auf die Tischplatte fallen. »Jetzt weiß ich auch, wer da gefunkt hat. Niemand anders als dieser niederträchtige Kasten, Don Antonio! Doktor! Können Sie mir irgendwelche Angaben über das Schiff machen?«
»Ich nicht! Ich weiß nur von Fräulein Verweer, daß es zweitausend Tonnen groß ist, Zweischraubenantrieb, hellgraue Bordwände, weiße Aufbauten, zwei Lademasten, Kohlenfeuerung besitzt und unter mexikanischer Flagge läuft. Kapitän ist Antonio Sill, der Bruder Doktor Jose Sills!«
»Danke, genügt mir vollkommen! Zweischraubenantrieb bei zweitausend Tonnen stellt an sich schon meines Wissens eine Seltenheit dar! ——Sie gestatten einen Augenblick.«
Aufgeregt langte er sich den Hörer des Fernsprechers.
Damm vernahm, wie er sich mit der Hauptfunkstelle verbinden ließ, und hörte den Text an, den er durchgab.
»An alle Häfen, Dampfer, Kriegsschiffe und Flugzeuge!« lautete der Schluß.
»Hö! ——Den werden wir schon kriegen!« Der Dicke wischte sich die Schweißperlen von der Stirn. »Den werden wir schon kriegen, den Halunken!«
»Na?« bezweifelte Martin Damm. »Nach meiner Rechnung muß er heute abend oder morgen früh die Daumeninsel erreicht haben. — Finden Sie dann mal einen Zweitausendtonner auf der Weite des Westmeeres!«
»Höh ——— höh!« knurrte Oliver Aston. »Auch dem müssen einmal die Kohlenbunker leer werden!«
»Ganz gewiß!« gab Damm zurück. »Doch mir kam eben ein Gedanke. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. — Fahren wir zu meinem Motorboot. Die Seekarten, die sich dort befinden, könnten Ihnen vielleicht wertvolle Aufschlüsse vermitteln. — Eines steht schon jetzt fest, daß der Platz an der Mündung des Limpopo, auch Krokodilfluß genannt, das Fluchtziel Sills darstellte. Es waren auch sonst noch einige Häfen eingezeichnet und mit Geheimzeichen versehen, die Ihnen Anhaltspunkte über die Organisation Sills geben könnten!«
Oliver Aston sprang auf:
»Das hätten Sie mir früher sagen müssen. Aber ich weiß! Sie sind schließlich kein Kriminalist. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Kommen Sie!«
Aston steckte bereits in seinem Überzieher, den Hut in der Hand.
»Hat man Ihnen keinen Mantel gegeben?«
»Doch! — Liegt unten im Wagen!«
Die beiden Kriminalbeamten im Vorzimmer sprangen höchst überrascht auf, als ihr Chef in ungewohnter Hast den Raum durchquerte und einem von ihnen zuraunzte: »Hamshire! ——Los! ——Mitkommen!«
In einem der Hafengebäude nahm der Chief einen versiegelten Umschlag entgegen. Er enthielt, wie sich Damm bald überzeugte, sämtliche Schlüssel zu dem Motorboot. Rasch ging die Fahrt weiter.
Der Regen hatte aufgehört.
Schließlich bog der Kraftwagen ein, und kurze Zeit darauf lag das Boot vertäut an einem der Kais gerade vor ihnen.
»Bitte!« sagte Aston und übergab seinem Gast die sorgfältig gebündelten Schlüssel.
Damm sprang als erster an Bord.
Als Oliver Aston folgte, glaubte er einen Augenblick, das Boot kippe um. Doch ehe er es sich versah, stand Aston schon dicht hinter ihm.
Oben am Rande der Hafenmauer patrouillierte ein Posten auf und ab.
Die Kajütentür sprang nach einigen Versuchen, den rechten Schlüssel in das Schloß zu stecken, auf.
Martin Damm schaltete die Deckenbeleuchtung ein, und sofort wandten sie sich der noch auf dem Tisch ausgelegten Karte zu.
»Da ist ja der blödsinnige Name der portugiesischen Polizeistation vermerkt. — Ich kann ihn mir einfach nicht merken!« unterbrach nur einmal Oliver Aston seinen Begleiter.
Damm berichtete kurz und knapp, meinte dann, es sei vielleicht zweckmäßig, einen erfahrenen Seemann zu Rate zu ziehen, um alles auszuwerten.
»Weiter!« sagte Aston nur.
Da holte Martin Damm den Stoß der anderen Seekarten und vorgefundenen Hefte mit den Eintragungen hervor.
»Wonderful! —— Wonderful!« quiekte Hyppo mit einer hohen Stimme, die gar nicht seiner Kehle zu entstammen schien. Vorsichtig löste er die angeheftete Karte von der Tischplatte und rollte das kostbare Material zusammen.
»Lassen Sie mich bitte das gesamte Boot sehen!« bat er, und Damm zeigte ihm unter ständigen Hinweisen auf ihren Zweck die Inneneinrichtung dieses einmaligen kleinen Schiffes.
»Übertrifft alle meine Erwartungen. Wenn hier schon selbst ans Letzte gedacht wurde, wie mag erst die Technik im Daumenfelsen beschaffen sein! — Höchst aufschlußreich!
——Wirklich höchst aufschlußreich! ——Übrigens, Doktor, was ich noch sagen wollte. ——Haben Sie vielleicht den Wunsch, für sich oder Fräulein Verweer«, er sprach zum ersten Male den Namen richtig aus, »etwas von Bord mitzunehmen?«
»Ja!« sagte Damm. »Meine gerettete Peilsonde——.«
»Dafür habe ich volles Verständnis, Sie Monopolbesitzer«, schmunzelte Oliver Aston in behäbiger Heiterkeit. »Und weiter?«
»Für Fräulein Verweer die vier Flaschen hier!« Damm öffnete ein Fach. »Ich befürchte, daß ihr die normale Ernährung nicht bekommt. Sie enthalten Spezialgetränke aus den Sillschen Laboratorien. Vielleicht muß sie darauf zurückgreifen!«
»Ist doch selbstverständlich!« brummte Aston. »Sonst noch was?«
»Ja!« murmelte Damm nach einigem Zögern. Schritt dann zu einem der eingebauten Schränke, schloß auf und zog eine Kassette hervor, die er auf den Tisch stellte.
»Was soll damit?« fragte der Chef der Kriminaldirektion, hob den Deckel hoch und beschaute mit ehrlich bestürzter Miene den Inhalt.
»Das ist ja ein Vermögen!«
»Fräulein Verweer fand es in einer Geheimschublade des Tisches. — Sie beanspruchte einen Teil des Geldes — übrigens alles Dollarnoten — als Gehaltszahlung, den Rest als Entschädigung für mein in Brand geschossenes Flugzeug und als Schadenersatz für die Freiheitsberaubung. — Mir widerstrebte der Vorschlag. Wir kamen überein, die Kassette so, wie wir sie fanden, dem hiesigen Gericht zu übergeben. Es soll über die Besitzverhältnisse sowohl dieses Geldes als auch des Motorbootes entscheiden!«
————
Lange schaute Oliver Aston seinen Sicherheitshäftling an, und aus seinen Augen leuchtete plötzlich eine Hochachtung, der er in seinem Beruf leider nur sehr selten Ausdruck verleihen konnte.
»Damned — Doktor!« Ein elefantenähnlicher Trompetenton ließ die Kajüte erzittern. Der Chef der Kriminaldirektion hatte sich nur mit einem beachtlich großen Taschentuch die Nase geschnaubt. »Doktor! ——Das kann ich Ihnen heute schon sagen, wie der Spruch ausfallen wird. ——Sie kennen die Summe?«
»Ja, Mister Aston!«
»Well! — Dann übernehme ich das Ding zu treuen Händen und werde das Weitere veranlassen!«
»Ich bin Ihnen sehr verbunden!«
Damm glaubte etwas von dämlich ehrlichem Esel zu hören, doch er konnte sich auch getäuscht haben.
Dem auf dem Kai harrenden Kriminalbeamten widerfuhr an diesem Tage eine neue Überraschung, als sein Chef ihn aufforderte, herunterzukommen und die von ihm bezeichneten Dinge in dem Wagen zu verstauen.
Nichts brauchte der Sträfling anzurühren.
Scheint ja ein höchst seltsamer Galgenvogel zu sein, dieser Damm, grübelte der Mann verärgert.
Nicht weniger wunderte er sich, als er im Untersuchungsgefängnis wiederum Handlangerdienste leisten mußte, während der Häftling selbst nur ein in Zeltleinwand eingehülltes Paket trug und es in einer der Luxuszellen, wie sie genannt wurden, deponierte. Außerdem verabschiedete sich der Chef, wie er beobachtete, nach längeren Anweisungen an den herbeigeeilten Anstaltsdirektor auffallend höflich von diesem merkwürdigen Verbrecher. Eine komische Geschichte! —
Gisela Verweer und Doktor Damm saßen in ihrer neuen Unterkunft, die tatsächlich guten Hotelzimmern gleichkam. Sie hatten nicht nur einen Baderaum, sondern einer der Aufseher hatte sogar einen Fernsprechapparat in den Wandkontakt eingestöpselt.
Zu berichten gab es wahrlich genug.
Die größte Sorge galt der Gesundheit der geliebten Frau. Mehrfach hatte Damm geäußert, daß ihr, laut Absprache mit dem Chef der Kriminaldirektion, im Falle des leisesten Unbehagens sofort der beste Internist in Kapstadt zur Verfügung stehen würde. Sie aber versicherte immer wieder beharrlich, daß sie sich wohler als je zuvor fühle. In dem jahrelangen Umgang mit Sill sei sie langsam zur Ernährungschemikerin geworden, und sie wisse, was sie zu tun habe.
Während sie ihn noch zu beruhigen versuchte, zerriß ein hartes Surren des Fernsprechers die einseitig gewordene Unterhaltung.
Er ging zum Apparat und nahm den Hörer ab.
»Ist ja unfaßbar!« hörte sie Damm sagen.
»Ja, ohne Zweifel!«
————
»Danke Ihnen vielmals, Mister Aston!«
————
»Ja, alles in bester Ordnung!«
»Sehr liebenswürdig! ——Auf Wiedersehen!«
————
Martin Damm legte den Hörer auf, stand mitten im Zimmer.
»Das ist tatsächlich unfaßbar!——Aston sprach von einem märchenhaften Glücksstern, der über uns leuchten müsse.——Er läßt dir übrigens seine Komplimente zu Füßen legen, um es wörtlich zu übertragen.«
»Na, und?« fragte Gisa, die aus Erfahrung wußte, daß nur dann ihr Martin in seinen Haaren herumzauste, wenn außergewöhnliche Gedanken ihn bewegten.
»Antonio Sill und seine Besatzung sind dingfest gemacht, sitzen hinter Schloß und Riegel«, platzte er heraus.
————
Gisela Verweer war keiner Antwort fähig, sie staunte Damm nur mit offenen Augen an.
»Hör zu!« Er zog seinen Stuhl näher. »Du weißt, daß Aston vor einigen Stunden den Polizeirundspruch durchgab, nach dem Dampfer ›Don Antonio‹ zu fahnden. Der Tatbestand ist kurz folgender: Antonio Sill wollte in Lourenco-Marques Kohle bunkern. Die dort lagernden geringen Vorräte waren vorausbestellt. So dampfte er nach Durban. Am einundzwangzigsten in der Frühe erreichte er den Hafen und ließ das Schiff einschließlich aller freien Luken bis zum Rande volltrimmen.
Nachmittags herrschte ein ungewöhnlicher Sturm. Ohne Lotsen legte er ab und rammte kurz darauf den im Anlegemanöver begriffenen französischen Frachter ›Marseille‹. Es gelang der ›Don Antonio‹, deren Bug keine nennenswerte Beschädigung abbekam, mit eigener Kraft freizukommen. Die ›Marseille‹ zeigte bald darauf Schlagseite. Antonio Sill versuchte, entgegen den allgemein geltenden Vorschriften und trotz der Signale der Hafenpolizei, das offene Meer zu gewinnen.
Ein Zollkreuzer holte ihn ein und befahl die sofortige Rückkehr. Erst nach dem dritten Schuß vor den Bug drehte Antonio Sill bei und dampfte zurück. Wegen Widersetzlichkeit — Aston nannte da noch eine Reihe anderer Delikte -wurde die gesamte Besatzung, nachdem die Heizer das Feuer unter den Kesseln herausgerissen hatten und eine Wache an Bord beordert war, in polizeilichen Gewahrsam genommen, und sitzt nun schon seit Tagen auf Nummer sicher.«
»Und Sill sitzt auf seiner Insel und kann nicht entfliehen. Bravo! —— Die ausgleichende Gerechtigkeit! Und was will Aston nun unternehmen?« fragte sie weiter.
»Er hat bereits nach Washington telegraphiert. — Der Daumenfels ist, politisch betrachtet, Niemandsland. — Ein Vorgehen gegen Jose Sill ist formaljuristisch, wie er sich ausdrückte, nur von seiten der USA. wegen Vertragsbruch möglich, zumal nach unserer Aussage die Mitarbeiter Sills auf Grund freiwillig eingegangener Abkommen dort tätig sind.«
»Hast du denn als Geologe nicht zum Ausdruck gebracht, welches furchtbare Verhängnis den Ärmsten droht?« mahnte sie ihn.
»Gewiß! — Der gesamte Fragenkomplex muß sich in den nächsten Stunden klären, mehr konnte Aston mir nicht sagen!«
————
»Martin!——Sill ist in seiner Wut zu allem fähig!——
Wir müssen auf jeden Fall die Siedler retten, — — die Menschen!« entfuhr es Gisela Verweer, die vor Erregung zitterte.
»Du weißt selbst, daß die Daumeninsel nur mit schweren Waffen zu bezwingen ist. Ein derartiger Kampf könnte den Verlust vieler Menschenleben kosten. Ich habe das alles mit Aston durchgesprochen, auf der Fahrt im Kraftwagen. Er entgegnete mir, daß von seiten der Südafrikanischen Union keiner der zuständigen Staatsmänner die Verantwortung für ein solches Unternehmen tragen wolle. Lediglich ein wohlbegründetes Gesuch der USA. vermöchte den Stein ins Rollen zu bringen!«
»Entsetzlich, Martin!——Wie einfach habe ich mir die Befreiung vorgestellt!« schluchzte Gisela Verweer. Lange schaute er sie sinnend an und fragte dann sehr nachdenklich:
»Ob sie wirklich befreit werden wollen?«
Einen Tag später brachte Oliver Aston persönlich die amtlichen Dokumente, die die Niederschlagung des eingeleiteten Verfahrens und die offizielle Haftentlassung verkündeten. In einem Begleitschreiben wurde erneut darum gebeten, aus Gründen der Sicherheit das Gefängnis vorerst nicht zu verlassen.
Aston benötigte keine Überredungskunst, Doktor Damm von der Zweckdienlichkeit des Vorschlages zu überzeugen. Am nächsten Tage, spätestens am übernächsten, erwarte er die amerikanischen Kollegen in dem telegraphisch angekündigten Sonderflugzeug. Dann werde die Entscheidung fallen. Während der Unterhaltung — Gisela war in ihrem Zimmer beschäftigt — erzählte er auch, daß der Gouverneur von Portugiesisch-Ostafrika ihm einen Bericht zugeleitet habe. Die dortige Kriminalstelle habe mehrere Tage gebraucht, um von dem nächstliegenden Polizeiposten eine Streife zu dem angeblichen Ort des Verbrechens zu entsenden. Hochwasser sei der Anlaß der Verzögerung gewesen. Am Ort wurde ermittelt, daß sich dort in der fraglichen Zeit lediglich der Dampfer ›Don Antonio‹ aufgehalten habe. Man sei jedoch einer anscheinend weit verzweigten Organisation zum Schmuggel von Medikamenten auf die Spur gekommen.
Ähnliche Mitteilungen lägen bereits von weiteren kleinen Häfen der Ostküste vor. Der Fahndungsdienst arbeite auf Hochtouren, und die Affäre beginne größere Ausmaße anzunehmen, als je vorauszusehen gewesen wäre. Höchst befriedigt meinte der Kriminalchef, es sei nur gut gewesen, daß er beim ersten Auftauchen des Namens Damm, einem Instinkt folgend, alle zuständigen Stellen ersucht habe, nur chiffrierte Telegramme zu senden. Auf diese Weise könne der Sklavenhalter Sill — wie er sich ausdrückte — trotz seiner hervorragenden Radioeinrichtungen keine Neuigkeiten erfahren, die ihn zu warnen vermöchten.
Damm wollte wissen, wie man gegen Sill vorzugehen gedächte.
Hyppo zuckte seine mächtigen Schultern.
»Doktor! — Uns geht die Angelegenheit nichts an. Das einzige Delikt, welches wir ahnden könnten, wäre der Beschuß Ihres Motorbootes, als Mordversuch, erwiesen durch die von Ihnen verstopften Einschläge im Bug. — Ihrerseits wurde keine offizielle Anzeige erstattet. — Außerdem geschah der Feuerüberfall außerhalb der Hoheitsgrenzen der Union auf einen Angehörigen fremder Nationalität!«
»Ich glaube wohl nicht fehlzugehen, wenn ich diese Auffassung nicht mit der Ihren gleichstelle!« antwortete Martin Damm.
Oliver Aston lächelte vielsagend und, wie Damm festzustellen glaubte, in heimlicher Freude. Nach einem kaum merklichen Nicken fuhr er mit stark betonter Amtsmiene fort:
»Die Entscheidung fällt seitens der bereits ernannten Sonderkommission in Zusammenarbeit mit den Beauftragten aus USA.« — Er zögerte eine geraume Weile, blickte dann seinen Gesprächspartner fast bissig an.
»Ihnen darf ich wohl verraten, daß die hohe Politik in diesem Falle den Ausschlag gibt, denn——.« Er vollendete den Satz nicht. Nach einer kurzen Weile brummte er knurrig: »Der Telegrammwechsel beweist, daß die drüben jenseits des großen Teiches auf den Namen Doktor Jose Sill reagieren, wie ein Stier auf das rote Tuch!——Aber das nur unter uns, lieber Doktor!«
Bald darauf verabschiedete sich Oliver Aston so herzlich, wie es sonst nur unter alten Freunden Brauch ist.
In der Spätnachmittagsstunde des folgenden Tages erschien ein Beamter und ersuchte die Schutzhäftlinge, ihm zu dem bereitstehenden Kraftwagen zu folgen.
Das Ziel der Fahrt war bald erreicht. Gisa trug zum ersten Male seit langer Zeit ein neues Kleid, Martin Damm einen gut sitzenden grauen Anzug.
Man wies sie in einen Sitzungssaal, der nach altenglischer Tradition in dunklem Holz getäfelt war.
Außer einer hellstrahlenden Ampel beleuchteten auf dem erhöhten, in einem Halbbogen verlaufenden Richtertisch Stehlampen die Gesichter des Kollegiums.
In der Mitte wuchtete die mächtige Gestalt Oliver Astons. Rechts und links von ihm unverkennbar neugierige Augen von je fünf weiteren Herren.
Aston erhob sich.
»Darf ich bekannt machen.« Er nannte erst in rascher Reihenfolge Titel und Namen der Anwesenden, die gleichfalls von ihren Plätzen aufgestanden waren, und dann: Miß Gisela Verweer, Doktor Martin Damm.
Ein Gerichtsdiener hatte ihnen bereits zwei bequeme Polstersessel zurechtgeschoben.
Eine leichte Verbeugung beendete die kurze Zeremonie.
Man nahm wieder Platz, bis auf den Chef der Kriminaldirektion.
»Miß Verweer, Doktor Damm!« hub er an. »In diesem etwas ungewöhnlichen Verfahren wurde mir die Ehre zuteil, den Vorsitz zu führen. Der Vorschlag ging von dem eigens zu diesem Zwecke ernannten Sonderbeauftragten der Regierung der Union von Südafrika aus!« Eine gewandte Geste zu dem an seiner Rechten Sitzenden. »Die Bevollmächtigten der Regierung der Vereinigten Staaten von Nordamerika« — eine gleiche Bewegung zur Linken — »schlossen sich einstimmig dem Vorschlag an. — Sie befinden sich, das möchte ich ausdrücklich hervorheben, keinesfalls in einer Art Anklagezustand, noch vermögen wir Sie als Zeugen zu bezeichnen. Wir möchten Sie lediglich als Experten hören, die als einzige über die Organisation des Werkes von Doktor Jose Sill auf der sogenannten Daumeninsel Auskunft und Rat erteilen können. ——— Gegen genannten Doktor Sill ist die Anklage erhoben worden, schuldig zu sein: des Vertragsbruches, der Urkundenfälschung, zumindest der Mitwirkung an einer solchen betreffs eigener Todeserklärung, des Menschenraubes unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, der Herstellung, Fälschung und des ungesetzlichen Vertriebes von Medikamenten, des Besitzes und der Benutzung von einer Privatperson nicht erlaubten schweren Waffen, des Mordversuches, indem er zwei in seiner Gewalt befindliche Personen mit diesen Waffen an der Flucht zu hindern versuchte, und der geheimen Verschwörung zwecks Umsturzes der bestehenden Weltordnung mit Hilfe künstlicher Ernährung.«
Oliver Aston hatte sehr langsam und betont sprechend die einzelnen Punkte der Anklage von einem Blatt abgelesen. »Darf ich Sie bitten, Doktor Damm, Miß Verweer, die der englischen Sprache nicht so mächtig ist wie Sie, das soeben Vernommene zu übersetzen!«
Gisela Verweer schüttelte verneinend den Kopf.
»Ich habe verstanden!« sagte sie.
»Danke Ihnen! — Ihre schriftlich niedergelegte Aussage halten Sie in vollem Umfang aufrecht?«
»Ja!« ertönte es zweimal.
Ein langewährendes Frage- und Antwortspiel begann. Die amerikanischen Herren erwiesen sich als sehr zähe und überaus wißbegierig.
Doch Martin Damm geriet mehr und mehr in Harnisch, als ihm offenbar ward, daß dem Manöver der taktische Plan zugrunde lag, durch betonte Skepsis so viele Tatsachen wie irgend möglich herauszulocken. Ständig wurden neue Zweifel zum Ausdruck gebracht, daß Sill ein Werk in dem von ihm und Gisa geschilderten Ausmaße habe aufbauen können.
Endlich verlor er die Geduld, als einer der amerikanischen Experten nachzuweisen versuchte, daß die Geldmittel Sills in keinem Fall ausgereicht haben könnten. Die Aztekenverschwörung wurde als Utopie abgetan, außerdem wurde als höchst unglaubwürdig bemängelt, daß Sill, wie behauptet, jahrelang an die tausend Menschen künstlich ernährt haben könne.
Sich gewaltsam zur Ruhe zwingend, stand Damm auf.
»Mister Aston! — Ich bitte, einen kleinen Beweis erbringen zu können, der meine Widersacher vielleicht doch eines Besseren belehren dürfte!«
Das Wort Widersacher und die erbitterte Sprechweise lösten bei den Amerikanern einige Verblüffung aus. Die Vertreter der Union verhielten sich bedeutend zurückhaltender.
»Bitte sehr, Doktor Damm!«
»Dann wollen Sie die Freundlichkeit haben und aus meinem Aufenthaltsraum zwei Flaschen holen lassen, die die Aufschriften A siebenzehn und R zweiundfünfzig tragen. Ich benötige ferner etwa fünfzehn Gläser!«
»Ich darf wohl dem Antrage Doktor Damms stattgeben?« Ein fragendes Umschauen, dem allseitiges zustimmendes Kopfnicken folgte.
Der Gerichtsdiener erhielt seinen Auftrag. Martin Damm schob ihm noch einen Zettel zu, auf dem er rasch die Bezeichnungen vermerkt hatte, um jedes Mißverständnis auszuschließen.
»Ich schlage eine kurze Pause vor!« rief Oliver Aston in das einsetzende Stimmengewirr.
Droben an dem Tischhalbrund tauschte man die Meinungen aus.
Gisela fragte leise:
»Was hast du vor, Martin?«
Er wehrte ab. Da schwieg auch sie.
Nach einer knappen Viertelstunde erschien der Gerichtsdiener wieder und übergab Damm die erbetenen Flaschen.
Dieser warf nur einen raschen Blick auf die Etiketten und dankte.
Ein zweiter trug auf einem Tablett die Gläser herbei. Man sah seinen vorsichtigen Bewegungen an, daß er an derlei Hantieren mit zerbrechlicher Ware nicht gewöhnt war. Er stellte das Tablett vor Oliver Aston auf den Tisch.
Martin Damm erhob sich.
Sofort trat Ruhe ein.
»Ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, daß Sie, meine Herren, nach der langen Sitzung Hunger, vielleicht sogar Abspannung empfinden?«
Man nickte zustimmend.
»Darf ich mir erlauben, denjenigen, die gewillt sind, sich einem kleinen Experiment zu unterziehen, eine Probe Sill'-scher Produkte anzubieten?«
Unbekümmert goß Damm eine Anzahl Gläser ein.
»Sie brauchen nicht das geringste für Ihre Gesundheit zu fürchten.——Ich bürge mit meinem Kopf!«
Der letzte Satz erzeugte allgemeine Heiterkeit.
»Darf ich bitten!——Ich trinke selbst mit!«
Keiner schloß sich aus.
»Auf Ihr Wohl!« sagte Damm.
Sie tranken alle.
»Donnerwetter! — — Verflucht scharf!« ertönte eine hustende Stimme.
Die meisten räusperten sich vernehmlich, denn es kratzte ihnen brennend in der Kehle.
Damm wartete unberührt eine geraume Weile, während sich die »Versuchskaninchen« etwas verdutzt und im Zweifel darüber, was nun geschehen würde, anblickten.
Martin Damm schwieg.
»Alle Teufel!« rief plötzlich einer von den Amerikanern. »Ich verspüre nicht den geringsten Hunger mehr!«
»Und werden sich in Kürze sogar äußerst wohl und voller Spannkraft fühlen!« entgegnete Damm trocken.
Der versprochene Erfolg trat tatsächlich schon nach unglaublich kurzer Zeit bei allen Beteiligten ein.
Die Verblüffung stieg.
Eine derartige Wirkung hatte keiner erwartet.
Der Meinungsaustausch wurde zusehends reger, ja stürmisch.
Oliver Aston ergriff das Wort:
»Ich glaube wohl mit Recht im Namen aller zu sprechen, wenn ich feststelle, daß diesem Getränk eine Wirkung innewohnt, die mit keinem bisher bekannten Medikament zu vergleichen ist!«
Zustimmendes Gemurmel folgte.
»Sehr wohl!« entgegnete Damm. »Das Getränk enthält übrigens, das muß ich ausdrücklich hervorheben, keinerlei Stimulans, sondern stellt lediglich ein völlig ungefährliches synthetisches Nahrungshochkonzentrat dar! ——Gestatten Sie, daß ich jetzt einen zweiten Beweis dafür antrete, daß den Erkenntnissen Doktor Sills sehr weittragende Bedeutung zuzumessen ist.«
»Ich bitte darum!« ertönte Astons tiefe Stimme.
»Wünscht vielleicht einer der Herren — und ich sehe ja, daß viele von Ihnen stark rauchen — auf etwa vierundzwanzig Stunden von diesem Laster befreit zu werden, ohne während dieser Zeit auch nur die Spur eines Verlangens danach zu haben?«
Dieses Mal war die Wirkung der Aufforderung zwiespältig.
Mit unverkennbarer Spottlust wurden die sonst so skeptischen Herren der USA. von den Vertretern der Südafrikanischen Union angestachelt, auch dieses Experiment über sich ergehen zu lassen.
»Also bitte!« sagten schließlich nach einigem Wortgeplänkel zwei Amerikaner. »Wir sind bereit!«
Martin Damm reichte die Gläser zu, deren rubinroter Inhalt prächtig schimmerte.
»Wundervolle Farbe!« wurde eine Bemerkung laut.
Die beiden Opfer tranken nach vorsichtigem Nippen gefügig die Kelche leer.
»Nun rauchen Sie bitte!« lächelte Damm in leichter Ironie.
»Pfui Teufel!« entfuhr es dem ersten, der voller Ingrimm die Zigarette im Aschenbecher ausdrückte.
»Sehen Sie! — Genau so sprach ich auch!« meinte Martin Damm gelassen. »Verspüren Sie noch den geringsten Hang zum Rauchen?«
»Im Gegenteil, ich fühle mich selten wohl«, antwortete einer von ihnen.
»Dann habe ich wohl nur mit diesen zwei Kostproben den versprochenen Beweis erbracht.« Er nahm seelenruhig wieder neben Gisela Platz.
»By Jove! ——Damit wäre ein Geschäft zu machen!«
glaubte er noch aus dem leise geführten Gespräch zu hören.
Die Sitzung ging weiter.
Martin Damm und Gisela Verweer folgten ihr unbeteiligt, wurden doch ausschließlich juristische Fragen diskutiert und die Möglichkeiten erwogen, wie man ohne Verluste von Menschenleben in Sills Felsenfestung eindringen könne. Die Debatte zeitigte nicht das geringste positive Ergebnis.
Da bat Damm um das Wort.
»Ich sehe nur einen Weg, Sills habhaft zu werden, ohne daß ein kriegsmäßiger Einsatz erfolgt, der besonders die völlig unschuldigen Opfer Doktor Sills im Daumenfelsen schwer treffen könnte. — Ich stelle den Antrag, daß der beschlagnahmte Dampfer ›Don Antonio‹ zu diesem Zweck freigegeben und mit ausgewählter Mannschaft besetzt wird. Ich selbst und Fräulein Verweer, die am besten die Erkennungszeichen kennt, schließen uns dieser Expedition an. Einverstanden, Gisa?«
»Selbstverständlich!« sagte Gisa. Sie hatte sofort erkannt, daß dieses der einzige Weg war, Sill zu überlisten. Die Gefahr scheute sie nicht.
»Ich stelle ferner den Antrag«, fuhr Damm fort, »daß ein Zerstörer der ›Don Antonio‹ folgt, für den Fall, daß es zu Komplikationen kommt. Diese Möglichkeit ist immerhin nicht ausgeschlossen. Dann allerdings wären alle friedlichen Mittel erschöpft, und dem Zerstörer fiel die kriegsmäßige Aufgabe zu, die Festung niederzukämpfen!«
Unter bedrückendem Schweigen nahm Doktor Damm wieder Platz. In den Augen Oliver Astons sah er deutlich eine stille Genugtuung aufblitzen. Dann erhob sich dieser.
»Bestehen nach den aufschlußreichen Darlegungen, besonders Doktor Damms, noch irgendwelche Zweifel an der Existenz dieses Doktor Sill, seines Werkes und seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten, die wir ja alle zu verspüren bekommen haben?«
————
»Ich stelle fest, daß kein Einspruch erfolgt. ——Den Vorschlag Doktor Damms begrüße ich aufrichtig und halte ihn für den einzig möglichen. Sill wird alles daransetzen, zu entkommen, dürfte er sich doch darüber im klaren sein, daß sein Betrugsmanöver gegenüber Doktor Damm über kurz oder lang aufgeklärt wird. ——Erachtet einer der Anwesenden den Verbleib von Miß Verweer und Doktor Damm noch für erforderlich? Ich schätze, die weiteren Beratungen sind ausschließlich unsere Sache!«
»Da kein Einspruch erfolgt, spreche ich Miß Verweer und insbesondere Doktor Damm unseren Dank und unsere Anerkennung aus. Sie werden spätestens morgen früh unsere endgültigen Beschlüsse erfahren! ——Ich unterbreche die Sitzung zur Verabschiedung unserer Gäste!«
An diesem Abend saßen Gisela Verweer und Doktor Damm noch lange zusammen und erörterten alle Möglichkeiten, die dem geplanten Unternehmen zum Erfolg verhelfen konnten.
Der Dampfer ›Don Antonio‹ durchschnitt mit großer Fahrt die blaue Fläche des Indischen Ozeans. Am Vorabend hatte ein Flugzeug das Paar, die amerikanischen Sonderbeauftragten sowie mehrere ausgesuchte Kräfte der Polizei nach Durban gebracht. Wegen Raummangels hatten die Amerikaner den Zerstörer bestiegen. Mit etwa sieben Tagen mußte bis zum Erreichen des Zieles gerechnet werden, lief die ›Don Antonio‹ doch höchstens fünfzehn Meilen die Stunde. Der Zerstörer mit seiner hohen Geschwindigkeit sollte später folgen. Funkverständigung im Geheimkode war verabredet.
Seit seinem Eintreffen an Bord hatte Martin Damm sich nur der Suche des bisher nicht aufgefundenen Chiffrierbuches hingegeben. Zwar kannte Gisa die Zahlen und Buchstaben, mit denen sich der Zubringerdampfer in der Nähe der Daumeninsel meldete. Doch Martin Damm wollte sicherer gehen, jeden unliebsamen Zwischenfall im voraus ausschließen. Im Verlauf ergebnisloser Bemühung kam er auf den Gedanken, den Tisch in der Kapitänskajüte einer gründlichen Prüfung zu unterziehen, hatten sich doch damals an gleicher Stelle in dem Motorboot die Seekarten befunden.
Sein Hantieren war nach längeren Versuchen von Erfolg gekrönt. Beim Abtasten der Beine des sonst am Boden verschraubten Tisches ergab sich, daß eines geringfügig drehbar war, daß ein leichter Ruck den Mechanismus betätigte. Eine schmale Schublade sprang hervor. Sie barg das kostbare Dokument.
Draußen auf freier See ging der verschlüsselte Funkspruch in den Äther.
»Hafen Durban beim Kohlenbunkern leichte Havarie gemacht. Eintreffe fünfte Abendstunde.«
Die nächste halbe Stunde war eine der aufregendsten, die der Polizeifunker, die Muscheln des Kopfhörers fest an die Ohren gepreßt, an Bord der ›Don Antonio‹ durchmachte. Er schrieb, schrieb und gab das ihm anbefohlene Empfangszeichen zurück.
Mit langen Sätzen hastete er in die Kapitänskabine, den Zettel in der Hand schwenkend. Er fieberte, nun auch den Inhalt der unverständlichen Meldung zu erfahren.
Gisa nahm die Entschlüsselung vor. Es währte eine Weile.
——Endlich las sie:
»Befehle äußerste Fahrt. Größte Gefahr im Verzuge. Achtet auf Flugzeuge. Selbst bei Tage unverzüglich anlegen.« »Das hat geklappt!« sagte Damm, hörbar aufatmend. »Jetzt sitzt der Fuchs in der Falle!« fügte sie hinzu, und aus ihren Augen glomm unversöhnlicher Haß.
»Morgen in der Frühdämmerung ist es soweit. Ich komme gerade von Kapitän Brooks!«
Martin Damm ließ sich auf dem kissenbelegten Liegestuhl neben Gisela Verweer nieder. Einer alten Gewohnheit folgend, zupfte er die Bügelfalten seiner hellgrauen Hose zurecht, bevor er die Beine lang ausstreckte.
Die Stühle standen dicht nebeneinander auf dem Oberdeck, das ein schattenspendendes Sonnensegel straff überspannte. Eine leichte Brise verschaffte angenehme Erfrischung. Er trug ein Tropenhemd, das von den Ellbogen abwärts die Arme freiließ.
»Und das Telegramm?« fragte sie, ohne die Augen zu öffnen.
»Wir sind zu folgendem Text gekommen«, begann ihr Nachbar, es sich ebenfalls bequem machend. »Amerikanischer Kreuzer ›Ohio‹ an Funksignalen ausgemacht. Vorhaben nur von Stunden Vorsprung abhängig. Schnellste Einbootung dringend erforderlich. Erwarte Sie alle Hafenmole fünften Frühdämmerung zur Übernahme in Barkasse.« Damm steckte den Zettel, von dem er den Text abgelesen hatte, wieder in die Brusttasche seines Hemdes.
»Ist eigentlich doch eine glatte Gemeinheit von uns!« sagte Gisela Verweer nach einer Weile.
»Die einzige Möglichkeit, Sills und seiner Azteken mit einem Zugriff habhaft zu werden. Ehe sie sich von dem Schreck in der Morgenstunde erholt haben, sind sie von Maschinenpistolen und den Waffen unseres Schiffes auf der schmalen Mole jeden Rückzuges beraubt.«
»Ein schmähliches Ende!« antwortete verbittert Gisela.
»Ich verstehe dich nicht, Liebste!«
»O Gott, Martin! — Wenn Sill auch tausendmal List und Betrug zur Anwendung brachte, nur um seines Machtwahnes willen, so ekelt es mich dennoch an. ——Ach! Lassen wir das. ——Das einzige, was mich mit dem Plan versöhnt, ist die Vorstellung, daß meinen Siedlern dadurch kein Unheil widerfahren kann!
Komm, Liebster! Sprich nicht mehr davon. Schau, ist diese wundervolle Morgenstimmung es wert, daß wir Menschen sie beschmutzen?«
Sie strich zart und innig über den nackten Arm ihres Liebsten.
Er schwieg und begriff langsam, daß Gisela niemals einen lebenden Sill wiederzusehen wünschte.
Pschui, pscheu, pschui, spie die Lenzpumpe ihr Wasser in den Ozean.
Im Kesselraum rumorte von Zeit zu Zeit das Zuschlagen der Feuerungstüren, das Kratzen der Schlackenhaken, das metallisch klirrende Schürfen der Schaufeln, wenn die Heizer Kohlen beiwarfen.
Unten auf dem Vorderdeck verflogen ein paar englische Worte, dösig, schläfrig verwehend. Die Begleitmannschaft erholte sich gleich ihnen von der schlafzermürbenden Hitze der tropischen Nacht.
Die Bugwelle rauschte einschläfernd.
Nur die immerwährende Lenzpumpe stieß ihren armdicken Strahl unentwegt in das Meer.
Pschui, pscheu, pschui.
Und irgendwo da achtern bullerten die Schrauben.
Mit offenen Augen lag Martin Damm. Seit Wochen unerträglicher Hast begannen sachte und tastend die Gedanken das neue Leben zu errichten und vorzuordnen: Arbeit und Leben zu zweien! Die Tapferkeit dieser Frau bot die Gewähr, daß er dort wieder anknüpfen konnte, wo die Notlandung alles Ringen um Einkommen und Erfolg zunichte gemacht hatte.
Da meldete sich die Stimme Gisas.
»Martin!«
»Ja, Gisa!«
»Störe ich dich?«
»Nein, keineswegs!« Er wandte ihr den Kopf zu.
»Hast du eigentlich heute nacht, es muß gegen zwei Uhr in der Frühe gewesen sein, das ununterbrochene Zittern unseres Schiffes verspürt?«
»Nein! Da habe ich geschlafen. Aber Kapitän Brooks teilte mir mit, daß in dieser Nacht nicht fern von uns ein heftiges Seegewitter niedergegangen sein müsse, in dessen Ausläufer wir, gegen sechs, glaube ich, sagte er, gerieten. Das Meer soll einige Zeit recht kabbelig gewesen sein. So was käme in diesen Breiten öfter vor, meinte er.« »Was ist kabbelig?« fragte sie.
»Nun!«——. Er suchte nach der passenden Erklärung.
»Wenn die Oberfläche des Meeres ohne sichtbaren Einfluß Wellenbildung aufweist, die sich meist verquer überschneidet. Durcheinanderquirlen wäre schon zuviel gesagt!« »Sozusagen die Wellen außer Takt geraten sind?«
»Aber Gisa! ——Wer sagt als Physikerin so etwas!«
»Also gut!« entgegnete sie, doch es deuchte Martin Damm, als ob geheime Qual sie erschüttere.
»Hallo, Doktor! ——Telegramm für Sie! ——Soeben entschlüsselt!« Der Funker stand neben ihm, seine Annäherung war von beiden nicht bemerkt worden.
»Danke Ihnen!«
Er erbrach das Formular und reichte es, ohne ein Wort zu sagen, Gisa. Sie las:
»Inhalt Kassette und Eigentum Motorboot Miß Verweer und Ihnen als Schadenersatz zugesprochen. Herzlichst Oliver Aston!«
Sie ballte das Papier zusammen und warf das Knäuel über Bord.
———
»Du hast dich doch so darauf gefreut? ——«
»Ich denke nur noch an die armen Siedler!« »Du weißt, daß für sie durch die amerikanischen Renten, die Sill laut Vertrag zustehen, gesorgt ist! ——Nach Abbau des Werkes auf der Daumeninsel sollen sie in USA. ein ähnliches Tätigkeitsfeld erhalten!«
»Ich glaube an nichts mehr!«
»Aber Gisa!«
»Nichts werden sie erben!«
»Gisa! Ich habe meine Hand zu dem Unternehmen geboten, weil ich als Geologe die Verantwortung nicht übernehmen konnte, Menschen einer furchtbaren, jederzeit drohenden Gefahr auszusetzen!«
Sie lehnte den Kopf an seine Schulter.
»Ich weiß, Martin! Wenn deine Voraussetzungen zutreffen ———.«
»Muß über kurz oder lang der Fels von Ost nach West umstürzen und auf immer versinken!«
»Ja!« hauchte sie und schmiegte sich zitternd an ihn. »Wenn es nicht schon zu spät ist!«
Diese Nacht vermochte Martin Damm infolge der drückenden Hitze, vielleicht mehr noch dessentwegen, was ihm in den nächsten Stunden bevorstand, keinen Schlaf zu finden. Da meldete sich Kapitän Brooks an seiner Kabinentüre.
Im Schlafanzug sprang er aus der schmalen Koje und machte Licht.
»Herein, bitte!«
»Doktor!« entfuhr es dem Graubärtigen. »Von der Daumeninsel werden keine Funksignale mehr beantwortet!«
Damm war hellwach.
»Ich komme zu Ihnen auf die Kommandobrücke. — In wenigen Minuten bin ich oben!«
»Danke Ihnen!«
Bald darauf verglich Doktor Martin Damm gewissenhaft den verschlüsselten Text mit dem Codeheft.
Kein Fehler!
»Lassen Sie bitte neunundneunzig Strich achtundachtzig senden!« Gisela hatte ihm diese Zahlen genannt. »Auf der richtigen Wellenlänge!« rief er dem Davoneilenden nach.
Die Unruhe zwang ihn, selbst die Funkkabine aufzusuchen.
Zu dritt umstanden sie den Sender.
Die Frequenz entsprach haargenau den Anforderungen. Dessen vergewisserte sich Damm.
»Los!« forderte er den Funker auf.
Dieser nahm vor dem Tisch Platz.
Seine Rechte hämmerte auf die Morsetaste.
————
»Noch einmal!«
————
»Ist Ihr Empfangsgerät in Ordnung?« fragte Damm verzweifelnd.
Der Funker drehte den Kopf nur ein wenig nach rechts, dann nach links.
Vielfaches Zwitschern erscholl aus dem Lautsprecher.
»Bitte zurück auf die Originalwelle!« kam wieder Martin Damms Stimme.
————
Brodeln! ——Keine Antwort.
»Noch einmal! ——Neunundneunzig ——Strich achtundachtzig!«
————
Die Funkstation der Daumeninsel gab keine Empfangsbestätigung.
Die Stunden bis zum Morgengrauen verbrachte Damm mit dem Kapitän in dessen Kabine.
Als die Dämmerung genügend Sicht bot, traten sie auf die Kommandobrücke.
Von dem hochragenden Felsen der Insel, diesem untrüglichen Wahrzeichen, bot sich trotz der klaren Luft kein Anblick.
Schweigend starrten die beiden Männer voraus.
»Sind Sie Ihrer Positionsbestimmungen unbedingt sicher?«
»Doktor, ich fahre seit nahezu vierzig Jahren zur See, davon die letzten fünfzehn als Kapitän!« lautete die bestimmt vorgebrachte Entgegnung.
»Jeder Irrtum ausgeschlossen?« beharrte Damm.
Als einzige Antwort trat der Kapitän an die Reling und spuckte den Rest seines Priems über Bord.
Der Glutball der Sonne hob sich als schmaler Bogen im Osten aus dem Meer.
Mit übernächtigtem Gesicht erschien der Funker.
Er zuckte nur mit den Schultern.
»Lassen Sie sich erst einmal in der Kombüse einen starken Kaffee kochen!« mahnte ihn Brooks.
Als die Sonne gerade mit ihrem unteren Rande dem Ozean zu entgleiten drohte, visierte Kapitän Brooks das schon fast weißglühende Gestirn mit dem Sextanten an, las das Chronometer ab und begab sich zu dem ersten Offizier, der selbst das Steuerruder bediente.
Sie rechneten geraume Weile gemeinsam vor den aufgeschlagenen Tabellen.
Brooks kehrte zurück.
»Das Verfahren ist zwar ungenau. — Aber! — Selbst die Unsicherheitskoeffizienten einkalkuliert, sind wir allerhöchstens fünf Seemeilen von unserem Ziel entfernt.« Seine Hand fuhr zum Maschinentelegraf, legte den Zeiger auf ›Stop‹.
Martin Damm beobachtete, unfähig eigener Entschlußkraft, das Hebelwenden.
Rimm——Rimm, schlug die Glocke an.
Die Schrauben stellten ihr Mahlen ein.
Die langlaufende See ließ das seiner Antriebskraft beraubte Schiff bald in der Dünung dümpeln.
Hü——ho, ächzte der vordere Ladebaum knarrend, pendelte in dem kleinen Spielraum, den die nicht ganz straff gezogenen Stahltrossen boten.
Weit blaute der Ozean. Zur Sonne hin zitterte ein breiter Streifen grellen Widerscheins, der die Augen blendete.
Brooks betrachtete die Seekarte, die Damm an Bord des Motorbootes gefunden hatte.
Der Funker turnte die schmalen Stahlstufen zur Kommandobrücke empor.
»Rufen Sie den Zerstörer an! ——Er kann nicht weit sein. — Melden Sie!« ——Kapitän Brooks kramte in seiner Brusttasche nach einer Zigarre, zog einen zerbrochenen Stumpen hervor, beleckte rasch die Bruchstellen und setzte den braunen Stengel in Brand. »Melden Sie!« entfuhr es den Lippen mit der ersten Wolke ausgestoßenen Rauches.
»Bitte, Captain!«
Der Funker hielt seinen Bleistift schreibbereit über den Notizblock.
»Melden Sie!« murmelte Brooks zum drittenmal, als ob er noch Sammlung benötige, den Text zu diktieren. Dann raunzte er, die Gemütsbewegung zu verbergen:
»Daumeninsel an angegebener Position nicht aufgefunden. Erbitte weitere Weisung. ——Brooks!«
Als die Mittagsstunde vorüber, das neue Besteck, wie der Seemann die Ortung im Kulminationspunkt der Sonne nennt, aufgenommen war, dümpelte die ›Don Antonio‹ träge über jener Stelle, an der sich einst die Daumeninsel befunden haben sollte.
Kabel und Leitungen waren gelegt, um die von Martin Damm in einem der Koffer mitgeführte elektrische Peilsonde aus der Funkerkabine mit der erforderlichen Energie zu versorgen.
Die in vielen Stunden unentwegten Kreuzens gewonnenen Lotungsergebnisse ließen keinen Zweifel mehr übrig, daß die Naturgewalten ein grausiges Werk vollbracht hatten.
Sechshundert Meter unter dem Meeresspiegel wies das Meßbild der Braunschen Röhre auf noch nicht mit Sedimentschichten überlagertes Gestein.
Am Horizont kündete eine dunkle Rauchfahne das Nahen des Zerstörers.
An Bord der ›Don Antonio‹ herrschte jene Behutsamkeit der Bewegungen, die in der Nähe eines Grabes menschliche Anteilnahme heischt.
Gisela Verweer hatte bis zur letzten Messung, die die untrügliche Gewißheit bot, an der Seite Martin Damms ausgehalten und wie ehedem Zahlen um Zahlen in ein Heft eingetragen. Dann suchte sie stumm ihre Kabine auf.
Gegen ein Uhr nachmittags lag der Zerstörer längsseits der ›Don Antonio‹.
Martin Damm und Gisela stiegen als einzige über. Ihr Gepäck wurde nachgereicht.
Die ›Don Antonio‹ nahm nach kurzem Befehlsempfang Kurs auf Durban auf.
In der geräumigen Offiziersmesse empfing sie schweigend der Kommandant. Hinter ihm standen die Bevollmächtigten der amerikanischen Regierung.
Es bedurfte nicht vieler Worte, um über den erschütternden Tatbestand ins reine zu kommen. Dem Zerstörer war im Verlauf des Vortages von der Marine-Wetterstation mitgeteilt worden, daß mehrere Erdbebenwarten ein leichtes Seebeben, dessen Herd im südlichen Indischen Ozean zu suchen sei, registriert hatten. Die Peilergebnisse Doktor Damms zeigten den Eingeweihten, daß die schlimmsten Befürchtungen des erfahrenen Geologen durch die eingetretene Katastrophe bereits überholt waren.
Sills Werk bestand nicht mehr.
Die Dienstanweisung forderte schriftliche Niederlegung des Befundes, sowie der Lotungsergebnisse Doktor Damms.
›So hast du, Gisa, als einzige die Tragödie geahnt und miterlebt! ——Jetzt erst verstehe ich deine Fragen von gestern früh!‹ sann Martin Damm.
Die Schreibmaschinen klapperten eilfertig, die diktierten Sätze zu Papier zu bringen.
Jeder vernahm den Inhalt des ausführlichen Protokolls.
Martin Damm sann, sann.
Das also war das Ende!
Ein Schauder überlief ihn.
»Doktor Damm! Darf ich Sie bitten, zu unterzeichnen!«
»Miß Verweer, darf ich bitten!«
Die Feder raschelte zweimal über den auf dem Tisch ausgebreiteten Bogen.
»Darf ich die Herren der Delegation der Vereinigten Staaten um Gegenzeichnung bitten!«
Als letzter unterschrieb der Kommandant das Aktenstück.
»Ich erachte es für meine Pflicht, den tausend unschuldigen Opfern der Katastrophe die letzte Ehre zu erweisen!«
Befehle erschollen an die Offiziere.
Langsam leerte sich die Messe.
Man nahm mittschiffs Aufstellung.
Die Heckflagge des Zerstörers ging auf Halbmast.
Gisela stand neben Martin Damm.
Das Kriegsschiff nahm Fahrt auf, zog einen Bogen um jene Stelle, an der der Daumenfelsen weit sichtbar emporgeragt hatte.
»Salve!« ——Ein gedämpftes Kommando.
Die Offiziere legten die Finger an den Mützenrand.
»Feuer!«
Dumpf krachten die Abschüsse des Trauersalutes.
Echos fluteten hallend zurück.
Gisela Verweer griff an die Brust, löste die letzten beiden Rosen aus der Spange, zerzupfte die Blüten und ließ die süßduftenden dunkelroten Blätter Stück um Stück in das Meer flattern, klammerte beide Hände um die Stiele, bevor sie auch diese niedersinken ließ.
»Martin!« Sie suchte seinen Arm. »Zu spät, Martin!« Schluchzen zerbrach ihre Beherrschung.
»Still, Liebste! ——— Ihr Sterben war kurz. ——— Sie litten nicht!« Seine Hand ballte sich zur Faust.
»In Tyrannos! —« Schlaff sank die Hand auf die Reling. »Soll denn des Menschen Schicksal ewig das gleiche bleiben, um des Machtwahns eines einzelnen willen das Leben zu verlieren?« Nur sie verstand seine Worte.
Über Doktor Sills von den Fluten verschlungenem Werk rasten jetzt mit voller Kraft die Schrauben des Zerstörers dem fernen Hafen zu.
Ein frischer Westwind kündete nahen Sturm.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.