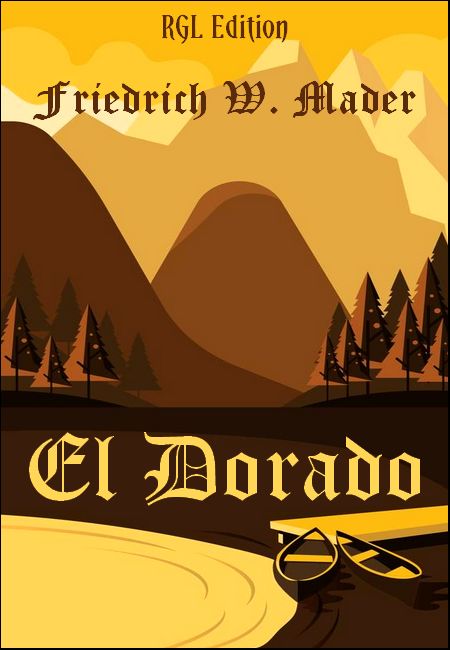
RGL e-Book Cover©
Based on a vintge travel poster
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
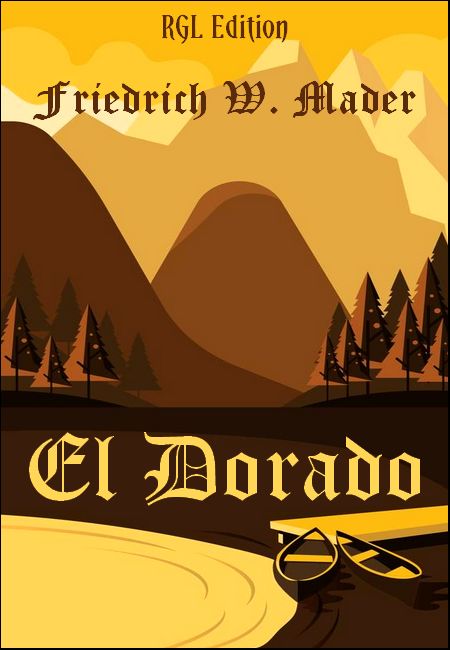
RGL e-Book Cover©
Based on a vintge travel poster


"El Dorado," Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1919

"El Dorado," Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1919
El Dorado ist so überaus freundlich, sowohl von der Kritik als von den Lesern, jungen und alten, aufgenommen worden, daß die nun in schönerer Ausstattung erscheinende zweite Auflage getrost hinausziehen darf. Besonders freute es mich, daß die Sachverständigen, die deutschen Forscher, die Südamerika bereisten und zum Teil noch unerforschte Gebiete unserer Kenntnis erschlossen, der Erzählung so liebenswürdige Beurteilung zuteil werden ließen. Wissenschaftliche Irrtümer wurden ihr nicht nachgewiesen; ich beschränkte mich daher im wesentlichen auf sprachliche Verbesserungen.
Stuttgart.
Fr. Wilh. Mader.
1. Kommerzienrat Friedung.
2. Seine Frau.
3. Ulrich, 17 Jahre alt, sein Sohn.
4. Friedrich, 16 Jahre alt, sein Sohn.
5. Professor Lemaitre aus Paris.
6. Rudolf Lehmann, Pflanzer in Puerto Cabello.
7. Inez, 6 Jahre alt, sein Töchterlein.
8. Don José de Alvarez, Mestize.
9. Diego, Mestize.
10. Lopez, Mestize.
11. Manuel, Lehmanns Diener.
12. Ein Rebellengeneral.
13. Ein General der Regierungstruppen.
14. Padre Martinez, Kapuzinermönch, Vorsteher der Mission Santa Elena.
15. Don Guancho Rodriguez, General außer Dienst in Calabozo.
16. Professor Heinrich Schulze aus Berlin.
17. Luciano, genannt Unkas, Indianer, Schulzes Diener.
18. Celestino, genannt Matatoa, Indianer, Schulzes Diener.
19. Ein alter Indianer, Führer, in San Luis de Encaramada.
20. Meriyoko (Sonnenauge), ein Guahibohäuptling.
21. Otomak, Oberhäuptling der Guahiboindianer.
22. Felipe, ein Indianer, Führer in San Joaquim de Omagua.
23. Yutaténeru (das Jungfräuliche Reh), Amazonenkönigin.
24. Tompatpo (Blitzhand), Häuptling der Napoindianer.
25. Narakatangetu (der Rote Papagei), Oberhäuptling der Napo.
26. Moiatu (die Große Schlange) = Diego, als Indianer verkleidet.
27. Ein indianischer Wächter.
28. Tetuyöt (die Kleine Eidechse), Indianermädchen.
29. Tupak-Amaru, Inkakaiser (El Dorado).
30. Manko, alter Inkakaiser, sein Vater.
31. Karl Weber, Pflanzer am Flatheadsee.
32. Martha, geborene von Seldau, seine Frau.
33. Ernst Weber, sein Bruder.
34. Johanne, Ernsts Frau.
35. Major von Seldau, Marthas Vater.
36. Karl Weber, 4 Jahre alt, Ernsts Kind.
37. Johanna Weber, 6 Jahre alt, Ernsts Kind.
38. Ernst Weber, 4 Jahre alt, Karls Kind.
39. Martha Weber, 2 Jahre alt, Karls Kind.
Kapitän, Bootsmannsmaat und Offiziere der Balesia und Vineta.
Venezolanischer Pöbel in Puerto-Cabello.
Generale, Offiziere und Truppen der Rebellen und der Regierung.
Guahiboindianer. Amazonen. Napoindianer. Omagua und Riesen in Manoa.
Salvado, ein Brüllaffe. Dogaressa und Bambino, zwei Äffchen.

"El Dorado," Frontispiece

IN der Nähe einer reizend gelegenen größeren Stadt des Schwabenlandes befindet sich auf halber Höhe eines Hügels ein prächtiges Landhaus inmitten eines parkähnlichen, terrassenförmig angelegten Gartens.
In einem der geräumigen Zimmer des schloßartigen Baues saßen an einem trüben und nebligen Novemberabend drei Personen um einen Tisch, der durch eine große Hängelampe hell erleuchtet war: ein stattlicher Mann von etwa vierzig Jahren und zwei Knaben, die etwa sechzehn und siebzehn Jahre zählten. Es herrschte Stille in dem Raume, der geschmackvoll und behaglich, aber keineswegs üppig eingerichtet war. Der ältere Herr, dessen energisches und doch freundlich mildes Antlitz von einem üppigen braunen Vollbart umrahmt war, las in einem in portugiesischer Sprache geschriebenen, reich illustrierten Prachtwerk über Brasilien. Seine Söhne waren offenbar mit der Erledigung ihrer Schularbeiten beschäftigt. Der größere zeigte die edle Gesichtsbildung des Vaters; alle seine Bewegungen verrieten ein äußerst lebhaftes Wesen, und wenn er schrieb, flog die Feder nur so über das Papier hin, während sie doch feste, markige Schriftzüge hervorbrachte. Dagegen schien ihm die Arbeit Schwierigkeiten zu machen: nur kurze Zeit hielt das rasche Schreiben an, dann folgte jedesmal wieder eine längere Pause, in der der Jüngling teils angestrengt nachzudenken, teils gar nicht mehr bei der Sache zu sein schien. Dann ließ er die Blicke umherschweifen, trommelte ungeduldig mit den Fingern auf dem Tische herum, sprang auch wohl auf und blickte hinaus in die nebelverschleierte Landschaft, aus der Hunderte von Lichtern verschwommen heraufglänzten.
»Ulrich!« rief der Vater, als sein Ältester wieder einmal in die Nacht hinausblickte, »so bleibe doch bei der Arbeit! Man muß immer ganz bei seiner Sache sein; dann wird sie rasch gefördert und hat alle Aussicht auf gutes Gelingen.«
»Ach! Papa, das langweilige Aufsatzschreiben ist eben gar nicht mein Fall.«
»Aber es ist nun deine augenblickliche Pflicht,« erwiderte der Vater. »Was sein muß, muß sein! Dein unstetes Wesen macht dir die Arbeit nur langweiliger und zieht sie in die Länge: je gesammelter du schaffst, um so rascher wirst du dich deinen andern, angenehmeren Beschäftigungen zuwenden können.«
»Ich weiß aber gar nicht, wo ich die Gedanken herbringen soll!«
»Jedenfalls aus deinem Kopf und nicht etwa von draußen,« meinte der Vater lächelnd.
Ulrich setzte sich wieder, besann sich noch eine Weile und brachte dann den Aufsatz rasch zum Schluß.
Sein jüngerer Bruder Friedrich hatte unterdessen emsig gearbeitet. Er schien ganz anders geartet und glich auch äußerlich wenig dem kräftig gebauten Ulrich; er hatte etwas viel Weicheres und dabei ungemein Liebliches in seinem Gesicht: das war so ein blonder Raffaelkopf, von krausen Locken umwallt, den man nicht anschauen kann, ohne ihn zu lieben. Und wenn einen vollends die hellen, klugen und etwas träumerischen Augen ansahen, da mußte ihr kindlich liebenswürdiger Blick die Herzen gefangennehmen. Friedrich schaute aber nicht auf, ehe er nicht seine Übersetzung vollendet hatte. Diese machte ihm offenbar nicht die geringsten Schwierigkeiten, und nur selten schlug er einmal sein dickes Wörterbuch auf; meist schrieb er die griechischen Sätze in bestem Deutsch nieder, so gewandt, als handle es sich gar nicht um eine Übertragung aus einer fremden, toten Sprache, sondern um eine bloße Abschrift.
»Papa!« sagte Friedrich, als er mit der Arbeit zu Ende war, »die Sage erzählt vom König Midas, daß er alles, was er berührte, in Gold verwandelte: hängt diese Sage am Ende mit der Sage vom Steine der Weisen zusammen?«
»Eine Ähnlichkeit besteht wohl,« meinte der Vater bedächtig, »sollte doch der Stein der Weisen auch unedle Metalle in Gold verwandeln können. Aber der Stein der Weisen ist eigentlich nicht der Gegenstand einer Sage, sondern der Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen gewesen.«
Ulrich lächelte: »Aber, Papa! Die Forschungen der Alchimisten, diese abergläubischen und törichten Verirrungen, wirst du doch nicht ›wissenschaftlich‹ nennen?!«
»Gewiß, mein Sohn! Die Alchimisten haben wohl mannigfache Versuche angestellt, aber sie arbeiteten nicht ins Blaue hinein; sie besaßen oft geradezu großartige Kenntnisse und studierten Werke, deren geheimnisvollen Stil die Gelehrten von heute gar nicht mehr verstehen.«
»Aber das war doch lauter Blödsinn!« meinte Ulrich.
»Oho! Wer weiß, ob ein fortgeschritteneres Geschlecht in hundert Jahren vielleicht nicht ebenso abfällig über das urteilt, was wir jetzt als die ernsteste Wissenschaftlichkeit verehren? Vergiß nicht, daß wir die ganze Chemie in erster Linie den Alchimisten des Mittelalters und der Neuzeit zu verdanken haben.«
»Jawohl! Aber das ist doch mehr Zufall: das lag gar nicht in ihrem Streben; sie suchten unmögliche Dinge und machten dabei ungesucht wertvolle Entdeckungen.«
»Was ist unmöglich?« fragte der Vater ernst. »Unmöglich nennen wir das, was nach dem heutigen Stande unserer Erfahrungen noch nicht erwiesenermaßen vorgekommen ist und mit unserer gegenwärtigen Kenntnis der Naturgesetze unvereinbar erscheint. Aber denke stets daran, daß wir die Naturgesetze eben nur aus ihren beobachteten Wirkungen heraus erkennen können: wir erkennen also nie das Naturgesetz selbst, sondern nur seine Äußerungen. Darum muß auch die Wissenschaft jederzeit gewärtig sein, daß neue Beobachtungen ihre bisherigen Anschauungen über ein Naturgesetz völlig umwälzen können. Man hält die Naturgesetze für ewig und unabänderlich, ohne es freilich beweisen zu können; jedenfalls aber wechselt die menschliche Erkenntnis der Naturgesetze. Daher werden auch immer wieder neue Naturgesetze, das heißt solche, die uns bisher unbekannt waren, entdeckt, und ebenso ist es auch möglich, daß bisher für feststehend angesehene Gesetze als unhaltbar aufgegeben werden müssen: in der Wissenschaft ist fast alles Hypothese, das heißt Vermutung, und wenig unumstößliche Gewißheit.«
»So glaubst du, daß wirklich der Stein der Weisen gefunden werden könnte?« forschte Friedrich mit leuchtenden Augen.
»Für unmöglich halte ich es nicht.«
»Aber daran glaubt doch heutzutage niemand mehr!« fiel Ulrich ungläubig ein.
»Das hat gar nichts zu bedeuten!« entgegnete der Vater. »Man schüttet gar zu oft das Kind mit dem Bade aus: wie lange Zeit wurden die Pygmäen ins Reich der Fabel verwiesen, bis man solche Zwergvölker jetzt in Mittelafrika entdeckte, wo sie auf den ältesten Weltkarten verzeichnet sind; wie hat man über Herodots Leichtgläubigkeit und Marko Polos Aufschneidereien gespottet, bis Hieroglyphen und Keilinschriften, sowie neuere Entdeckungen den fabelhaften Berichten des einen und des andern recht gaben. Der Vogel Roch ist bereits kein phantastisches Märchengebilde mehr: man weiß jetzt, daß solche Riesenvögel bis vor kurzem noch auf Madagaskar hausten, ja es ist sogar möglich, daß sie heute noch nicht ganz ausgestorben sind, wenn man den Madagassen Glauben schenken darf, — und warum sollten sie schwindeln? Aber der Mensch hat die Sucht, allem ein ungläubiges Lächeln entgegenzusetzen, was irgend über seine bisherigen Wissensgrenzen geht; die große Masse der Halbgebildeten glaubt zu sehr an das Erschöpfende ihres Wissens.«
»Und nicht wahr,« fiel Friedrich ein, »Lindwürmer und Drachen hat es auch gegeben?«
»In der Tat treten die Berichte über das Vorkommen solch schrecklicher Ungeheuer noch bis in das Mittelalter hinein so zahlreich und so bestimmt auf, daß es sehr unwissenschaftlich wäre, sie einfach damit abzutun, daß man sie für Übertreibungen oder gar Ausgeburten der Phantasie erklärte. Warum sollten nicht vereinzelte Saurier, Pterodaktylen und dergleichen Ungetüme sich bis in geschichtliche Zeiten hinein erhalten haben? Oder gar Brontosaurier, deren Knochenüberreste so fabelhaft groß sind, daß anfangs kein europäischer Gelehrter den amerikanischen Berichten über solche Funde Glauben schenkte. Jedenfalls läßt sich nicht beweisen, daß solche Drachen nicht in einzelnen Exemplaren noch zu unserer Vorväter Zeiten lebten.«
»Das alles hat aber doch nichts mit dem Stein der Weisen zu tun!« warf Ulrich hartnäckig ein.
»Nein,« meinte der Vater, »die Alchimisten hegten die Überzeugung, ein Pulver finden zu können, das unedle Metalle in Silber und Gold zu verwandeln vermöge. Später erklärte die Wissenschaft und die aufgeklärte Welt der Gebildeten diesen Gedanken für eine Utopie, das heißt für ein Hirngespinst; heutzutage aber sind wir so weit vorgeschritten, daß wir wieder an die Möglichkeit einer solchen Verwandlung glauben dürfen. Bisher hielt man nämlich die Edelmetalle für Elemente, was so viel bedeutet, wie einfache, nicht zusammengesetzte und daher auch nicht zerlegbare Stoffe. Nun beginnt man zu erkennen, daß diese ›Elemente‹ eben doch auch aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt sind, so daß man durch Vereinigung ihrer Bestandteile unter den richtigen Bedingungen diese Elemente ebensogut künstlich darstellen könnte, wie man durch Verbindung von Kupfer und Zinn Bronze darstellt. Es ist immer kindisch, im vornherein etwas für unmöglich zu erklären: wer hätte vor hundert Jahren nicht gespottet, wenn man ihm von Telegraphen, Phonographen, Röntgenstrahlen und dergleichen vorphantasiert hätte? Man hätte das unbedingt in das Reich der Unmöglichkeit verwiesen. Napoleon I. wollte den Erfinder des Dampfschiffs in eine Irrenanstalt gesperrt wissen, so unsinnig erschienen ihm seine Pläne. Gelehrte Männer erklärten noch vor nicht langer Zeit, eine Setzmaschine erfinden zu wollen, sei eine verrückte Idee, denn der menschliche Geist lasse sich durch keinen Mechanismus ersetzen; das Flugproblem und das lenkbare Luftschiff waren bis vor kurzem noch Wahngebilde, an deren Möglichkeit fast niemand glauben wollte; jetzt sieht es damit schon ganz anders aus. Macht man nicht auch aussichtvolle Versuche, echte Diamanten auf künstlichem Wege herzustellen? Warum sollte man nicht dasselbe für die edlen Metalle erreichen? Ja, der durchaus glaubwürdige niederländische Gelehrte J. B. van Helmont erklärte schon im 17. Jahrhundert von Unbekannten eine geringe Menge des Steines der Weisen erhalten zu haben, mit dem er aus Quecksilber reines Gold dargestellt habe; es ist also nicht einmal unmöglich, daß einzelne Leute schon früher im Besitz des sorgfältig gehüteten Geheimnisses waren.«
»Mich nimmt es nur wunder,« sagte Friedrich nachdenklich, »daß unsere so weit fortgeschrittene Chemie die künstliche Herstellung der Metalle noch nicht zuwege bringt.«
»Es hat dies eben seine besonderen Schwierigkeiten,« erklärte der Vater. »Erstens kennt man die Zusammensetzung der sogenannten ›Elemente‹ noch nicht; sodann, wenn einem auch alle einzelnen Bestandteile einer Materie bekannt sind, so läßt sich aus ihnen doch nicht der betreffende Stoff zusammensetzen, wenn man nicht genau die Kräfte und die Umstände, kurzum die Bedingungen kennt, unter denen die fraglichen Bestandteile vereinigt werden müssen. Gerade diese Nebenumstände spielen oft die entscheidende Rolle, wie die Darstellungsversuche von Diamanten lehren. Auch davon scheinen die Alchimisten eine Ahnung gehabt zu haben; denn es ging unter ihnen die Kunde, die gesuchte Verwandlung bringe eine bedeutende Gewichtsvermehrung mit sich, so daß das gewonnene Gold viel mehr wiege, als die gemischten Bestandteile. Das würde darauf hinweisen, daß die Mischung unter Umständen erfolgen würde, bei denen ein unsichtbarer, vielleicht gasiger Stoff ganz von selber in die Mischung eindränge. Doch, gottlob! wir suchen den Stein der Weisen nicht und würden seiner Entdeckung auch keinen großen Wert beilegen. Ein ewiger Friede wäre für die Menschheit ein ungleich größeres Gut als unermeßliche Schätze Goldes, ganz abgesehen davon, daß eine künstliche Herstellung dieses begehrten Metalls es alsbald derart entwerten müßte, daß der ganze Vorteil verloren ginge. Immerhin hätte die Entdeckung insofern einen Wert, als das Gold ein schönes und nicht rostendes Metall ist. Ließe es sich billig beschaffen, so würde man zum Beispiel mit Vorliebe Denkmäler und dergleichen aus gediegenem Golde herstellen.«
»Aber,« wandte Ulrich ein, »der Stein der Weisen sollte doch auch vor Krankheit und Alter und gar vor dem Tode schützen?«
»Freilich! Die Alchimisten suchten in ihm auch das Lebenselixir. Das ist nun etwas, was mir selber unmöglich scheint: alle Krankheiten wird man nie aus der Welt schaffen, und gegen den Tod ist nun einmal kein Kraut gewachsen. Darum nannte man die Leute, die behaupteten, ein Lebenselixir zu besitzen, mit Recht Quacksalber. Das heißt, ursprünglich hatte dieser Name den schlimmen Beigeschmack nicht, wie heute: das Wort ›quack‹ oder ›queck‹, englisch ›quick‹, bedeutete das Lebhafte, Lebendige, weshalb › argentum vivum‹ (lebendiges Silber) auch mit ›Quecksilber‹ übersetzt wurde. Die Quacksalbe ist also die Lebenssalbe; vielleicht spielte auch bei ihr das Quecksilber eine Rolle, wie beim Goldmachen. Aber die Quacksalben erwiesen sich als Schwindel, und somit wurde der Name des Quacksalbers oder des Händlers mit Lebenselixiren, Lebenssalben und Lebenswasser zur Bezeichnung für einen Kurpfuscher.«
»Ob es wohl wirklich unmöglich wäre, ein echtes Lebenselixir herzustellen?« meinte Friedrich träumerisch. »Das war doch gewiß wert, daß man Jahrhunderte hindurch darnach suchte! Ja, das wäre der Stein der Weisen! Darnach zu suchen, dürfte man wohl seine Lebenszeit opfern: wie viel törichter ist doch das Streben so vieler Menschen ihr ganzes Leben hindurch! Keine Krankheit mehr, und leben solange man will ... Wieviel Glückliche könnte man damit machen!«
»Gewiß!« sagte der Vater zustimmend. »Aber das liegt nun einmal außerhalb der Weltordnung.« Friedrich seufzte; sein sinnendes Auge ließ aber erkennen, daß er dennoch vom Stein der Weisen träumte und ihn vielleicht nicht so ganz ins Reich der unerreichbaren Wunder verwies.
EINE helle Frauenstimme rief zum Nachtessen, und alsbald begab sich Kommerzienrat Friedung mit seinen Söhnen durch das erleuchtete Treppenhaus in den unteren Stock, wo sich das Eßzimmer befand. Auch hier zeigten die Möbel und die Eßgeschirre nichts, was auf mehr als gut bürgerliche Verhältnisse hinwies, ja, die Einfachheit des Mahles, das nur aus Suppe, Reis und Kartoffeln bestand, ohne irgend welche Getränke, hätte manchem verwöhnten Gaumen aus dem Bürgerstande durchaus nicht genügt. Dennoch war Kommerzienrat Friedung reich, sogar sehr reich. Er hatte sich aber aus mehr als bescheidenen Verhältnissen emporgearbeitet und hatte die Strenge gegen sich selbst, der er ganz besonders seine Erfolge verdankte, stets beibehalten. Das war jedoch keine bloße Gewohnheit, sondern ein wohlüberlegter Grundsatz bei ihm.
Oft hörten seine Söhne von ihm Äußerungen, wie die folgende: »Die Genüsse, die man sich durch Geld verschaffen kann, machen den Menschen nicht glücklich: im Gegenteil, wer sich nichts versagt, für den verliert alles an Wert, und nichts mehr macht ihm wahre Freude. Wohl aber kann man sich an die Üppigkeit derart gewöhnen, daß sie einem geradezu unentbehrlich erscheint. Da jedoch Reichtum ein unsicherer Besitz ist, so ist es die größte Torheit, sich ihn zum Lebensbedürfnis zu machen. Wer das tut, ist einem Morphiumsüchtigen zu vergleichen: der Genuß des Giftes macht ihn nicht glücklich, meist sogar sehr unglücklich, und doch kann er eher das Leben als das Morphium lassen. So sieht man viele Reiche, die durch ihr üppiges Leben nichts weniger als befriedigt wurden, sich dennoch das Leben nehmen, wenn sie plötzlich verarmen. Laßt uns leben, als ob wir arm wären und jeden Augenblick genötigt sein könnten, unser Brot durch Handarbeit zu verdienen, dann sind wir auch einem Glückswechsel gewachsen, ja, werden ihn nicht einmal als etwas Schweres empfinden.«
Das waren nun nicht bloß moralische Redensarten, sondern Friedung lebte nach seinen Grundsätzen und erzog seine Söhne darnach. Hierin wurde er durch seine vortreffliche Gattin aufs beste unterstützt. Sie war, als Tochter eines Landgeistlichen, ebenfalls aus einfachen Verhältnissen hervorgegangen. Ihr Gatte war kaum wohlhabend zu nennen, als sie ihm die Hand fürs Leben reichte. Als aber sein Bankgeschäft immer mehr aufblühte, als sein Ansehen ihm Zutritt in die vornehmste Gesellschaft verschaffte, glaubte die nunmehrige Frau Kommerzienrat durchaus nicht, in äußerlichem Aufwand mit ihren Bekannten wetteifern zu müssen: sie blieb sowohl in ihrer häuslichen Einrichtung als in ihrer Kleidung so einfach wie zuvor und war viel zu gescheit, als daß sie sich durch gelegentliche Sticheleien und verächtliche Mienen zu mehr als einem feinen Lächeln hätte bewegen lassen.
Natürlich war es vielen Damen der Gesellschaft unbegreiflich, daß hier eine solche Gleichgültigkeit gegen den Luxus herrschte, in dessen Entfaltung sie ihren höchsten Lebenszweck sahen; manche gingen so weit, diesen Umstand auf Geiz oder Mangel an Bildung zurückzuführen. Aber beide Vorwürfe waren unhaltbar; denn an Bildung waren Friedungs der ganzen Geldaristokratie der Stadt sichtlich überlegen, und ihre Wohltätigkeit, so sehr sie bemüht waren, sie im geheimen zu üben, ging so weit, daß es unmöglich war, sie zu verkennen oder gar zu leugnen.
So gingen Friedungs ihre eigenen Wege, und ein stilles, aber sonniges häusliches Glück belohnte ihre Pflichttreue.
Ulrich und Friedrich hatten ganz besonders die Früchte einer trefflichen Erziehung zu genießen. Nicht nur mußten sie sich in allen leiblichen Fertigkeiten üben, wobei der Vater stets mittat, was sie mächtig anspornte, sondern sogar an allerlei Entbehrungen, Strapazen und freiwillige Opfer wurden sie gewöhnt, und auch hierin leuchtete ihnen das väterliche Vorbild ermunternd voran.
Da konnte man den Kommerzienrat mit seinen Söhnen Holz spalten und Bäume ausputzen sehen; sie gruben die Erde um, legten neue Wege im Parke an, mauerten eine kleine Teichanlage eigenhändig aus, stellten Springbrunnen, Grotten und Wasserfälle her; sie zimmerten wirklich künstlerische Gartenhäuschen und Gartenmöbel; kurzum, sie verrichteten sowohl grobe Tagelöhnersgeschäfte als feine Handwerkerarbeiten. Und bei all diesen Betätigungen genossen Vater und Söhne die Freuden des Erfolges: Friedung war glücklich, wenn seine Buben alles so fröhlich und eifrig anfaßten und sich durch sein Beispiel so ermuntert fühlten; Ulrich und Friedrich aber empfanden fast die gleiche Befriedigung, wenn etwa die Beige der Holzscheite abnahm und der Haufe des gespaltenen Holzes wuchs, wie wenn eine kunstvolle Anlage in der Vollendung das Auge ihrer Schöpfer entzückte und ihr Herz erfreute.
Schon durch diese und ähnliche Übungen eigneten sich die Knaben nach dem Vorbild ihres Vaters eine ungewöhnliche Geschicklichkeit und umfassende praktische und technische Fertigkeiten an: sie waren Schreiner, Drechsler, Flaschner, Schlosser, Mechaniker, Uhrenmacher, Buchbinder, Elektrotechniker, Architekten und wer weiß was alles!
Oft machte Kommerzienrat Friedung mit seinen Söhnen größere Fußreisen bis nach Tirol und Italien, nach Frankreich, Holland und Dänemark. Sogar seine Gattin beteiligte sich an manchen dieser Wanderungen. Da wurden denn alle Beförderungsmittel als nicht vorhanden angesehen, außer Schuhmachers Rappen. Brunnen und Quellen boten meist den einzigen Trunk, Brot und Käse genügten oft zum Mittagsmahl. Um das Wetter bekümmerte man sich wenig. Man lief auch bei strömendem Regen frisch und munter voran. O wie herrlich, wie reich an erhebenden und heiteren Erinnerungen waren diese freien Ausflüge, bei denen namentlich das deutsche Vaterland nach allen Richtungen durchquert wurde, das all seine Schönheiten den empfänglichen Bewunderern offenbarte.
Daß die Knaben auch vorzügliche Turner, Reiter und Schützen waren, versteht sich von selber.
Über alledem wurde aber die Bildung von Geist und Seele nicht versäumt, vielmehr war die Erziehungsarbeit in dieser Richtung dem Vater die Hauptsache.
In allen körperlichen und praktischen Übungen war der ältere und kräftigere Ulrich dem jüngeren Bruder um etwas voraus, ausgenommen in der Treffsicherheit beim Schießen; wo es sich dagegen um Entwürfe, Pläne und scharfsinnige Beobachtungen handelte, war es Friedrich, der das Übergewicht hatte; besonders auch die reine Geistesarbeit des schulmäßigen Lernens ging ihm viel leichter als Ulrich, und er war Feuer und Flamme für die Wissenschaft.
Umfassende Kenntnisse der neueren Sprachen verdankten die Brüder ihrem Vater, der in seiner Jugend in Frankreich, Spanien, Portugal und England in Stellung gewesen war und die Sprachen dieser Länder nebst dem Italienischen so vollkommen beherrschte wie das Deutsche.
Es darf uns daher nicht wundernehmen, wenn der Kommerzienrat nach dem Nachtessen aus seinem Prachtwerk über Brasilien einiges in portugiesischer Sprache vorlas. Auch seine Gattin, die Englisch und Französisch schon als Mädchen sprach, hatte gelegentlich genügend von dem Sprachunterricht, den Friedung seinen Söhnen erteilte, aufgegriffen, um das Gelesene verstehen und mit lebhaftem Interesse verfolgen zu können.
Die Schilderungen waren aber auch dazu angetan, die Zuhörer mächtig zu fesseln. Besonders Friedrich lauschte wie gebannt, als die Rede von den ausgedehnten, noch fast unerforschten Gebieten im Westen des großen Reiches war, von den Wundern der Urwälder, von den Geheimnissen der Indianer und von den rätselhaften Spuren fabelhafter Tiere, die unzweifelhaft beobachtet wurden, so daß sich nicht länger leugnen ließ, daß an den unglaublichen Berichten der Eingeborenen über diese Ungetüme etwas Wahres sein mußte.
Kommerzienrat Friedung legte viel mehr Gewicht auf die Nachrichten über den außerordentlichen Reichtum des Bodens, der der Kultur noch nicht erschlossen war. »Wenn ich einmal nicht mehr wüßte, was anfangen, um mein Leben zu fristen,« äußerte er, »dorthin möchte ich wohl auswandern, dort muß noch viel zu machen sein; und wenn es auch keine Reichtümer zu erwerben gäbe, — es ist etwas Schönes und Erhabenes, als erster Vorkämpfer der Kultur neue Gebiete zu eröffnen.«
»O Papa! Da reisen wir einmal hin!« rief Friedrich begeistert aus.
Friedung lächelte; er ahnte nicht, wie bald sich der abenteuerliche Wunsch seines Sohnes erfüllen sollte.
UNTER dem allgemeinen Rückgang der Geschäfte hatte auch Kommerzienrat Friedungs Bankhaus schwer zu leiden, und manchmal äußerte sich der Bankier den Seinen gegenüber: »Wenn das so fortgeht, so kommen wir noch an den Bettelstab.« Obgleich solche Äußerungen scherzhaft gemeint waren und auch so aufgefaßt wurden, kamen doch bald recht ernste Sorgen. Da und dort erfolgten plötzlich Zusammenbrüche von Geschäftshäusern, die man für durchaus zuverlässig gehalten hatte, vor allem aber traf die Zahlungseinstellung eines weitverzweigten industriellen Unternehmens, die noch im gleichen November erfolgte, den Kommerzienrat wie ein Blitz aus heiterem Himmel; war auch der Himmel ihm schon längere Zeit nicht mehr so gar heiter erschienen, so kam ihm doch dieser Zusammenbruch völlig unerwartet, und da er selber mit namhaften Summen bei dem Unternehmen beteiligt war, so sah er sich auch in das Unglück mit hineingezogen.
Es waren sorgenvolle und arbeitschwere Tage für den geprüften Mann, da das Gerücht von dem Schwanken seiner Bank einen plötzlichen Ansturm des Publikums hervorrief: jedermann zog seine Einlagen zurück, während die Ausstände kaum einzutreiben waren. Friedung sah sich zu dem schweren Schritte genötigt, den Konkurs anzumelden. Er erlebte zwar die Genugtuung, daß die Gläubiger seines Hauses bei Heller und Pfennig befriedigt werden konnten, und das war dem edlen Manne die Hauptsache. Um aber dieses Ziel erreichen zu können, hatte er sein gesamtes Privatvermögen opfern und seine Liegenschaften veräußern müssen, so daß ihm nach Abwickelung sämtlicher Verbindlichkeiten nicht mehr als zwanzig- bis dreißigtausend Mark übrig blieben.
Unter diesen traurigen Umständen reifte in ihm der Plan, tatsächlich nach dem Westen Brasiliens auszuwandern, und wenn sich dort wirklich günstige Aussichten für sein Fortkommen bieten sollten, die Seinigen Nachkommen zu lassen.
Auch diesen brannte der heimatliche Boden unter den Füßen, nachdem ihr geliebtes Besitztum mit den vielen Werken ihrer eigenen Hände, mit all den Erinnerungen an fröhliche Stunden in fremdes Eigentum übergegangen war. So begleiteten sie den Vater im März des folgenden Jahres bis Hamburg und mieteten dort eine bescheidene Wohnung. Da sie nicht untätig bleiben mochten, auch ihre geringe Barschaft möglichst zu Rate halten mußten, suchten die Jünglinge eine Anstellung in kaufmännischen oder technischen Anstalten und hatten auch das Glück, ganz annehmbare Posten in zwei verschiedenen Geschäften zu finden. Ihre gründlichen Kenntnisse, ihre Gewandtheit und ihr Fleiß bewährten sich hierbei vorzüglich. Die Mutter ihrerseits verschmähte es nicht, durch Nähen für eine Fabrik den immerhin schmalen Verdienst zu vermehren.
So ließ denn Friedung seine Lieben vorerst geborgen zurück, während er auf den Wogen des Ozeans einer ungewissen Zukunft entgegenfuhr.
AN einem Sonntagnachmittag sah man in einer ziemlich abgelegenen Gegend in der Nähe von Hamburg einen feingekleideten Herrn lustwandeln, dessen Gesichtszüge französische Abkunft verrieten. Es war ein schwüler Augusttag, und der Herr, dessen würdevolle Mienen merkwürdig gegen sein geschniegeltes Aussehen abstachen, trocknete sich des öfteren mit einem zierlich gestickten Batisttüchlein die Stirne, da ihm der Schweiß trotz seiner langsamen Gangart immer wieder hervorperlte.
Plötzlich blieb er stehen. Es war ein Schuß gefallen, dem gleich darauf ein zweiter und dritter folgten. »Schau, schau! Eine Schießübung!« murmelte der Spaziergänger. »Ich will mal nachsehen, was dort los ist!«
Er ging dem Schall nach und fand bald an einem einsamen Plätzchen zwei stattliche blonde Jünglinge, die nach der Scheibe schossen. Sie besaßen Magazingewehre neuester Konstruktion, und feuerten, anscheinend ohne zu zielen, einen Schuß nach dem andern ab. Hierbei traf der jüngere trotz der großen Entfernung regelmäßig ins Zentrum, während der ältere nur selten daneben schoß, und dann nur um wenige Linien.
»Nanu!« rief der Franzose, indem er die Augen vor Erstaunen weit aufriß. »Das ist nicht schlecht! Man meint, es seien junge Buren! Zum Kuckuck! Wenn die Deutschen so schießen, dann Elsaß-Lothringen lebewohl!«
Die Knaben bemerkten in ihrem Eifer den Zuschauer nicht; dem älteren schien indes das Scheibenschießen langweilig zu werden, da er schließlich auch ausnahmslos Zentrum schoß. Er suchte nach einem andern Ziel. Da schlängelte sich ein bewegliches Eidechslein an dem Erdwall hinauf, der hinter der Scheibe aufgehäuft lag. Das kleine Tier war aus der Ferne kaum zu sehen. Der Jüngling aber legte rasch an — ein Schuß! und der Rumpf des Tierchens glitt hinunter, während der zerschmetterte Kopf durch die Kugel in die weiche Erde getrieben wurde.
»Alle Wetter!« murmelte der Franzose: ihm wurde unheimlich zu Mut.
»Aber Ulrich!« rief der jüngere der beiden Schützen, »wie kannst du nur so grausam sein!«
»Sei doch nicht so zimperlich, Friedrich!« erwiderte der andere achselzuckend. »Das Scheibenschießen kann für uns doch nur eine Vorübung sein: in Brasilien wird es gelten, nach Wild und reißenden Tieren, vielleicht auch nach feindseligen Menschen zu schießen!«
»O!« sagte Friedrich schaudernd, »niemals könnte ich auf ein menschliches Wesen anlegen.«
»Ohne Not natürlich nicht! Aber wenn es gälte, sich des Lebens zu erwehren ...«
»Ich glaube, ich ließe mich lieber wehrlos niedermachen.«
»Nun, so denke, wenn du in die Lage kämest, die Mutter gegen Räuber und Mörder verteidigen zu müssen?«
»Ach! Das wird doch nicht vorkommen?! Nein! Solche Gedanken könnten mir alle Lust zur Reise verderben: nicht einmal ein wildes Tier möchte ich erschießen!«
»Zu was übst du dich dann? Gib acht! Wenn einmal der Ernst des Lebens da drüben an dich herantritt, werden alle Erwägungen und Rücksichten auch bei dir schwinden, und du wirst handeln.«
»Wo denkst du hin!« rief Friedrich.
In diesem Augenblick erscholl ein verzweifelter Schrei: »Zu Hilfe, zu Hilfe! Ein toller Hund!«
Die Knaben wandten sich um und sahen den davoneilenden Franzosen, der in der Tat von einem geifernden Hunde verfolgt wurde, der schon nach ihm schnappte. Aber Friedrich hatte bereits die Büchse angelegt, und der Hund fiel, durch den Kopf getroffen, zu Boden. Nur einige Zuckungen, und er lag verendet da, alle viere von sich streckend.
»Bravo!« rief Ulrich. »Ich wußte es ja! Da siehst du selbst, wie die Umstände alle Bedenken mit einem Male vernichten können.«
»O!« sagte Friedrich ganz kleinlaut, »es war schrecklich; aber ich konnte doch nicht ruhig zusehen, wie es dem armen Menschen ans Leben ging? Wahrhaftig! Er hätte die Tollwut bekommen, und da hätte ich mir mein Leben lang Vorwürfe machen müssen. Aber es wäre mir lieber gewesen, du hättest den Hund erlegt.«
»Ich? Ich glaube nicht, daß ich mich getraut hätte: er war so dicht bei dem Manne, daß ich bei der großen Entfernung gar zu leicht diesen getroffen hätte. Du weißt, so unfehlbar sind meine Kugeln nicht, wie die deinigen.«
»Ums Himmels willen! An eine solche Gefahr dachte ich gar nicht. Wenn mir der Gedanke gekommen wäre, ich hätte so gezittert, daß ich gar nicht hätte schießen können.«
»Darum ist es gut, daß die Not dich ohne langes Besinnen handeln lehrte; sonst wäre es um den armen Menschen geschehen gewesen.«
Der Franzose war nach dem Schuß noch eine gute Weile weiter gesprungen. Endlich wagte er's, sich umzusehen, und da er den Hund nicht mehr hinter sich her springen sah und bald auch das tote Tier erblickte, näherte er sich seinen Lebensrettern.
»Ach!« rief er französisch aus, den beiden die Rechte schüttelnd, »das war Hilfe zur rechten Zeit, meine guten Freunde!«
»Ja,« meinte Ulrich ebenfalls auf französisch, »die Sache sah schlimm genug aus!«
»Welche angenehme Überraschung!« rief der Franzose in freudigem Erstaunen, als er Ulrichs tadelloses Französisch vernahm. »Die jungen Helden sind meine Landsleute! Ihre blonde Farbe hat mich getäuscht und ich hätte nie gedacht, daß unser Vaterland sich zu solchen Schützen Glück wünschen darf.«
»Wir sind Deutsche!« erwiderte Friedrich stolz.
»Was Sie sagen!« fuhr der Franzose sichtlich enttäuscht fort. »Da haben Sie aber fabelhafte Fortschritte in meiner Muttersprache gemacht, Sie sprechen sie ja ganz ohne fremdländischen Tonfall! Also Deutsche! Nun, es ist einerlei! Sie sind und bleiben meine Lebensretter. Offen gestanden, Hilfe hielt ich für unmöglich: weit und breit kein Mensch als die jungen Schützen, und ein Schuß — um die Wahrheit zu sagen, ich hätte ihn mehr gefürchtet als erhofft, wenn ich gedacht hätte, Sie könnten es überhaupt wagen, in solcher Lage zu schießen: Sie mußten sich doch selber sagen, daß Sie mich viel eher treffen würden als das Teufelsvieh.«
»Dies wäre bei mir zu befürchten gewesen,« erwiderte Ulrich, »aber bei meinem Bruder — da hatte es keine Gefahr: der würde Ihnen eine Fliege von der Nase wegschießen, ohne Ihre Haut zu streifen.«
»Mitten in solch einem tollen Lauf?«
»Mitten im Lauf!«
»Das lasse ich mir gefallen! Ich kann Ihnen nicht widersprechen, nachdem mich sein Scheibenschießen in solch großes Erstaunen versetzt hat. — Aber wie kann ich Ihnen meine Dankbarkeit beweisen?«
Die Brüder wollten davon nichts wissen. Der Franzose versicherte sie seiner lebenslänglichen Verpflichtung und beschwor sie, wenn sie irgend einen erfüllbaren Wunsch hegten, sich an Professor Lemaistre in Paris zu wenden. »Freilich,« fügte er hinzu, »die nächsten Jahre werde ich mich in Ecuador befinden mit unbestimmter Adresse. Die Regierung hat mich zur Gradmessung dorthin berufen, und ich befinde mich deshalb zunächst auf der Heimreise von St. Petersburg, wo ich die letzten Monate weilte. Da ich noch einige Wochen Zeit habe, sah ich mir unterwegs einige größere Städte Deutschlands an.« Unter den lebhaftesten Versicherungen seiner ewigen Dankbarkeit verabschiedete sich der liebenswürdige französische Gelehrte von seinen neuen Freunden, als ihre Wege sich trennten.
HERR Friedung konnte ziemlich günstige Nachrichten von Brasilien senden. Er hatte um wenig Geld fast unabsehbare Grundstücke in einer freilich ganz abgelegenen Gegend erworben. Ein romantisches und arbeitsreiches Leben nicht ohne Gefahren hatte am Saum des Urwaldes für ihn begonnen. Bis zur nächsten Stadt waren es mehrere Tagereisen, und da er keine andere Gelegenheit hatte, Nachrichten zu befördern oder in Empfang zu nehmen, als wenn er selber nach der Stadt reiste, so konnte ein brieflicher Verkehr nur mit monatelangen Unterbrechungen erfolgen. Als er schrieb, war er gerade zur Stadt geritten, um sich mit den notwendigsten Bedürfnissen für lange Zeit hinaus zu versehen und einige Arbeiter anzuwerben. Sein Unternehmen erschien ihm übrigens ganz aussichtsvoll, und er bat die Seinen, ihm bei nächster Gelegenheit zu folgen.
Bis zu ihrer Ankunft hoffte er ein behagliches Heim errichtet zu haben. Da es weit und breit keine zivilisierten Menschen gab, sehnte er sich doppelt nach seinen Lieben, und diese, von gleicher Sehnsucht erfüllt, versäumten es nicht, noch im gleichen Herbst einen Ozeandampfer zu besteigen mit der Bestimmung nach Caracas, von wo aus die Reise durch Venezuela nach Westbrasilien unternommen werden sollte.
Die vorsorgliche Mutter verteilte ihre Barschaft in der Weise, daß sie zwar die Hauptsumme behielt, aber jedem ihrer Söhne ein starkes Lederbeutelchen mit je fünfzig Zwanzigmarkstücken übergab, das sie auf der Brust zu tragen hatten für den Fall, daß sie durch irgend ein unglückliches Ereignis getrennt würden oder eines von ihnen um sein Geld käme.
So treffen wir die drei Reisenden an Bord des Dampfers Cartagena, der bei schönster Witterung die endlose Fläche des Atlantischen Ozeans furcht.
Bei der Fahrt durch den Kanal hatten Ulrich und seine Mutter alle Schrecken der Seekrankheit durchgemacht, während Friedrich merkwürdigerweise ganz davon verschont blieb. Nun waren aber auch die Patienten wieder wohlauf und in fröhlichster Stimmung. Schon während ihres Aufenthaltes in Hamburg hatte Friedungs Lebensweisheit die herrlichsten Früchte getragen: der plötzliche Wechsel, der unsere Freunde betroffen hatte, war nicht imstande gewesen, ihr Gemüt niederzudrücken, ja, sie empfanden das neue Leben in der Armut mit ihren Entbehrungen gar nicht als eine Last; denn wie oft hatten sie schon früher wochenlang freiwillig ein mindestens ebenso bescheidenes Dasein geführt: diese Gewöhnung kam ihnen jetzt reichlich zugute.
Die Fahrt auf dem Ozean mit seinen neuen Wundern hielt anfangs ihr Interesse in steter Anspannung; da aber unterwegs keine Insel berührt wurde bis zu den Antillen, so mußte das ewige Einerlei von Himmel und Wasser auf die Dauer ermüdend wirken, denn nur selten gab es interessante Fische zu beobachten. Frau Friedung und Ulrich litten daher bald etwas unter der Langeweile und sehnten sich nach dem Anblick einer Küste; nur Friedrich wurde die langwierige Fahrt nicht zuviel: seine lebhafte Phantasie ersetzte ihm den Mangel an äußeren Erlebnissen, und oft unterhielt er auch den Bruder und die Mutter mit den glänzenden Bildern, die sein Geist sich ausmalte.
So lehnte er eines Abends an der Brüstung des Verdeckes und schaute in die dunkle Tiefe, die den sternenbesäten Himmel geheimnisvoll widerstrahlte. Er war in Träume versunken und merkte nicht das Nahen des Bruders, bis dieser ihn anredete:
»Nun,« sagte Ulrich, »siehst du wieder etwas Neues in dieser Dunkelheit, Friedrich?«
»Etwas Neues nicht,« erwiderte der Bruder lächelnd, »wohl aber etwas Uraltes: schau doch nur hinunter, welche Herrlichkeiten aus dem Grunde des Ozeans heraufschimmern! Aber freilich, du siehst nichts davon, du nüchterner Mensch! Doch ich will es dir beschreiben, so gut ich kann. Weißt du, wir fahren über die Stätte, wo in grauer Vorzeit die glückliche Insel Atlantis versunken ist.«
»Was? Professor Häuble setzte uns doch auseinander, daß sie sich im Mittelländischen Meer befunden habe.«
»Geh mir weg mit solchen Fündlein: nach Platos Beschreibung mußte sie sich zwischen den Antillen und Gibraltar ausdehnen; er beschreibt ja die Lage so deutlich! Nur daß die Antillen damals noch miteinander zusammenhingen, so daß der Golf von Mexiko ein Binnenmeer bildete. Also! Hier unten liegt die Atlantis still und tot unter den Wassern. Aber ein Leuchten geht von ihr aus, daß ich ihre alte Pracht deutlich vor Augen sehe: die Ruinen phosphoreszieren da unten in grünem, blauem und rosigem Licht. Da schaue ich tiefe Täler und mächtige Gebirge, sanftgewölbte Hügel und weite Ebenen, versteinerte Wälder und erstarrte Gärten. Eben an dieser Stelle fahren wir über eine herrliche Stadt. Sie hat breite gepflasterte Straßen und jedes Haus scheint ein Palast aus buntem Marmor zu sein; freilich ist fast alles zerfallen, aber doch erkennt man noch die mächtigen Bogenfenster, die großen Terrassen und zierlichen Altanen, die schlanken Säulen, von bunten Blumengewinden aus durchsichtigem Stein umgeben, die hochragenden Türme und rings auf den Hügeln die Lustschlösser und Villen mit ihren kunstvollen Parkanlagen. Da wachsen aber Tang und Seepflanzen, Korallen ranken am Gemäuer empor, und Perlmuscheln haben sich an den Säulen festgesetzt; gespenstische Seespinnen und riesenhafte Krebse kriechen auf dem zerfressenen Pflaster umher und stumm schwimmen wunderliche Fische durch die Fensteröffnungen aus und ein.

»Und schau! Die Wassermädchen, wie sie über die goldnen Kuppeln hinhuschen und in die Gassen niedertauchen! Sie klopfen mit den Knöcheln an die Glocken, daß sie leise heraufklingen, — und horch! hörst du nicht ihr schwermutsvolles Klagelied über den Untergang menschlicher Größe?«
»O Friedrich!« sagte Ulrich, ganz hingerissen von der lebensvollen Schilderung, »du bist wahrhaftig ein Dichter; man könnte glauben, du sähest und hörtest das alles in Wirklichkeit.«
»So ist es mir selber: es ist ganz wie etwas Fremdes außer mir, das ich schaue und vernehme, gerade wie ein Traum, den man auch für einen wirklichen Vorgang hält, in dem man hört und sieht, was man im wachen Zustande gar nicht ausdenken könnte. Wenn du Lust hast, mir weiter zuzuhören: ich habe auch ein paar Verse über die Atlantis gemacht.«
»Nur zu! ich bin ganz Ohr!« erwiderte Ulrich begierig, und Friedrich sagte seine Verse aus dem Gedächtnis her:
»Wo sich in unsern Tagen
Dehnt ein unendlich Meer,
Sah man vor Zeiten ragen
Ein Inselland so hehr:
Es war ein Garten blühend,
Ein irdisch Paradies,
In Wunderpracht erglühend,
Wie sich's nur träumen ließ.
Dort wuchs in grauen Zeiten
Ein adliges Geschlecht,
Das ließ sich stetig leiten
Von Freiheit, Licht und Recht.
Sie hatten sich erbauet
Die schönste Königsstadt,
Dergleichen wohl erschauet
Seither kein Auge hat.
Die lichten Hallen glänzten,
Und Türme schlank und hehr
Und goldne Kuppeln kränzten
Ein Marmorsäulenmeer.
Einst ging aus ihrer Mitte
Hervor ein kühner Held,
Der träumt', daß er erstritte
Das weite Rund der Welt:
Wo rings die Welt in Grauen
Noch lag und tiefer Nacht,
Wollt' er ein Reich erbauen
Des Lichts mit Waffenmacht.
Da zogen stolze Flotten
Weit durch die Meeresflut,
Bemannt mit kühnen Rotten
Voll edler Kampfesglut.
Sie kamen hergezogen
Zum afrikan'schen Strand
Und sprangen aus den Wogen
Kampffreudig an das Land.
Nie sah man solch ein Streiten,
Nie solchen Heldenzug:
Sie stürmten durch die Weiten
Im Adlersiegesflug.
Wo ihre Waffen klangen,
Da hielt kein Gegner stand.
Wo sie ihr Schlachtlied sangen,
Da beugt' sich Volk und Land.
Da plötzlich aber stehen
Sie an der Wüste Rand
Und stutzen, da sie sehen
Das weite Meer von Sand.
Und wie sie dennoch weiter
Stets treibt ihr stolzer Mut,
Verzehrt die kühnen Streiter
Der Wüstensonne Glut.
In Schmachten und in Dürsten
Schwand ihre Heldenkraft,
Die stolzen Kriegerfürsten
Sind bis zum Tod erschlafft!
Sieh an Ägyptens Grenzen
Im glühnden Sonnenstrahl
Ein wogend Meer erglänzen
Von Gold und blankem Stahl:
Mit Rossen und mit Wagen
Zog an in seiner Pracht
Der Pharao, zu schlagen
Des fremden Volkes Macht.
Die müde Schar muß weichen
Zurück durch Feindesland;
Nur wenige erreichen
Den fernen Meeresstrand.
Doch wie sie auch durchsuchten
Das weite, öde Meer, —
Der Heimat traute Buchten
Erschaute keiner mehr:
Die wilden Wogen schlangen
Das Paradies hinab,
Und müde Glocken klangen
Tief aus dem nassen Grab.
Da sprangen aus den Schiffen
Sie weit ins Meer hinein
Und zogen in den Tiefen
Zur Heimat wieder ein.«
»Und nun noch eins,« fuhr Friedrich fort, als Ulrich ergriffen und schweigend verharrte:
»In des Meeresgrundes Frieden
Königlich und wunderbar
Schläft die Stadt der Atlantiden
Schon so manche tausend Jahr'.
Wie vor grauer Zeit sie nächtig
In die Fluten sank hinab.
Ragt sie heut noch stolz und prächtig
In dem weiten Wassergrab;
Denn in jenem tiefen Grunde
Ruhn die Wasser regungslos,
Seit sie einst zur Mittnachtstunde
Aufgewühlt der wilde Stoß.
Was dem Stoße standgehalten,
Ist noch heute unversehrt:
Keine feindlichen Gewalten
Haben mehr den Ort verheert.
Sieh die goldnen Kuppeln leuchten
Wunderbar im Sternenschein,
Der nur dämmernd in die feuchten
Tiefen dringt und blaß hinein.
Durch die rötlichen Korallen
Schimmern, wie im Mondlicht, bleich
Jene stolzen Marmorhallen
Herrlich und geheimnisreich;
Möchten gerne Kunde geben
Von den Wundern dieser Stadt,
Von dem fröhlich frischen Leben,
Das sie einst durchflutet hat.
Denn sie schlummern und sie träumen,
Träumen von der goldnen Lust,
Die in ihren lichten Räumen
Einst geschwellt so manche Brust,
Da so oft bei frohen Festen
Noch im buntgeschmückten Saal
In den glänzenden Palästen
Klang der funkelnde Pokal,
Wenn zu hohen Siegesfeiern
Sich geschart die Helden hehr
Und der Klang von goldnen Leiern
Quoll hinaus ins stille Meer.
Ozean der Atlantiden,
Der so still im Mondlicht lag,
Ahnte wer in diesem Frieden
Jenen grausen Schreckenstag,
Wo in Wetterfinsternissen
Deine Wogen, Bergen gleich,
Brüllend in die Tiefe rissen
Dieses blühnde Inselreich?
Nun die Hallen stehn und trauern,
Die so gar verödet sind,
Zieht doch klagend durch die Mauern
Nicht einmal ein Abendwind.
Öde, öde und verlassen!
Keinen Laut vernimmt man mehr:
In den ausgestorbnen Gassen
Schwimmen Fische nur umher.
In den hohen Säulengängen
Schwimmen keck sie aus und ein,
Bunte Perlenmuscheln hängen
An dem weißen Marmelstein.
Wassermädchen ziehn in Kreisen
Ob den goldnen Kuppeln hin.
Singen sehnend ihre leisen,
Schwermutsvollen Melodie'n«.
Friedrich schwieg, und auch Ulrich konnte lange kein Wort sagen; denn ihm war es wirklich, als sei alles vor seinen Augen vorbeigezogen, wie die Phantasie seines Bruders es geschildert hatte. Dann aber sagte er: »Es ist merkwürdig, Friedrich, welches Interesse und welches Leben du dem toten Ozean abzugewinnen vermagst. Ich selber sehe jetzt diese eintönige Wasserfläche mit ganz andern Augen an, seit ich darüber nachdenke, was sie alles in ihrem Grunde verbergen mag. Doch Mutter ruft! Wir wollen hinuntergehen: es ist schon spät!«
AM 23. September erschien das südliche Kreuz am Himmel. Mit Entzücken beobachteten unsere Freunde diese neue Erscheinung, auf die sie sich schon lange gefreut hatten; von einem alten Matrosen lernten sie bald aus der senkrechten oder geneigten Stellung des funkelnden Sternbildes die Stunden der Nacht wie auf einer Uhr ablesen.
Dann ging es noch mehrere Tage durch die öde Wasserwüste; bald aber verkündeten bunte Vögel, die sich auf den Masten und Rahen niederließen, die Nähe von Land, und am 30. September wurde den Reisenden der langersehnte Anblick einer nicht fernen Küste zuteil. Es ist nicht möglich, den Jubel zu beschreiben, der an Bord ausbrach, als die Nachricht bekannt wurde, daß der Dampfer sich der Insel Tobago nähere. Hoch klopfte das Herz der Knaben bei der Aussicht, nun bald La Guayra, den Hafen von Caracas, zu erreichen, von wo aus sie die Landreise zum Vater antreten würden. Ob er wohl schon Nachricht von ihrer baldigen Ankunft hatte? Bei den Schwierigkeiten der Postverbindung war dies sehr zweifelhaft, und so sehr es sie gefreut hätte, von ihm in La Guayra empfangen zu werden, so entzückte sie fast noch mehr die Hoffnung, ihn gänzlich unerwartet in seiner Einsamkeit zu überraschen: welch ein Wiedersehen würde das sein! Ach! Sie ahnten nicht, daß ihre Träume nicht in Erfüllung gehen sollten!
Die Insel Tobago kam immer näher und gewährte einen höchst malerischen Anblick: aus leuchtend weißen Felsmassen grüßten zerstreute Baumgruppen, und hohe zylindrische Fackeldisteln gewährten, einen seltsamen und hochinteressanten Anblick. Mit lauten Rufen der Verwunderung und des Entzückens begrüßte besonders die Jugend an Bord die eigenartig herrliche Pflanzenpracht der Tropen.
Eine Landung auf Tobago war nicht vorgesehen, und so fuhr die Cartagena über die Untiefe zwischen Tobago und La Grenada auf die Insel Margarita zu. Die scharfen Blicke der Seeleute, unterstützt durch eine reiche Erfahrung, bemerkten die Anzeichen eines heftigen Sturmes, der in kürzester Zeit auszubrechen drohte. Doch kümmerten sich die Passagiere wenig darum: die außerordentlich günstige Überfahrt hatte sie sicher gemacht, und sie dachten gar nicht daran, daß ihnen so nahe ihrem Ziele noch ernstliche Gefahren drohen könnten. Der Kapitän aber beschloß, angesichts der Umstände auf eine Landung in Cumana zu verzichten und direkt auf La Guayra zu halten.
In der Nacht brach das Unwetter mit solch rasender Gewalt aus, daß kein Mensch an Schlaf denken konnte. Wild heulte der Sturm, und die Masten bogen sich und knarrten; das Schiff wollte dem Steuer nicht mehr gehorchen und wurde weit von seinem Kurs abgetrieben. Gewaltige Sturzseen richteten auf dem Verdecke große Verwüstungen an, und die heiseren Kommandorufe des Kapitäns, die fast ununterbrochen erschollen, waren in dem Brausen der Elemente kaum zu vernehmen.
Nun war freilich bei den Reisenden die höchste Todesangst an Stelle der Zuversicht getreten. Unter Deck war es nicht auszuhalten, und oben galt es, sich anzuklammern oder festzubinden, wo man konnte, um nicht über Bord geschwemmt zu werden. Um die Schrecken noch zu vermehren, brach ein furchtbares Gewitter aus; Blitz auf Blitz zuckte; aber die grollenden Donnerschläge waren kaum in dem allgemeinen Tosen und Brausen zu unterscheiden. Da traf der Blitz den Hauptmast, der mit fürchterlichem Krache zersplitterte und vom Sturme vollends gestürzt wurde. Das Maß des Unglücks aber ward erst voll, als der Orkan sich in einen Tornado, einen Wirbelsturm, verwandelte, der das mächtige Schiff wie einen Kreisel um seine Achse drehte, wobei das Steuerruder in einem Augenblick abgeknickt wurde. Bei der dichten Finsternis, die herrschte, war die Verwirrung an Bord unbeschreiblich. Von den Reisenden wußten die wenigsten, welches Unglück den Dampfer betroffen hatte, aber alle sahen das Verderben vor Augen. Ulrich und Friedrich wichen nicht von der Seite ihrer Mutter, die sie fest umklammert hielten, und die drei waren entschlossen, sich auch im Tode nicht voneinander zu trennen.
Der Tornado hatte nur wenige Sekunden gewütet. Sie hatten aber genügt, das stattliche Schiff in ein Wrack zu verwandeln, eines der Boote durch die Luft zu entführen und mehrere Menschen, Matrosen und Passagiere, in die kochenden Wogen zu reißen. Nun ließ der Orkan nach und die Wolken zerrissen, so daß die Morgendämmerung allmählich das Bild der Verwüstung den entsetzten Blicken der Schiffbrüchigen offenbarte. In geringer Entfernung zeigten sich die grauen Umrisse einer flachen Insel, die von den Matrosen für die Punta Brava in der Nähe des Festlandes von Tucacas erklärt wurde.
Da das Schiff leck war und zu sinken begann, ließ der Kapitän die Boote aussetzen. Rasch füllte sich das erste mit den in Todesangst sich drängenden Reisenden. Ulrich und Friedrich hatten Mühe, ihre Mutter noch hineinzubringen, ehe der letzte Platz besetzt war. Die edle Frau hatte sich von ihren Söhnen nicht trennen wollen und bestieg das Boot nur in der sicheren Voraussetzung, daß diese ihr folgen würden. Sobald sie bemerkte, daß das überfüllte Fahrzeug keinen Raum mehr bot, wollte sie zurück; aber schon stieß die Nußschale ab und schaukelte so gewaltig auf den bergeshohen Wogen, daß die zu Tode erschöpfte Frau halb ohnmächtig zu Boden sank. Als sie sich wieder aufrichtete, hatte sie die Genugtuung, wenigstens noch sehen zu können, wie ihre Knaben im zweiten Boote Platz fanden. Aber ein Schrei des Entsetzens entfuhr ihr, als sie gleich darauf die Cartagena in den Wellen versinken sah: unter eigentümlichem Gurgeln verschwand der Koloß, und der ungeheure Strudel, der in demselben Augenblick entstand, erfaßte das Boot, in dem Ulrich und Friedrich Unterkunft gefunden hatten: es schwankte, schöpfte Wasser und schlug um. Mit stieren Blicken hatte die unglückliche Mutter das gräßliche Schauspiel verfolgt; — nun sank sie ohne Besinnung zurück, und ihr letzter Gedanke war ein Bedauern, daß sich ihr eigenes Boot nicht an Stelle des andern noch im Bereiche des Wirbels befunden habe, oder daß nicht beide miteinander untergegangen seien.
Die beiden Knaben waren beim Umschlagen des Bootes weit hinausgeschleudert worden, und da sie sich ziemlich am äußersten Rande des Strudels befanden, gelang es ihnen, sich als treffliche Schwimmer über Wasser zu halten. Die anziehende Kraft des Wirbels verlor bald ihre Wirkung, und das Meer glättete sich wieder über dem versunkenen Schiffe — wenn man so sagen darf, denn die Glättung war bei dem immer noch hohen Wogengange nur eine verhältnismäßige. Spieren und Fässer schwammen in Menge umher. Ulrich gelang es bald, sich an einem Balken festzuklammern, und auch Friedrich erreichte einen solchen. An dem Balken, den Friedrich erfaßt hatte, hing noch eine ganze Taurolle, die aber eben im Begriffe war, weggespült zu werden. Rasch ergriff der Knabe das Tau und band es mit einem Ende fest an seinen Balken, wohl einsehend, wie wertvoll es noch für ihn werden könnte. Dann aber war es sein Erstes, sich auf den Balken zu schwingen, um nach seinem Bruder und nach seiner Mutter Ausschau zu halten. Ulrich erblickte er dann ganz in der Nähe, ebenfalls auf einem Balken reitend; außer ihnen beiden schien kein Insasse des verunglückten Bootes gerettet zu sein.
Schwieriger war es, das Boot auszukundschaften, in dem sich die Mutter befand: es näherte sich rasch der Küste von Punta Brava und war nur zu erblicken, wenn es sich auf den Kamm einer Woge erhob. Auch Ulrich schaute scharf nach dem Boote aus. Die Knaben hatten selber keine Hoffnung, die Insel erreichen zu können, da sie sich willenlos mit ihren Balken dahintreiben lassen mußten: sie wurden von der Insel weg gegen Süden getrieben, der venezolanischen Küste zu, von der jedoch bloß westlich in weiter Ferne ein Streifen zu erblicken war. Nur von der Rettung der Mutter wollten sie sich überzeugen: ihr eigenes Schicksal kümmerte sie in diesem Augenblick wenig.
Ihre Hoffnung wuchs, je mehr sich das ängstlich beobachtete Boot der Insel näherte; doch sollten sie bald grausam enttäuscht werden: Punta Brava ist rings von einem Korallenriffe umgeben, das nur eine einzige Durchfahrt bietet. Dieser steuerte das Boot zu. Der Kampf mit den mächtigen Wogen erschwerte aber das Steuern ungemein, und in der Nähe des Riffes herrschte eine gewaltige Brandung; von dieser wurde das Boot erfaßt, ehe es sich in der Einfahrt befand; wie ein Ball wurde es gegen das Riff geschleudert, an dem es zerschellte.
Schreckenstarr sahen die Knaben dem grausigen Vorgange zu: schon hatten sie die Rettung der geliebten Mutter unzweifelhaft gewähnt, da mußten sie sehen, wie die Insassen jenes Bootes, die in der Ferne nur wie dunkle Punkte erschienen, im weißen Schaume der Brandung versanken. Nur instinktmäßig hielten die beiden sich an den Balken noch fest: es war, als hätte ihre eigene Rettung gar kein Interesse mehr für sie.
LANGE dauerte es, bis die Knaben wieder zum Bewußtsein der eigenen Lage kamen. Der Sturm ließ immer mehr nach, und Friedrich, dessen Balken der bedeutend leichtere war, sah sich immer näher dem Bruder zugetrieben. Nun empfand er erst den Trost, daß wenigstens Ulrich der Katastrophe entgangen war, und er richtete sein Augenmerk darauf, mit ihm zusammenzukommen. Die Brüder waren einander so nahe, daß sie sich beim abnehmenden Getöse der Elemente gegenseitig verständlich machen konnten. »Steure auf mich zu!« rief Ulrich; aber das war leichter gesagt als getan, denn wie sollte Friedrich das Steuern bewerkstelligen? Er war in Gefahr, in einiger Entfernung an Ulrich vorbeizutreiben, und wer konnte dann wissen, ob sie nicht dauernd voneinander getrennt würden? Dies erschien ihnen nun als die augenblicklich größte Gefahr, und ließ ihre Gedanken von dem schrecklichen Schicksal ihrer Mutter etwas abkommen. Friedrich besann sich nicht lange, was er zu tun habe: er zog das im Meer treibende Tau an sich, bis er dessen freies Ende in Händen hatte, und nun warf er es mit einem geschickten Wurf dem Bruder zu, der so glücklich war, es aufzufangen, und alsbald an dem Seile Friedrichs Balken heranzog.
Nun aber begann für die Jünglinge eine schwere Arbeit. Ihre Kräfte waren nahezu erschöpft, und doch mußten sie darauf bedacht sein, nicht wieder getrennt zu werden und sich möglichst sicher an den Balken zu befestigen, da sie nicht wissen konnten, wie lange sie noch in den Fluten treiben mußten. Zunächst wollten sie versuchen, die Balken kreuzweise übereinanderzuschieben und in dieser Lage fest aneinanderzubinden. Sie fanden zu ihrem Erstaunen, daß der hohe Wogengang ihnen hierbei eher förderlich als hinderlich war. Während ein Schiff mit großem Tiefgang unter den starken Wellen, die sich an den Schiffswänden brechen und leicht das Deck überfluten, schwer zu kämpfen hat, werden leichtere Gegenstände auch von den höchstgehenden Wogen sanft emporgehoben und gesenkt, und der Schwimmer empfindet weniger Anstrengung als bei spiegelglatter See: nur Sturzseen und die Brandung am Ufer sind für ihn unmittelbar gefährlich. So gelang die allerdings anstrengende Arbeit des Übereinanderschiebens der Balken in verhältnismäßig kurzer Zeit, wobei unsere Freunde an den Balken selber stets einen Halt fanden, der sie über Wasser hielt. Schwieriger war es, das Tau unter dem Kreuzungspunkte hindurchzuziehen, dazu mußte unter Wasser getaucht werden; aber auch dieses Kunststück gelang nach einigen vergeblichen Anläufen.
Auf dem derart hergestellten Kreuze reitend, die Balken mit den Füßen umklammernd, zerschnitten unsere Freunde mühsam mit den Taschenmessern den langen Strick. Der Rest ihrer Arbeit war weit weniger beschwerlich, und nur die große Ermattung zwang sie, öfters zwischenhinein auszuruhen; sie knüpften aus den kürzeren und längeren Stücken des Seiles zwei Netze, die sie in zwei gegenüberliegenden Winkeln des Balkenkreuzes befestigten. In diesen Netzwerken konnten die Schiffbrüchigen, freilich mit halbem Leibe im Wasser, bequem und sicher liegen: von den Wellen gehoben und gesenkt fühlten sie sich ganz angenehm geschaukelt, ein Untersinken war nunmehr unmöglich. Zur Vorsicht banden sie sich noch selber mit dem Oberkörper unter den Armen an den Balken fest, so daß sie auch bei völliger Entkräftung, ja selbst im Falle einer Ohnmacht sicher waren, nicht mit dem Kopfe unter Wasser zu kommen. Auch einem erneuten Sturm konnten sie derart geborgen ohne Furcht entgegensehen: es kam jetzt alles darauf an, daß sie eine Küste erreichten, ehe sie dem Hunger erlagen, dessen erste Regungen sie schon verspürten.

Tiefgreifende Erlebnisse besonders schmerzlicher Art ermüden den menschlichen Geist gewöhnlich derart, daß er bald nicht mehr imstande ist, den traurigen Gedanken nachzuhängen. Je heftiger die Seelenerschütterung ist, desto rascher tritt natürlicherweise der Umschwung ein, und das ist gut, sonst müßte der Schmerz zur Schwermut führen. Der Geist erlebt in kurzer Zeit so viel, daß ihm nach wenigen Stunden das schmerzliche Erlebnis um Monate oder Jahre zurückzuliegen scheint und eine milde Wehmut an Stelle des heftigen Schmerzes tritt. Das erfuhren auch Ulrich und Friedrich, wenn sie ihrer Mutter gedachten. Die erste Trauer war so übermäßig stark gewesen, daß sie bald nicht mehr imstande waren, ihr dauernd nachzuhängen und ihre gesunde Natur das Übermaß des Schmerzes rasch überwand.
Unter glühendem Sonnenschein trieben die Jünglinge immerfort langsam nach Süden, oft halb bewußtlos. Die Kühle des Abends bot ihnen endlich willkommene Erquickung, und zwischen Wachen und Schlummern oder Ohnmacht verging ihnen die Nacht in den salzigen Wogen.
Erst als der sonnige Morgen aufglänzte, kamen sie wieder zu völligem Bewußtsein, und trotz der ausgestandenen Strapazen und des nagenden Hungers ruhten ihre Augen entzückt auf dem prächtigen Schauspiel, das sich ihnen bot: wenige hundert Meter vor ihnen lag die Küste von Venezuela ausgebreitet. Seltsame Pflanzen mit riesigen Blättern und ungeheuren Blüten, Palmen und Bananen, Riesenkakteen, die bis zu zwanzig Meter hohen Armleuchtern glichen, Agaven und Mimosen säumten die merkwürdig rotgelben Ufer. Im Hintergrunde erhoben sich mächtige Berge, von Urwald bedeckt, und zur Linken, in einer Entfernung von etwa einer Stunde, leuchteten die Häuser von Puerto Cabello durch die Manglebüsche.
Das Wasser der Bucht war so klar, daß man bis auf den Grund sehen konnte, wo zierliche Seepflanzen und schimmernde Korallen wuchsen, zwischen denen sich allerlei Getier mehr oder minder lebhaft bewegte. Da die Balken in dem völlig beruhigten Meeresspiegel fast unbeweglich verharrten, entschlossen sich die Brüder, die kurze Strecke bis zum Ufer schwimmend zurückzulegen. In der Nähe des Strandes erblickten sie eine Hacienda, das heißt ein Landhaus, das fast völlig von den Bäumen eines tropischen Parkes verdeckt war; diesem beschlossen sie als dem nächstliegenden Landungspunkte zunächst zuzustreben.
In diesem Augenblick trat aus dem offenen Tore des Parkes ein kleines Mädchen, das eiligen Fußes dem Meere zu hüpfte; dort schien es Muscheln im Sande zu suchen; dann kletterte es auf einen Felsblock am Ufer, der wie ein Hafendamm sich lang ins Wasser hineinstreckte. Auf dem schlüpfrigen Felsen, der zur Flutzeit mit Wasser bedeckt sein mußte, trippelte das Kind weiter bis zu seinem äußersten Rande; dort aber glitt es plötzlich aus und fiel mit einem gellen Aufschrei ins Wasser.
Ulrich ruderte aus aller Kraft dem Felsen zu; Friedrich folgte ihm, konnte aber mit der Körperkraft des Bruders nicht wetteifern. Sie sahen das Kind noch einmal auftauchen, dann aber in den Fluten versinken. Allein Ulrich war alsbald zur Stelle; er tauchte hinab und erreichte in einer Tiefe von zwei Metern den Grund, auf dem er das zarte Geschöpf alsbald entdeckte. Rasch umfaßte er es mit einem Arme und stieg mit ihm ans Licht empor. Unterdessen war Friedrich nachgekommen und in weniger als zwei Minuten hatten die beiden mit dem bewußtlosen kleinen Mädchen den Strand erreicht. Kurz darauf kam ein bärtiger Mann in weißen Leinenkleidern und mit einem großen Strohhut aus dem Parktore gesprungen. »Mein Kind, mein Kind!« schrie er auf spanisch. »Hier ist es; es lebt, es ist gerettet,« rief ihm Ulrich in der gleichen Sprache zu.
Die Knaben hatten gleich, nachdem sie das Kind in den Sand niedergelegt, dessen Kleider geöffnet und durch Bewegung seiner Arme künstliche Atmung eingeleitet. Da das Mädchen nicht lange unter Wasser gelegen hatte, zeigte sich rasch der Erfolg dieser zweckmäßigen Behandlung, und als der Vater zur Stelle kam, sah er schon sein Töchterlein die großen Augen aufschlagen. Der entzückte Mann preßte das Kind an die Brust und bedeckte sein Antlitz mit Küssen. Dann aber reichte er den Knaben die Hand und dankte ihnen mit warmen Worten. Zugleich schalt er über die unachtsame Wärterin, die das Unglück verschuldet hatte.
Als er vernahm, daß die Retter seines Lieblings Schiffbrüchige waren, nötigte er sie alsbald in seine Wohnung und ließ sie vollständig neu kleiden, da er Diener von ihrem Alter und von ihrer Größe besaß. Dann wurde ihnen zunächst ein reichlicher Imbiß vorgesetzt, der den Halbverhungerten vorzüglich mundete, obgleich er meist aus ihnen völlig unbekannten Speisen und Früchten bestand.
Ganz außer sich vor Freude zeigte sich jedoch der Besitzer der Hacienda, als er vernahm, daß die neugewonnenen jungen Freunde Deutsche waren. »Ich selber bin deutscher Geburt,« sagte er nun in deutscher Sprache, »und heiße Lehmann; freilich habe ich mein Vaterland seit fünfzehn Jahren nicht mehr gesehen. So lange ist es her, daß ich mich hier niederließ. Mein Geschäft hat einen glänzenden Aufschwung genommen, aber was kümmerten mich noch meine Reichtümer, wenn ich meine kleine, süße Inez verloren hätte? Sie allein ist es, für die ich lebe und arbeite, sie ist meine einzige Freude, seit ich vor drei Jahren meine geliebte Gattin zu Grabe tragen mußte.« Lehmanns Frau war die Tochter eines reichen spanischen Kolonisten aus Caracas gewesen und hatte ihm ein einziges Töchterlein hinterlassen, die nunmehr sechsjährige Inez. Es läßt sich begreifen, zu welchem Dank sich der liebende Vater den Rettern seines einzigen Kindes verpflichtet fühlte.
Als er erfuhr, daß die Jünglinge sich in das Gebiet des Amazonenstromes begeben wollten, um ihren Vater aufzusuchen, wandte er alle Überredungskunst an, sie von diesem Vorhaben abzubringen: er schilderte ihnen die tausend Gefahren der Reise; er erbot sich, einen Boten an Friedung zu schicken und bis zu dessen Rückkehr die Knaben bei sich zu behalten. Friedung käme dann gewiß, sie persönlich abzuholen.
Es war aber alles umsonst: sowohl Ulrich als Friedrich zeigten sich allzu ungeduldig, den Vater wiederzusehen, und Furcht vor den geschilderten Gefahren war ihnen nicht beizubringen.
Die nächsten zwei Tage jedoch mußten die Jünglinge zur Erholung bei Herrn Lehmann verweilen. Diese Zeit benutzte ihr freundlicher Wirt, um sie über alles aufzuklären, was ihnen für die Reise wissenswert sein konnte. Dabei belehrte er sie nicht bloß über die Vorsichtsmaßregeln, die zum Schutze vor wilden und giftigen Tieren notwendig seien, sondern machte sie auch hauptsächlich mit den verschiedenen Pflanzen und Bäumen vertraut, die ihnen reichliche Nahrung auf der Reise bieten konnten.
»Viel Proviant könnt ihr nicht mitnehmen,« sagte er, »wer aber nur die Fülle der köstlichen Nahrungsmittel einigermaßen kennt, die die üppige Pflanzenwelt dieser Länder allerwärts hervorbringt, der kommt kaum in Gefahr, Hunger leiden zu müssen. Auch Wild gibt es fast überall in reichlicher Menge, nur leider auch sehr gefährliches!«
Die Pflanzen und Bäume, die Herr Lehmann sie kennen lehrte, wuchsen meist auf seiner ausgedehnten Besitzung, so daß er ihnen alles anschaulich einprägen konnte. Auch versäumte er nicht, sie für den Notfall zu unterweisen, wie man auf indianische Weise Feuer anzündet; er zeigte ihnen die geeignetsten Bäume, in deren Holz, wie der Indianer sagt, Feuer wohnt, und übte sie in den nötigen Kunstgriffen. Ihr deutsches Gold wechselte er ihnen in einheimische Münze ein, wobei er eine bedeutende Summe zulegte unter dem Vorwande, deutsches Gold stehe hier sehr hoch im Kurse. Schließlich nötigte er die Jünglinge, zwei prächtige Maultiere aus seinen Stallungen ›als kleinen Beweis seiner Dankbarkeit‹ anzunehmen. Ohne diese Tiere, versicherte er, sei die Reise überhaupt nicht zu machen, und er habe deren übergenug. Das war ein wertvolles Geschenk, denn die Mittel unserer jungen Freunde hätten ihnen eine Ausgabe von etwa zweitausend Mark für zwei solche Tiere unmöglich gestattet.
Am 5. Oktober begleitete Herr Lehmann die Brüder nach Puerto Cabello, half ihnen noch bei den notwendigsten Einkäufen und brachte sie abends in einem Gasthofe unter, worauf er sich aufs herzlichste von ihnen verabschiedete und die Hoffnung auf ein späteres Wiedersehen aussprach. Ganz besonders empfahl er ihnen noch Vorsicht in Hinsicht auf die gegenwärtigen kriegerischen Ereignisse; dann mußte er sie schweren Herzens ihren weiteren Schicksalen überlassen.
ZUM Nachtessen begaben sich unsere Freunde in den Treppenflur der Posada, wie man in Venezuela die besseren Gasthöfe nennt, während die geringeren Schenken »Pulperia« geheißen werden. Der Flur war, wie gewöhnlich hierzulande, gleich einer Veranda der Straße zu offen. Ein buntes Treiben herrschte da draußen in der Dämmerung; die Menschen selber, die da teils zu Fuß, teils auf Pferden, Eseln oder Maultieren vorüberzogen, wiesen alle nur möglichen Schattierungen der Hautfarbe auf, da die Bewohner Venezuelas in der überwiegenden Mehrzahl Mischlinge sind, nämlich Mulatten, die von Weißen und Negern, und Mestizen, die von Indianern und Weißen abstammen. Dazwischen waren aber auch die rein weißen, schwarzen und braunen Rassen vertreten. Ohne lautes Schreien, Kreischen und Lachen geht es bei den Venezolanern nicht ab, und so herrschte ein fast betäubender Lärm. Die Knaben unterhielten sich daher notgedrungen mit lebhafter Stimme. Ihr Gespräch drehte sich natürlich vorzüglich um die bevorstehende Reise und ihren Vater.
An einem kleineren Marmortisch ganz in ihrer Nähe saß ein tiefbrauner Mestize mit breitrandigem Hut und grellfarbiger Kleidung. Seine schwarzen Augen hatten einen stechenden, unsteten Blick. Er schien mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, zeigte aber von Zeit zu Zeit eine lauernde Unruhe und blickte scharf nach dem Eingänge der Veranda, als ob er jemand erwarte. Plötzlich flog der Ausdruck staunenden Interesses über sein Antlitz. Er hatte den Namen von Friedungs Farm von den jungen Deutschen aussprechen hören. Von diesem Augenblick an betrachtete er seine Nachbarn mit größter Aufmerksamkeit, wobei seine Augen in unheimlichem Glanze leuchteten. So scharf er aber auch hinhorchte, so verstand er doch nichts von dem Gespräche, da es in deutscher Sprache geführt wurde.
Eine Zeitlang schien der Mestize mit sich zu kämpfen, dann stand er rasch entschlossen auf und näherte sich unseren Freunden. Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich, daß seine nagelneuen Stiefel vorn ausgeschnitten waren und die großen Zehen durchblicken ließen. Der Venezolaner liebt es, bequem in den Stiefeln zu stecken, und da das Schuhwerk durchweg Fabrikware ist und nie nach Maß angefertigt wird, schämt sich auch der Vornehmste nicht, durch einen kühnen Messerschnitt seine zu engen Stiefel zu erweitern. Der Mestize schien das Erstaunen der Jünglinge nicht zu bemerken, die bei seiner sonst eleganten Erscheinung die ihrer Ansicht nach mangelhafte Fußbekleidung auffällig fanden. Er stellte sich mit einer Verbeugung vor als Don José de Alvarez und fragte, ob die Herren nicht Spanisch verstünden. Friedrich beeilte sich, zu bejahen.
»Ich hörte Sie den Namen Nueva Esperanza aussprechen; das interessiert mich, denn ich kenne eine Farm dieses Namens in der Nähe von San Paulo de Olivença am oberen Amazonas. Die Farm ist vor wenigen Monaten von einem Deutschen namens Friedung gegründet worden.«
»O! welch ein Glücksfall!« rief Friedrich lebhaft aus. »Können Sie uns Nachricht geben von unserem Vater? Kennen Sie ihn?«
Don Joses Gesicht verfinsterte sich. »Ist Don Friedung Ihr Vater?«
»Gewiß! Wie geht es ihm?«
»Ich bedaure, den Herren keine guten Nachrichten geben zu können: kurz ehe ich vom Süden aufbrach, wurde seine Farm von den wilden Napoindianern vollständig verwüstet.«
»Und er selbst?« rief nun Ulrich atemlos.
Don Alvarez zuckte die Achseln: »Was den Mann betrifft, so kann ich Ihnen über sein Schicksal keine weitere Auskunft geben. Er wurde weder tot noch lebendig gefunden.«
»Ihr zerreißt unser Herz!« rief Friedrich schmerzlich. »Erst unsere Mutter verloren und nun das Unglück des Vaters vernehmen! Um so mehr werden wir eilen müssen mit unserer Reise, um ihn zu suchen, und so Gott will, gesund zu finden!«
Alvarez sah die Knaben erstaunt an: »Ihr wollt die Reise nach dem Amazonas unternehmen?« sagte er mit spöttischem Lächeln. »Da besinnen sich Männer, und ihr seid, mit Verlaub, noch halbe Knaben.«
»Dennoch unternehmen wir sie, und zwar morgen schon, und keine Rast werden wir uns gönnen, ehe wir nicht das Geschick des geliebten Vaters kennen.«
»Das Land ist voller Krieg und Aufruhr, der Weg führt durch die Urwälder des Orinoko. Ihr kennt die Gefahren nicht, denen ihr unfehlbar zum Opfer fallen würdet.«
»Wir kennen sie und scheuen sie nicht,« sagte Friedrich stolz.
Don José murmelte einen Fluch und begab sich an seinen Tisch zurück.
Unseren Freunden wurde nun das Nachtessen aufgetragen. Zuerst die Sancoche, das unvermeidliche Landesgericht, eine sehr kräftige Suppe, die aus Fleisch, Yams, Yukka, Bataten, Bananen, Ocumo, Auyama, Apio, Kohl und andern Einlagen zusammengekocht wird; dann folgten verschiedene Braten, Gemüse, Fische und köstliche Früchte aller Art. Als Getränk ließen sie sich den ihnen schon von Herrn Lehmanns Landhaus her bekannten Guarapo schmecken, einen vorzüglichen, erfrischenden, gegorenen Saft aus Zuckerrohr.
Sie hatten die Mahlzeit noch nicht beendet, als ein Bote von Herrn Lehmann ihnen ein Brieflein überbrachte. Ihr väterlicher Freund bat sie, noch den kommenden Tag in Puerto Cabello zu verweilen, da soeben einer seiner Diener von einer Geschäftsreise zurückgekehrt sei, der ihnen als Führer bis San Fernando de Apure dienen könne. Lehmann hatte sie ungern ohne Führer reisen lassen wollen, aber Manuel war der einzige unter seinen Leuten, der den Weg bis San Fernando kannte und völlig zuverlässig war. Er war nun bälder als erwartet wiedergekommen und wollte gerne die Führung der jungen Leute übernehmen.
Obgleich die Verzögerung, namentlich nach den neuesten aufregenden Nachrichten, unseren Freunden nichts weniger als angenehm war, sagten sie sich doch, daß die Begleitung eines wegekundigen Führers ihnen ein um so rascheres Vorwärtskommen ermöglichen werde, und so gaben sie zusagende Antwort, zumal der folgende Tag ein Sonntag war, und sie Sonntags nicht ohne Not reisen wollten.
Der Mestize Don José de Alvarez hatte sich von diesen Vorgängen nicht das geringste entgehen lassen: er horchte und beobachtete immerfort.
Als nun die Knaben gingen, ihre Ruhestätten aufzusuchen, bemerkte Ulrich zu Friedrich: »Hör einmal, der Kerl mit den zerrissenen Stiefeln gefällt mir ganz und gar nicht: er hat etwas Falsches und Stechendes im Blick; du hättest ihm nicht so vertrauensselig über alle unsere Pläne und Umstände Auskunft geben sollen!«
»Ach was!« erwiderte Friedrich sorglos. »Was sollte der Mann uns anhaben wollen? Und wenn auch: übermorgen entfernen wir uns aus seinem Bereiche. Übrigens konnte ich nicht wohl anders, als ihn über unsere Verhältnisse aufklären, da er doch Vater kennt und uns Mitteilungen über ihn machen konnte, wenn auch höchst betrübende.«
DON José de Alvarez saß stets noch wartend und immer unruhiger werdend an seinem Marmortisch. Ein Glas Wein um das andere stürzte er hinunter, und aufgeregte Flüche entquollen seinen dicken Lippen. Da drängte sich ein Mann an ihn heran, ebenfalls ein Mestize von nicht weniger unheimlichem Aussehen als Don José. Ein dünner Bart jedoch umrahmte sein kupferfarbenes Antlitz, während Alvarez ein glattrasiertes Gesicht zur Schau trug.
»Caramba, Diego! Ich glaubte, ihr kämet nicht mehr! Was laßt ihr mich so lange warten, und wo bleibt Lopez?«
»Hier ist er in Person,« erwiderte ein hagerer Mestize von weit hellerer Farbe als die beiden anderen. Lopez schien mehr spanisches Blut in den Adern zu haben als die Genossen, und sein lang aufgewirbelter Schnurrbart im Verein mit dem schmalen Spitzbarte gaben ihm das Aussehen eines altspanischen Granden oder Edlen, obgleich es ihm nicht gelingen wollte, sich einen Anstrich echt spanischer Grandezza, das heißt Vornehmheit, zu geben.
»Nun, Don José,« nahm Diego das Wort, nachdem die beiden sich am Tische niedergelassen, »bist du wieder im Lande und von deinen Eldoradophantasien geheilt, wie ich hoffe? Wir glaubten nicht, dich lebend wieder zu schauen.«
»El Dorado ist kein Wahn,« sagte Alvarez flüsternd mit wichtiger Betonung: »Ich sage euch, ich bin der Goldstadt auf der Spur und kam, euch mit hinüber zu nehmen; denn für einen einzelnen Mann ist das Unternehmen zu schwer.«
»Was sagst du?« rief Lopez erstaunt. »Du willst sichere Kunde von El Dorado haben, das unsere Vorfahren umsonst suchten, und an das kein Mensch mehr glaubt?«
»Still, still!« mahnte Don José den lauten Gefährten: »El Dorado steht heute noch, die herrliche Goldstadt, daran zweifle ich nicht mehr. Aber niemand darf mein Geheimnis wissen außer euch beiden.«
Wenn der Mestize von El Dorado als von einer Stadt redete, so kam dies daher, daß er die zurzeit verbreitete volkstümliche Anschauung teilte, die ganz vergessen hat, daß »El Dorado« eigentlich »Der Vergoldete« heißt und einen indianischen Priesterkönig, nie aber eine Stadt oder gar ein Land bezeichnet. Die Kunde von der märchenhaften Goldstadt fand übrigens bei den Gefährten Don Joses zunächst wenig Glauben, wie aus ihren Einwänden deutlich hervorging.
»Phantast!« spottete Diego. »Binde uns alten Praktikern kein Märchen auf. Haben nicht vor Jahrhunderten, als die Kunde noch lebendiger war, Tausende den ganzen Süden durchstreift und ihr Leben gelassen, ohne die sagenhafte Goldstadt zu finden; wie wäre es möglich, daß sie bis heute verborgen blieb?«
»Und ich bleibe dabei, die Indios vom Napostamme wissen von El Dorado; aber sie hüten das Geheimnis wie das Grab. Allein ich habe nicht umsonst jahrelang unter ihnen gewohnt, um ihr Geheimnis zu erschleichen. Ich gewann ihr Vertrauen, — und dennoch, was ich weiß, mußte ich heimlich erlauschen und aus zufälligen Äußerungen und Beobachtungen mir zusammenreimen. So viel ist sicher: die Goldstadt mit ihren unermeßlichen Schätzen liegt irgendwo im Nordwesten des Amazonas; kein Napo hat sie erschaut, aber sie stehen in Verbindung mit den geheimnisvollen Hütern der Stadt, die die Indios so gut und noch besser zu verbergen verstanden, als ihre Silberminen in den Kordilleren.«
»Geh mir weg!« meinte Lopez verächtlich: »Silberminen lassen sich verschütten, und doch wird manche wieder aufgefunden; aber eine ganze Stadt verstecken, noch dazu eine weithin leuchtende Goldstadt — nein! das magst du anderen weismachen, aber keinem Lopez! Eine solche Stadt, wenn sie anders vorhanden wäre als in der Vorstellung kindischer Indianer, müßte schon längst entdeckt sein.«
»Narr! Die Stadt liegt von Natur verborgen auf einer unzugänglichen Hochebene; sie ist rings von einem Felsengürtel umgeben, der sie den Blicken entzieht. Die Kunde von ihrer Lage wird von den Eingeweihten verheimlicht, und den Zugang haben sie derart verborgen, daß kein Uneingeweihter ihn finden kann. Und überdies, wie sollte die Stadt entdeckt worden sein, da sie in einer Gegend liegt, die noch keines Weißen Fuß betrat?«
Don José sprach so bestimmt, daß die andern, deren Zweifel schon im Schwinden waren, während gierige Hoffnung aus ihren Augen leuchtete, sich weiterer Einwände enthielten und sich überzeugen ließen, daß an den Behauptungen des Genossen etwas sein müsse.
»Die Napo,« fuhr Alvarez fort, »sind sehr mißtrauisch, besonders da, wo es sich um das große Geheimnis handelt, von dem nur ihre Ältesten etwas Genaueres zu wissen scheinen. Ich selber konnte bloß dadurch in engere Verbindung mit ihnen treten, daß ich ihnen nachwies, daß meine Mutter eine Tochter ihres Stammes war. Dennoch hütete ich mich bisher wohl, sie irgend etwas von meinen Plänen ahnen zu lassen; der leiseste Verdacht hätte verderblich werden können. Dafür habe ich erst jüngst einen schlagenden Beweis erhalten. Da hatte sich nämlich zu meinem großen Ärger ein Deutscher in der Nähe des Stammes niedergelassen. Ich fürchtete gleich, er führe auch etwas im Schilde, was meinen Absichten ähnlich sei; denn wer läßt sich sonst in jenen Wildnissen nieder? Ich suchte ihn auszuforschen, aber der Mann hatte eine verdammt scharfe Art einen anzusehen, als ob er einem die verborgensten Gedanken aus der Seele lese. Kurzum, ich brachte nichts aus ihm heraus und merkte, daß er mir nicht gewogen sei. Wir kamen auch einige Male bös hintereinander. Jedenfalls konnte ich einen solch schlauen Aufpasser nicht in der Nähe brauchen, zumal er eine merkwürdige Kunst besaß, die Herzen der Napo zu gewinnen. Wer weiß, wenn ich länger zugewartet hätte, es wäre ihm vielleicht einmal gelungen, mich selber den Indios verdächtig zu machen.
»Ob er nun El Dorado ausspionieren wollte oder nicht, ich beschloß, ihn beizeiten aus dem Wege zu räumen. Ich versuchte zunächst, dem Manne Furcht einzujagen, das wollte mir aber nicht gelingen; dann begann ich mit einigen wilden Burschen seinem Rancho nächtliche Besuche abzustatten, die junggepflanzten Bäume abzuschneiden und seine Arbeit möglichst zu verderben, um ihm die Sache zu verleiden. Aber der Schurke war schlau; er erwischte mich eines Nachts und bekam mich in seine Gewalt, während die Rothäute vor seinem Feuerrohr entflohen. Er hat mir einen Denkzettel gegeben — Carajo!« Alvarez knirschte mit den Zähnen vor Wut: »Er hat mich durchgepeitscht wie einen Sklaven oder einen Hund und ließ mich dann springen. Damals habe ich ihm den Tod geschworen und zwar einen Tod mit ausgesuchten Qualen. O! daß ich meine Rache nicht voll befriedigen konnte!
»Ich suchte nun die Rothäute gegen den Kerl aufzuhetzen. Das ging leichter, als ich dachte. Die Napo hatten gesehen, daß ich viel mit dem Manne verkehrte. So nahm ich denn eine Gelegenheit wahr, den Häuptlingen zu berichten, ich habe das Bleichgesicht ausgeforscht und erfahren, es sei in die Wildnis gekommen, um ein Geheimnis der Indios auszukundschaften: er habe aus alten Büchern erfahren — die Indios haben einen gewaltigen Glauben an die rätselhafte Weisheit unsrer Bücher —, daß es irgendwo in der Nähe eine uralte goldene Stadt gebe, die wolle er ausspüren und dann ein ganzes Volk von Weißen heranziehen, um sie zu erobern. Dabei tat ich, als ob ich selber kein Wort von der Goldstadt glaube. Aber keine zwei Tage vergingen, so war dem Deutschen sein Rancho von den Napo dem Erdboden gleichgemacht und seine Hacienda in Flammen aufgegangen.«
»Und der Deutsche wurde erschlagen?« fragte Diego aufs höchste gespannt.
»Carajo! wenn ich das bestätigen könnte! Der Mann ist auf unerklärliche Weise verschwunden. Aber wenn er mir wieder unter die Augen kommt — — —! Er ist übrigens ein verdammt guter Schütze. Nun, ich glaube, der Aufenthalt in der Nähe der Napo ist ihm gründlich verleidet, und vorerst wenigstens ist er unschädlich gemacht. Ich hielt den Zeitpunkt für gekommen, euch zu holen, wie wir es vor Jahren ausgemacht haben; ich stehe mehr denn je im Ansehen bei den Indios, und wenn ihr klug seid, wird es mir leicht werden, auch für euch ihr Vertrauen zu gewinnen. Sechs Augen und sechs Ohren sehen und hören immerhin mehr als zwei, und ich zweifle nicht daran, daß wir durch List in nicht allzuferner Zeit die genauere Lage von El Dorado erfahren werden, und dann lasset mich nur machen: ich sage euch, wir kehren heim als die reichsten Leute des Weltteils.«
»Das heißt, wenn wir überhaupt heimkehren!« schaltete Lopez ein.
»Hast du Angst?« spottete Don José.
»Angst?!« rief Lopez. »Wo es sich um Gold handelt, nehme ich es mit allen Teufeln auf!«
»Aber nun noch eines,« nahm Alvarez wieder das Wort. »Da treffe ich vorhin zwei deutsche Milchbärte, und was höre ich? Es sind die Söhne jenes Friedung, die ihren Vater aufsuchen wollen. Ich weiß nicht recht warum, aber es ist mir unangenehm, die Jungen in unserer Nähe zu wissen. Sie sind zwar harmlos und naiv, der jüngere wenigstens; der ältere sah mich mißtrauisch an und zeigte die durchdringenden Augen seines Vaters. Mögen sie noch so ungefährlich sein — wer weiß, wenn sie erfahren, daß ich ihres Vaters Unglück herbeiführte ... Dazu kommt, daß bei den Napo auch ein Häuptling namens Blitzhand ist, der Friedung gewogen schien und mir mißtraute. Kurz und gut, wir müssen die Knaben unschädlich machen, aber wie?«
»Nichts leichter als das!« erwiderte Diego. »Das Volk ist erbittert gegen die Deutschen.«
»Wieso?« fragte Don José verwundert.
»Nun,« erklärte Diego, »es ist ja eine alte Geschichte, daß die Fremden, die immer die besten Geschäfte machen und immer Zahlung für ihre Waren fordern, bei uns verhaßt sind. Gegenwärtig herrscht aber noch eine ganz besondere Wut auf die Deutschen, und das ging so zu: Da war in Caracas ein angesehener Deutscher, Georg Schlüter, und mit dem bekam unseres Freundes Bruder, den du ja auch kennst, Don Luis Felipe Lopez, Händel auf offener Straße. Don Louis tat, was jeder von uns getan hätte, er zog seinen Revolver und jagte dem Deutschen etwas Blei zwischen die Rippen.«
»Und was nun?« forschte Alvarez neugierig.
Lopez beeilte sich weiter zu berichten: »Für unsereinen ist das ja nicht der Rede wert, passiert fast alle Tage; aber diese überempfindlichen Deutschen spielen gleich die Beleidigten und rennen vor Gericht. Schlüter hatte das Unglück, auf der Stelle tot zu sein, und nun setzten es die Dickköpfe durch, daß mein Bruder ins Gefängnis wanderte. Dort sitzt er nun seit sechs Monaten: ist so etwas erhört? Der Präsident paßt immer auf eine gute Gelegenheit, ihn freizulassen; aber die Deutschen geben keine Ruhe, und nun haben sie gar ein Kriegschiff in unserm Hafen. Darüber herrscht allgemeine Verbitterung; denn wohin käme es mit unsrer Freiheit, wenn eine weltfremde Macht sich derart in unsere inneren Angelegenheiten mischen dürfte? Soll es uns nicht einmal mehr gestattet sein, auf einen frechen Fremden zu schießen, der uns beleidigt?«
»Nun aber vernehmt meinen Plan,« nahm Diego wieder das Wort. »Wir streuen unter der Menge aus, die jungen Deutschen seien Schlüters Söhne, die in Deutschland erzogen wurden, und seien mit dem Kriegschiff gekommen, um an Don Luis Felipe blutige Rache zu nehmen. Das genügt, um die Leute gegen die Knaben aufzuhetzen, und ihr sollt sehen, morgen abend sind sie so tot wie der Georg Schlüter.«
»Das läßt sich hören!« stimmte Alvarez bei. »Und weil ich am Vater meine Rache nicht völlig kühlen konnte, so wird es mir eine Lust sein, ihn seiner Söhne zu berauben; das wird ihn tiefer treffen, als eine Kugel ins Herz. Von nun an heißt meine Losung: Tod den Söhnen Friedungs! Also, ans Werk!«
AM 6. Oktober in der Frühe schlenderten Ulrich und Friedrich durch die Stadt. Zunächst sahen sie sich den Markt an und wunderten sich über die große Menge prächtiger Früchte, die vor den dicken Negerweibern mit ihren häßlichen, verschrumpften Gesichtern in großen Haufen aufgestapelt waren. Mit den meisten dieser Früchte hatte sie Herr Lehmann gar nicht bekannt gemacht, einmal deshalb, weil viele dieser erfrischenden Erzeugnisse dem Neuling in den Tropen unzuträglich sind, indem sie eine Erkältung des Magens hervorrufen und dadurch leicht gelbes Fieber und Dysenterie verursachen; sodann, weil es ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, innerhalb weniger Tage den ganzen Reichtum tropischer Nahrungsmittel kennen zu lernen.
Da lag die gewaltige, goldleuchtende Pina neben der kopfgroßen runden Mamey, die goldgelbe Mango, die grüne birnenförmige Aguakate, die geschuppte Cherimoya, deren herrlicher Duft das Riechorgan erquickte, die feigenähnliche Anona, die zapfenförmige, stachelige Guanabana, die gelbe apfelartige Guayaba, die quittenförmige Membrillo, die glänzend scharlachrote Merey mit ihren nierenförmigen Samenauswüchsen, die gelbbraune Caimito und Nispero, die eirunde grüne Caruto, die pflaumenartige dunkelviolette Ciruela, die grüne traubenförmige Mamon und die Cotoperi, die runde rotbackige Granada, die weiße Icaco, die melonenförmige gelbe Lechosa und Parcha, die länglichrunde braune Zapota, die vielen Arten goldgefärbter Naranja, Lima, Limaza und Limone von Hühnerei- bis Menschenkopfgröße, die Kokosnüsse, die gurkenförmigen Camburen und Platanen nebst unzähligen Knollen- und Küchengewächsen, Tomaten, Kürbissen, Wurzeln und Beeren.
Das Anstaunen dieser unendlichen Fülle von Herrlichkeiten wäre unseren Freunden bald übel bekommen. Die Marktweiber tuschelten erst leise, dann schrien und schimpften sie laut, und daß diese Wut niemand anders als den jungen Gaffern galt, die es wagten, alles zu betrachten, ohne etwas zu kaufen, das merkten die harmlosen Brüder erst, als sie mit starken Zuckerrohrstangen von den schwarzen Hexen tätlich bedroht wurden. Eilig begaben sie sich hinweg, wagten es auch nicht, sich auf dem hochinteressanten, aber stark duftenden Fischmarkt aufzuhalten, sondern wandten sich durch die breiten, gepflasterten Straßen an den großartigen Warenmagazinen vorbei dem Hafen zu.
Hier verwunderten sie sich über den eigenartigen Anblick, den die Manglegebüsche gewährten: die Mangroven oder Manglaren erheben sich auf stelzenartigen Luftwurzeln bis zu 30 Meter über den Wasserspiegel; aus ihren Ästen senken sich wiederum zahlreiche Wurzeln ins Meer und bilden neue Pflanzen, so daß ein einziger Mutterstamm ein ganzes Wäldchen erzeugt und sich weit ins Meer hinein zieht. Das merkwürdigste aber ist die Verworrenheit der festen Wurzeln, die unter dem schattigen Laubdach leicht zu begehende Wege über dem Meeresspiegel bilden. Zwischen den Bäumen und Wurzelbrücken bildet das Wasser eine Unmenge von Kanälen.
Ulrich und sein Bruder schritten neugierig über das Wurzelwerk weit in den Hafen hinein. Zu ihren Füßen wimmelte es im Wasser zwischen den Wurzeln von blauen und roten Krabben und anderen Seetieren; massenhaft hingen die Austern in dem Geflecht. Als die beiden Wanderer die äußerste Grenze des Gebüsches erreicht hatten, sahen sie den offenen Hafen und das weite Meer vor sich liegen. In der Ferne schaukelte das deutsche Kriegschiff Vineta, und unter den vielen größeren und kleineren Schiffen in nächster Nähe, unmittelbar am Hafenkai, bemerkten sie ein zweites deutsches Schiff, den Postdampfer Valesia.
Gar zu gern hätten sie einige deutsche Landsleute begrüßt, sie gingen daher wieder zurück, um das Ufer zu gewinnen; aber die Wurzelbrücken waren so zahlreich, daß sie sich bald im Manglebusch verirrt hatten und lange Zeit brauchten, um wieder hinauszufinden.
Inzwischen hatten sie Hunger bekommen und begaben sich zunächst in eine Posada, eine Mahlzeit einzunehmen. Hier trafen sie einige Matrosen der Valesia beim Guarapotrunk. Der leicht gegorene Guarapo läßt sich literweise vertilgen, ohne daß dies angenehme Getränk die Sinne umnebelt, während der »Guarapo fuerte« berauschende Eigenschaften entwickelt. Die Matrosen begnügten sich mit dem leichten Trank, um bei der herrschenden Hitze desto mehr vertilgen zu können. Freudig begrüßten sie die Knaben, als diese in deutscher Sprache um Erlaubnis baten, bei ihnen Platz nehmen zu dürfen. Bald entspannen sich lebhafte Gespräche und besonders der Bootsmannsmaat der Valesia schloß Freundschaft mit den jugendlichen Landsleuten. Er lud sie ein, ihn auf das Schiff zu begleiten, ein Anerbieten, das unsere Freunde gerne annahmen. Auf dem Dampfer wurden sie von dem Kapitän und dem ersten Offizier freundlich empfangen, denen sie ihre Erlebnisse erzählen mußten. Auch einige Offiziere des Kriegschiffs Vineta lernten sie kennen, als diese im Laufe des Nachmittags in einem Boote zu Besuch auf die Valesia kamen.
Gegen Abend begleitete der biedere Bootsmannsmaat die beiden wieder an Land. Am Hafendamm bemerkten sie einige Venezolaner, die ihnen mit finstern, drohenden Blicken nachschauten, doch kümmerten sie sich nicht weiter um die Leute. In der Gruppe der Eingeborenen befanden sich die drei Mestizen. »Das sind sie!« sagte Don José, als das Boot mit den Knaben von der Valesia abstieß. Alvarez hatte die Jünglinge vom frühen Morgen an nicht aus den Augen gelassen und auch ihren Besuch auf dem Schiffe beobachtet. Eben dieser gab ihm Gelegenheit, die bereits verständigten Eingeborenen von dem Verdacht zu benachrichtigen und in ihrer Wut zu bestärken. Als aber die Leute sofort auf die Landenden einstürmen wollten, hielt er sie warnend zurück: »Laßt uns die völlige Dunkelheit abwarten und noch mehr Leute an uns ziehen: angesichts der Schiffe, und solange es noch hell ist, könnte uns eine Gewalttat verhängnisvoll werden; mit den Deutschen ist nicht zu spaßen!« Nur schwer ließ sich die Leidenschaft der Bande zügeln; doch sahen die Leute ein, daß Vorsicht ihnen selbst nur nützlich sein könnte, und so folgten sie den Deutschen in einiger Entfernung.
Da die Zeit noch nicht da war, in der sie nach Herrn Lehmanns Mitteilung den von ihm versprochenen Führer erwarten durften, der in der Stadt übernachten und in aller Frühe mit ihnen aufbrechen sollte, ließen sich Ulrich und Friedrich durch den Bootsmannsmaat überreden, noch einen Abschiedstrunk in der Posada am Hafenkai zu halten. Hier fanden sie wiederum einige Matrosen und Unteroffiziere der Vineta, sowie Matrosen der Valesia.
Es war schon völlig dunkel geworden, als die Schiffsleute aufbrachen, um sich an Bord zurück zu begeben. Ihre jungen Freunde gaben ihnen noch das Geleite bis zur Landungsbrücke.
Unterdessen hatten die Mestizen einen Pöbelhaufen um sich versammelt, der in größter Erregung nach dem Blute der jungen Deutschen begehrte; wahrlich, wenig gehört dazu, die südlichen Leidenschaften bis zu tödlichem Hasse zu erhitzen!
Don José hätte gern abgewartet, bis die Matrosen sich von seinen ausersehenen Opfern getrennt hätten; da aber die Leute nicht anders glaubten, als die Jünglinge wollten sich auch an Bord begeben, umzingelten sie rasch die ganze Schar, die gegen den Hafendamm zog. »Nieder mit den Verrätern! Nieder mit den Attentätern auf unsere heilige Freiheit! Nieder mit den deutschen Hunden!« so erschollen die wilden Rufe der Venezolaner. Messer, Gewehre und Revolver blitzten rings um die unbewaffneten Deutschen. Diese wehrten sich zwar mit gewaltigen Faustschlägen, die manchen der Feinde zu Boden streckten, und auch Ulrich und Friedrich kämpften mit Gewandtheit und Kraft. Aber Schüsse fielen, und der Bootsmannsmaat, der sich soeben schützend vor die Knaben geworfen hatte, als er drohende Revolverläufe auf sie gerichtet sah, brach, von zwei Kugeln getroffen, zusammen.
Der Postdampfer Valesia hatte mit Einbruch der Dunkelheit hart an der Brücke angelegt; dieser Umstand sollte die Rettung unserer Freunde werden. Die Fallreepstreppe war schon früher hinuntergelassen worden, um den heimkehrenden Matrosen den Aufstieg an Bord zu ermöglichen. Kaum vernahm man auf der Valesia den Tumult am Ufer, als der zweite Offizier mit mehreren Leuten der Bemannung den Bedrängten zu Hilfe eilte. Beim unerwarteten Erscheinen der bewaffneten Matrosen wichen die Venezolaner einen Augenblick zurück. Im Nu war der Bootsmannsmaat mit anderen Verwundeten ergriffen und an Bord getragen, während die befreiten Matrosen, unsere Freunde in der Mitte, die Eingangstreppe emporstürmten. Aber noch ehe die Treppe emporgezogen werden konnte, drängte die Mordbande, die ihre Opfer entkommen sah, in höchster Wut nach. Der erste Offizier der Valesia, der mit den auf Besuch an Bord weilenden Offizieren der Vineta bei Beginn des Kampfes ahnungslos im Salon gesessen hatte, gab nun den Befehl, die Fallreepstreppe zu besetzen. Dieser Befehl wurde sofort ausgeführt und die Venezolaner kollerten beim geschlossenen Anrücken der Deutschen hilflos die Treppe hinab. Gleichzeitig wurde aber vom Lande aus mehrmals auf den seine Befehle erteilenden Offizier geschossen. Glücklicherweise waren die Schützen nur auf zwei Schritt Entfernung ihres Zieles sicher, und so richteten die Kugeln weiter keinen Schaden an.
Inzwischen wurden auf Befehl des Kapitäns auf dem Achterdeck Raketen und Notsignale abgebrannt. Die Mestizen, die wohl bemerkten, daß damit die Aufmerksamkeit des Kriegschiffes erregt werden sollte, schossen von einem Pavillon aus, in den sie sich zurückgezogen hatten, sobald die Sache ernst wurde, auf den zweiten Offizier, der das Abbrennen der Signale beaufsichtigte. Allein trotz der guten Beleuchtung ihres Zieles hatten sie keinen Treffer aufzuweisen. Nach einer kurzen halben Stunde traf ein Kutter der Vineta ein, bemannt mit bewaffneten Matrosen unter Führung eines Offiziers. Nun wurde die Valesia in regelrechten Verteidigungszustand gesetzt. Ein Teil der Leute wurde an Land beordert, während der Hafendamm durch den Scheinwerfer der Vineta taghell erleuchtet wurde. Nun war es lustig zu sehen, wie das Gesindel schleunigst die Flucht ergriff und jeden Schlupfwinkel aufsuchte, als es das verdächtige Geräusch der klappernden Gewehrkammern vernahm. Bis gegen Mitternacht sah man zwar noch einzelne Banden von Zeit zu Zeit heranschleichen; der Anblick der blinkenden Gewehrläufe auf dem Achterdeck der Valesia bewog sie jedoch stets wieder zu beschleunigtem Rückzug.
Don José beobachtete übrigens abwechselnd mit seinen sauberen Gesellen die ganze Nacht hindurch vom Pavillon aus das Schiff, um sich die Knaben nicht entgehen zu lassen, sobald sie es verlassen würden. Als aber die Nacht und der nächste Vormittag vorübergingen, ohne daß sie sich blicken ließen, überzeugten sich die drei, daß der heilsame Schrecken die jungen Deutschen jedenfalls von ihrem verwegenen Plane abgebracht habe, und die beiden wohl mit dem Postdampfer in ihre weniger lebensgefährliche deutsche Heimat zurückkehren dürften. Sollten sie je dennoch späterhin die Reise unternehmen, so gab es in den Wildnissen des Orinoko und des Amazonas noch Gelegenheit genug, sie unschädlich zu machen.
Die drei Mestizen trafen denn vollends ihre Reisevorbereitungen, die für diese Leute wenig Zeit in Anspruch nahmen, und traten noch vor Abend die Reise nach dem Lande ihrer abenteuerlichen Hoffnungen an.
BEI Einbruch der Dunkelheit war Manuel, der Diener des Herrn Lehmann, der zum Führer unserer Freunde ausersehen war, in der Posada, in der sie herbergten, eingetroffen. Hier erfuhr er, daß die jungen Herren noch nicht wiedergekehrt seien. Als er vom Hafen her den großen Tumult und Schüsse vernahm, eilte er dorthin, teils aus Neugier, teils aus Besorgnis für seine neuen Herren. Manuel war gut bewaffnet und besaß, wenn auch wenig Mut, doch Schlauheit genug, um für sich nichts zu befürchten. Am Hafen angelangt, sah er den Rückzug der Deutschen nach der Valesia und den weiteren Verlauf der Dinge mit an. Aus der Auskunft, die er auf seine vielen Fragen erhielt, entnahm er, daß der Schlag hauptsächlich auf eben die jungen Herren abgesehen war, die er führen sollte, und er rechnete ganz richtig, daß man scharf aufpassen werde, ob diese das Schiff verlassen würden.
Schnell hatte er seinen Plan gefaßt; er eilte in die Posada zurück, in der er gut bekannt war. Dort ließ er sich die Maultiere der Deutschen vorführen und ihr Gepäck ausfolgen. Dies lud er einem dritten Maultiere auf, das ihm sein Herr zu diesem Zwecke noch mitgegeben hatte; dann begab er sich auf Umwegen durch einsame Gassen an die abgelegenste Stelle der Bucht, wo er die Tiere im Manglegebüsch verbarg und festband.
Hierauf bestieg er ein Boot, fuhr durch die Kanäle zwischen den Bäumen hindurch in den offenen Hafen und kam so, ohne von der Hafenseite aus gesehen werden zu können, der Valesia nahe.
Seine Annäherung wurde, so leise er ruderte, von einem wachsamen Posten bemerkt, und ein Gewehrlauf blinkte ihm drohend entgegen. Aber leise rief Manuel auf deutsch empor: »Gut Freund!« Von seinem Herrn, der meist mit der kleinen Inez Deutsch sprach, hatte er diese Sprache notdürftig gelernt, während seine Muttersprache das Spanische war.
»Was ist los?« fragte der wachhabende Offizier, der den Vorgang bemerkte. Als der Posten ihm Meldung erstattet hatte, beugte sich der Offizier vorsichtig über die Brüstung. Er sah alsbald, daß ihm von dem einzelnen Manne, der sein Gewehr im Boot niedergelegt hatte, keine Gefahr drohte, und erkundigte sich auf spanisch nach seinem Begehr. Manuel erwiderte, er wolle die jungen deutschen Herren abholen. Hierauf wurde er an Bord gehißt, und an seiner Stelle begab sich ein deutscher Matrose in den Nachen, um ihn in der Nähe zu halten.
Inzwischen saßen Ulrich und Friedrich ganz gemütlich in der Kajüte und plauderten mit dem Kapitän und den Offizieren.
»Ich möchte nur wissen, warum die Leute von Puerto Cabello uns in so großer Anzahl auflauerten und überfielen,« hub Friedrich an, der eine Weile nachdenklich dagesessen hatte: »wir gaben ihnen doch nicht den geringsten Anlaß.«
»Braucht's nicht bei diesem Pöbel!« erwiderte ein Offizier. »Sie glauben nicht, wie rasch sich das Blut dieser Kerls erhitzt; ein kleines Mißverständnis genügt ihnen, um Blut zu vergießen. Erst letzthin wurde ein Deutscher wegen nichts und wieder nichts ermordet. Nun, aus so was macht man ja keine Staatsaktion, wenn es nicht gerade ein Gesandter oder ein katholischer Missionar ist; aber diese verlotterten Republikaner zahlen auch keine Schulden. Geben Sie acht, wegen dieses Punktes geht es noch einmal los! So ist es in der modernen Diplomatie: solange die Türken bloß Armenier schlachteten, mischte sich keine europäische Macht ernstlich drein. Als es sich aber um ein paar tausend Franken handelte, die der Sultan nicht berappen wollte, flugs wurde eine französische Flotte mobil gemacht.«
»Ja, in Geldsachen hört die Gemütlichkeit auf!« lachte der Kapitän. »Ich glaube auch, daß die Borgwirtschaft der Venezolaner die längste Zeit gewährt hat. Man wird einmal mit einigen Kriegschiffen einen gelinden Druck ausüben, bis die Herren sich erinnern, daß Schuldenmachen eine schöne Sache ist, daß aber die Kehrseite mit dem Zahlen nicht ausbleibt.«
»Fabelhafte Gleichgültigkeit und Rücksichtslosigkeit zugleich bei diesen Mischlingen!« nahm der Offizier wieder das Wort. »Wie reich könnte dieses Land sein mit seinen unerschöpflichen Hilfsquellen; aber es ist kein Unternehmungsgeist, keine Tatkraft da, auf Händel verstehen sie sich, nicht aber auf Handel. Deshalb sind auch die meisten Kaufleute Ausländer. Diese würden die besten Geschäfte machen, — aber man bleibt ihnen alles schuldig, und wagen sie dagegen aufzubegehren, so erregen sie damit die leidenschaftlichste Volkswut, als ob sie wer weiß welche haarsträubende Ungerechtigkeit begingen, wenn sie ihr Guthaben fordern.
»Die Regierung ist schwach und hat unaufhörlich mit Revolutionen zu kämpfen; Präsident Castro ist überdies ein eitler Prahler, ein Mann der Worte und nicht der Tat; er tut, als fürchte er sich vor der ganzen Welt nicht und habe die Pflicht, die armen unschuldigen Schuldner gegen ihre Gläubiger zu verteidigen; dabei weiß er sich im eigenen Lande nicht zu helfen. Na, warte nur! Er verläßt sich immer darauf, daß man nicht Ernst mache und setzt daher allen Forderungen, Mahnungen und Drohungen leere Worte und Ausflüchte entgegen. Der Krug geht nicht mehr lange zum Brunnen! Und sobald wir ein klein wenig scharf auftreten, wird die Sache bald anders aussehen. So leidenschaftlich, rauflustig und großsprecherisch diese Republikaner sind, so feige sind sie im Grunde. Darum hört auch die Revolution nie recht auf; entscheidende Siege können nicht erfochten werden, wo es auf beiden Seiten an Mut und Entschlußkraft fehlt. Die Regierungstruppen haben so wenig Manneszucht wie die Rebellen. Soldaten? Ne! das gibt es da gar nicht: schauderhafte Zustände! Wenn wir einmal einige Kompanien landen — und so weit wird es wohl bald kommen —, da werden sie laufen wie die Hasen. Schade, daß die mittelalterlichen Eroberungszüge nicht mehr beliebt sind; hier könnten wir ohne viel Blutvergießen ein ausgedehntes, reiches Land erobern, für das es ein Segen wäre, wenn es einmal unter stramme Zucht käme.«
Während der Offizier noch redete, wurde Manuel in den Raum geführt. Er konnte sich als Diener Lehmanns ausweisen, hatte auch noch einen Brief seines Herrn den jungen Leuten zu überbringen. Dennoch erfolgte eine lange Beratung, ob man ihm unter den gegenwärtigen Umständen die Schützlinge der Valesia anvertrauen dürfe. Da aber diese ihre Reise nicht länger hinausschieben wollten und Manuel versicherte, er werde sie ungefährdet aus der Stadt bringen, hielten schließlich alle diesen Ausweg für den geeignetsten; eine Verzögerung der Abreise konnte Ulrichs und Friedrichs Lage nur verschlimmern, da sie nun einmal auf ihrem gefahrvollen Plane verharrten. So verabschiedeten sich denn Offiziere und Mannschaften aufs herzlichste von den mutigen Knaben, und der Kapitän ließ es sich nicht nehmen, jedem von ihnen ein Magazingewehr neuester Bauart zu verehren, und ihnen so viel Munition dazu mitzugeben, daß er scherzend meinte, damit könnten sie ganz Venezuela und Kolumbien von Rebellen säubern und noch dazu die Ungeheuer des Urwalds ausrotten.
Nachdem Manuel unsere Freunde durch die Manglekanäle gerudert hatte, bestiegen sie alsbald die am Ufer angebundenen Maultiere und trabten durch abgelegene Gassen aus Puerto Cabello hinaus. Der Führer schritt voran, das Lasttier mit dem Gepäck vor sich hertreibend. Sehr angenehm und erfrischend begrüßte die Reisenden draußen eine kühle Seebrise, von der man in den dumpfigen Straßen nichts gespürt hatte; dafür hatten sie nun aber auch unter den quälenden Stichen zahlreicher Stechmücken zu leiden, gegen die kein wirksames Schutzmittel bekannt ist, dafür aber eine Menge von solchen, die nichts helfen. Der rotbraune Weg, der vom zunehmenden Monde grell beleuchtet war, führte durch eine mit einer Salzkruste bedeckte Ebene, die sich in der Regenzeit in einen Morast verwandelt. Alles wimmelte von Krabben, und zu Tausenden ließen die Zikaden ihr eintöniges, schwermutsvolles Lied ertönen. Allmählich begann die Straße zu steigen und erreichte in einer Höhe von fünfundsiebzig Metern die Porta Chuela, den Eingang zum herrlichen Tale von San Esteban, wo die ausländischen Kaufleute ihre prächtigen Landhäuser angelegt haben.
Ein Blick zurück gewährte eine prachtvolle Aussicht auf das mondbeleuchtete Häusermeer von Puerto Cabello und die weite verdämmernde See. Dann nahmen unsere Freunde Abschied von der Küste; das Meer sollten sie für lange, lange Zeit zum letzten Male gesehen haben.
Unter Kokospalmen und Mimosen, an denen sich herrliche Aristolochien mit großen blau und purpurn schillernden Blüten emporschlängelten, ging es nun weiter. Die langen Blüten der Vanille erfüllten die Luft mit betäubendem Wohlgeruch. Unmöglich wäre es, die Menge der verschiedenartigen Bäume auch nur aufzuzählen, die in tropischer Üppigkeit den Weg säumten: alle Sorten von Palmen mit ihren zierlichen und doch großartigen Wedeln, Pisang mit ungeheuren vom Winde zerfetzten Blättern, Tausende von Camburen und Bananen, die in Venezuela »Platanos« genannt werden, und neben der Kassave den Eingeborenen ihr Brot liefern, standen in langen Reihen da. Dann verengte sich das Tal, und ein hoher Wald nahm die Reiter auf; dieser bestand aus einer einzigen Baumgattung, dem Buscare, dessen Schatten den Kakao- und Kaffeepflanzungen zum Gedeihen hier unbedingt nötig ist.
Der Morgen dämmerte bereits, als sich das herrliche Tal von San Esteban bei einer Wegbiegung plötzlich den Augen der entzückten Jünglinge zeigte. Mitten in den Urwald sind die leuchtenden Landhäuser der Europäer gebaut, überschattet von riesigen Kokospalmen, Bananen, Brotfruchtbäumen, Mango, Guayaba, Papaya und Paraiso. Im Hintergrunde erheben sich mächtige Gebirgsmassen, deren schöne Formen sich scharf gegen den klaren Himmel abheben. Bis zum Gipfel sind sie mit Urwald bedeckt, und noch in weitester Ferne sieht man deutlich die reizend-zarten Umrisse der hoch über die andern Bäume emporragenden Riesenpalmen. Gegen Süden türmt sich das Gebirge immer höher auf; besonders fallen die seltsamen hochzackigen Felsenformen des Burro Sin Cabeza und der fast siebzehnhundert Meter hohe Gipfel der Cumbre del San Hilario mächtig ins Auge.
Das Leben begann zu erwachen; das Gekreisch der fasanenähnlichen Huacharaca und der buntflatternden Papageien durchgellte die Stille, reizende Kolibri huschten von Blüte zu Blüte, das Gefieder wie mit leuchtenden Edelsteinen besät. Affen schwangen sich schwatzend und lärmend von Zweig zu Zweig. Unbeschreiblich reizvoll war der reiche Blumenschmuck, mit dem die zahlreichen Lianen, gleich wallenden Gewinden von Syringen aller Farben, die Riesen des Urwalds bekleideten. Ulrich und Friedrich vermochten nur zu schauen und zu genießen: gewiß, das Paradies der ersten Menschen konnte keinen größeren Reichtum an lieblichen und überwältigenden Reizen geboten haben!
Nun erreichten sie das Ufer des Rio de San Esteban, der, von dichten Gruppen der fast fünf Meter hohen »Canna brava«, eines Schilfrohres mit fächerartigen Blätterkronen und weißen Blütenbüscheln, dämmerig und geheimnisvoll überschattet, zwischen hohen Felsblöcken dahinrauschte. Ein Bad in den kühlen Fluten erfrischte unsere Freunde derart, daß sie von der Ermattung nach einer schlaflosen Nacht nichts mehr spürten; leider zwangen sie die unangenehmen Bisse zahlreicher kleiner schwarzpunktierter Fische, den Aufenthalt im Wasser bedeutend abzukürzen.
Glühend stieg die Sonne über das Gebirge empor, als der Weiterritt begann; allein bald wurde sie von Wolkenmassen verhüllt, die sich bleischwer ins Tal senkten. Ein heftiger Sturm erhob sich, und dann brauste der Regen als Wolkenbruch hernieder und durchnäßte die Wanderer bis auf die Haut. Erloschen waren all die glühenden Farben, grau und unheimlich blickte der Wald durch die Wasserfäden, und hoch schwoll der Fluß an. Nur kurze Zeit währte der Guß; dann zerrissen die Wolken und kletterten an den Bergen hinauf und bald schimmerte wieder der Himmel im reinsten, tiefdunklen Blau. Die Feuchtigkeit des Bodens lockte nun aber neue, widerliche Geschöpfe zutage: breite, fußlange Kröten, den Rücken mit rauhen Warzen bedeckt, plumpsten daher, unheimliche Tausendfüßler, entsetzliche Buschspinnen krochen über den Weg.
Das Wasser des Flusses sank wieder so rasch, wie es angeschwollen war, und mit der zunehmenden Wärme flatterten fledermausgroße, prächtige Schmetterlinge empor, Schlangen und Rieseneidechsen lugten aus dem Gebüsch, und aus dem Wasser tauchte der schwarzgrüne Kopf eines lauernden Alligators auf.
Der Weg stieg immer steiler zum über fünfzehnhundert Meter hohen Paß der Cumbre del San Hilario empor, und die Hitze wurde beinahe unerträglich.
Die alte Straße (el camino viejo), die über den Paß führt, während die neue um den Berg herum gebaut ist, machte einen ziemlich verwahrlosten Eindruck; um so schöner war die Aussicht, die man von der Höhe aus genoß. Auch die Pflanzen- und Tierwelt zeigte immer neue überraschende Formen, je höher unsere Freunde stiegen: da traten die zierlichen Baumfarne auf mit ihren großgefiederten hellgrünen Wedeln, und die herrliche Rosa de la montana, ein schlanker, bis zu fünfzehn Metern hoher Baum, dessen fußlange blaugrüne Blätter in gefiederter Anordnung die beinahe wagerecht abstehenden Aste besetzen, während die meterlangen Blätterbüschel der jungen Triebe blaßgelb und purpurgefleckt gleich gewaltigen Federbüschen an den Zweigspitzen schlaff herabhängen, wodurch der Baum ein äußerst merkwürdiges Aussehen gewinnt. Die prächtigen Blüten bestehen aus riesigen Büscheln von vierhundert bis fünfhundert dunkelkarminroten, leuchtenden Blumenkelchen und werden zu heilkräftigem Tee verwendet.
Plötzlich hörten unsere Freunde eigentümliche, glockenähnliche Töne im Walde erklingen. »Was ist das?« fragte Ulrich verwundert.
»Das ist der Campanero, der Glockenvogel,« erwiderte Manuel, »der uns zur Ruhe läutet; denn ich meine, es ist an der Zeit, daß wir etwas rasten.«
Die Brüder hatten nichts dagegen einzuwenden; obgleich sie heute noch keine große Strecke zurückgelegt hatten, waren sie doch durch die große Hitze nach einer schlaflosen Nacht ziemlich ermattet. Sie machten halt unter einem eigenartigen Baume, dessen sieben Meter im Umfang messender Stamm sich bis zu einer Höhe von dreißig Metern erhob, ehe die ersten Riesenäste von ihm ausgingen, die ein dichtes ungeheures Laubdach bildeten. Nach der Beschreibung des Herrn Lehmann erkannten unsere Freunde in dem Baume sofort den berühmten Kuhbaum, der im Gegensatz zu den anderen Urwaldriesen von allen Schmarotzerpflanzen frei dasteht. Einige Schnitte in die braune Rinde ließen den herrlichen Milchsaft des Stammes reichlich fließen. Die Reisenden hielten Kokosschalen darunter und stillten Hunger und Durst vollkommen durch den Genuß der klebrigen Milch.
Dann banden sie ihre Hängematten im Waldesschatten fest, entlasteten die Maultiere und ließen sich die Ruhe schmecken, von den wunderlichen Tönen des Urwalds in märchenhafte Träume eingewiegt.
NACH mehrstündiger Ruhe erhoben sich die Schläfer erquickt von ihren Ruheplätzen; und nachdem sie noch einen Imbiß zu sich genommen hatten, verfolgten sie die Straße weiter durch den Urwald. Schon von der bald erreichten Paßhöhe aus, auf der eine verwitterte, graue Felsmauer den Weg säumte, eröffnete sich ihnen ein Ausblick nach Süden in das Tal von Valencia. Nachdem sie aber wenige Minuten sanft bergab gestiegen waren, lichtete sich plötzlich der dichte Wald, und sie zügelten ihre Tiere auf dem steil abfallenden freien Platze, auf dem das Haus der Cumbre del San Hilario steht. Die Aussicht, die sich ihnen hier bot, war so entzückend, daß selbst Manuel wie gebannt stehen blieb, obgleich er nicht zum ersten Male auf diesem Platze stand und sonst wie viele Eingeborene wenig Sinn für Naturschönheiten zeigte.
Zu ihren Füßen breitete sich nach Südosten eine große Grasebene aus, die Savannen oder Llanos (sprich: »Ljanos«) von Carabobo, Tocuyito und Valencia, vielfach von merkwürdig geformten Hügeln unterbrochen. Im Süden erhoben sich schroffe, ungeheure Felsmassen, wild und zerklüftet, während im Westen die blauen Berge Torrito, Montalvan, Tiramuto und Casupito die Bergkette mit den Küsten-Anden zu vereinigen schienen.
Im Tale aber dehnte sich nach Südosten der weite Spiegel des Tacarigua, des Sees von Valencia, größer als der Neuenburger See in der Schweiz. Etwa zwanzig kleine Inseln schmückten die Wasserfläche. Während das nördliche Ufer des Sees einen lieblichen Garten mit Zucker-, Kaffee- und Baumwollenpflanzungen bildet, ist das südliche wüst und düster, fast kahl; aber eben dieser gewaltige Gegensatz gibt ein Bild von außerordentlicher Anziehungskraft. Alle Bäche und Flüsse der Umgegend finden sich in dem schönen See zusammen, und doch sinkt sein Spiegel fortwährend infolge der starken Verdunstung, vielleicht auch zugleich durch unterirdische Einsickerungen. Nueva Valencia, die prächtige Stadt im Tale, ist dreimal so weit von den Ufern des Sees entfernt, als sie es bei ihrer Gründung vor dreieinhalb Jahrhunderten war. Manchem der seltsamen Hügel merkt man es heute noch an, das; er früher eine Insel war, und auch ihre Namen vereinigen zum Teil noch die Erinnerung an jenen früheren Zustand. Ganz besonders auffallend erschienen Friedrich und Ulrich drei phantastisch gebildete Kuppen auf dem westlichen Ufer: el Cerrito de San Pedro, la Isla Caratapona und el Islote, welch letzterer für unsre Freunde bald bedeutungsvoll werden sollte.
Nueva Valencia liegt in dunkelgrüne Kaffee- und hellgrüne Zuckerpflanzungen lieblich eingebettet wie in einem Parke; mehrere kleine Dörfer beleben das Tal ringsum, besonders ist es Naguanagua, das mit seinen weißen Häusern und roten Ziegeldächern einen farbenprächtigen Eindruck macht.
Aber dieses Bild, das an und für sich einen so friedlichen Charakter zeigte, bot heute einen kriegerischen Anblick: bewaffnete Reitermassen sprengten unter lauten Rufen durch das dürre Gras der Llanos, das in grünem Zustande Roß und Reiter überragt hätte. Einzelne Schüsse fielen, und man sah deutlich, wie zwei feindliche Heere in aufgelösten Banden sich gegeneinander bewegten.
»Was führt ihr da unten eigentlich für einen Krieg?« fragte Ulrich den Führer. »Stehen nicht auf beiden Seiten Venezolaner?«
»Gewiß!« erwiderte Manuel. »Es ist auch gar kein Krieg, sondern bloß die Revolution.«
»Die Revolution?« wiederholte Friedrich erstaunt.
»Jawohl: wir haben immer Revolution.«
»Aber warum denn?«
»Weil wir eine freie Republik sind,« sagte Manuel stolz.
»Besteht denn die Freiheit im Rebellieren?« entgegnete Ulrich lachend.
»In was denn sonst? Ohne Rebellion keine Freiheit! Die Sache ist nämlich so: wir brauchen einen Präsidenten und eine Regierung; ohne das geht es eben nicht. Wenn aber die einen regieren, so sind die anderen beherrscht und fühlen sich nicht frei; deshalb müssen sie sich gegen die Regierung empören, um selber ans Ruder zu kommen und dadurch frei zu werden. Bleiben sie Sieger, so rebellieren natürlich im nächsten Jahre wieder die anderen, und so geht es immer fort.«
»Ihr seid ein sonderbares Volk!« meinte Friedrich. »Ich würde für eine Freiheit danken, die ohne beständige Händel und Blutvergießen nicht bestehen kann!«
Manuel lachte: »Jedem sein Vergnügen! Uns Diener geht ja die ganze Sache weiter nichts an, und ich hätte auch keine Lust, meine Haut für die Freiheit zu Markte zu tragen. Übrigens schießen die Venezolaner schlecht, und es wird selten lebensgefährlich; die Pflanzungen und das Vieh haben am meisten unter den beständigen Kämpfen zu leiden. Diesmal ist die Sache aber verwickelter: in Kolumbien rebellieren sie auch, nun helfen wir den Rebellen dort, die Kolumbier helfen den unseren, und daneben führen wir auch regelrecht Krieg mit Kolumbia zu Land und zur See, — man kommt gar nicht mehr draus! Man nennt das Politik; aber ich verstehe nicht viel davon.«
Unter solchen Gesprächen waren die Reisenden wieder in den Urwald gelangt. Da wurde ihnen ein ergötzliches Schauspiel: eine Bande Brüllaffen sprang an einem hohen, wilden Caimito auf und ab, bald auf allen vieren von Ast zu Ast hüpfend, bald den langen Schwanz um einen Zweig wickelnd, um so, mit dem Körper herabbaumelnd, eine Frucht zu pflücken. Sehr schön hob sich das helle rotbraune, oft beinahe goldgelbe Fell vom dunkelgrünen Laubdache ab. Ganz besonders unterhaltend war es, die hübschen Jungen zu beobachten, die sich auf dem Rücken ihrer Mütter festklammerten und über deren Schultern bald rechts, bald links nach den ihnen gebotenen Früchten griffen.
»Ach! könnte ich nur solch ein Tierchen lebendig haben!« rief Friedrich entzückt.
Manuel, in der Meinung, dem jungen Herrn eine Freude zu machen, legte sein Gewehr an, und alsbald krachte ein Schuß. Ein Affenweibchen, in die Stirne getroffen, stieß einen herzbrechenden Schrei aus, taumelte einen Augenblick, indem es mit der Hand an die Wunde griff, dann aber nahm es rasch mit zwei Händen sein Junges vom Rücken und reichte es einem anderen Weibchen hin, das es freundlich neben seinem eigenen Söhnchen auf den Rücken nahm. Kaum war dies geschehen, als auch das verwundete Weibchen die letzte Kraft verlor und zu Füßen der Reiter stürzte.
Das menschenähnliche Schreien und Wimmern des Tieres, die Verzerrungen seines Antlitzes, das krampfhafte Pressen beider Hände auf die starkblutende Todeswunde, die stillen, ängstlichen Vorwürfe in den Blicken und zuletzt die Todeszuckungen waren besonders für Friedrich ein erschütterndes Schauspiel, und er machte Manuel die bittersten Vorwürfe wegen seiner Grausamkeit.
Dieser aber erwiderte verblüfft: »Ich wollte dem Sennor seinen eben geäußerten Wunsch erfüllen; ich dachte, das Junge werde mitsamt der Mutter herunterpurzeln. Es ist übrigens ein Wunder, daß ich sie getroffen habe, denn ich schieße sonst immer vorbei, wenn ich noch so gut ziele.«
Stillschweigend setzten die drei ihren Weg fort, am Felsenbette des Gebirgsbaches hin; doch ein unerwartetes schreckenvolles Hindernis sollte bald ihr weiteres Vordringen hemmen.
UM dieselbe Zeit etwa erreichten drei Reiter die Höhe des Gebirgspasses und warfen einen Blick hinab in die Ebene von Valencia.
»Caramba! Dort unten finden Kämpfe statt,« rief einer von ihnen, der mit seiner hageren Gestalt und seinem gezierten Wesen das Vorbild zu einem Don Quichotte abgegeben hätte.
»In der Tat, Lopez! Mit wem wollen wir's halten? Mit den Rebellen oder mit den Regierungstruppen?«
»Wenn wir mit heiler Haut davonkommen wollen, mit keinen von beiden, Don José de Alvarez,« erwiderte der erste. »Meint Ihr nicht auch, Diego?«
»Gewiß!« hub der Angeredete an. »Aber die Sache wird sein, daß wir eben müssen; unangefochten kommen wir kaum durch, wenn wir nicht das Abziehen der Truppen abwarten wollen; und da meine ich, wir halten es allemal mit denen, unter die wir just geraten.«
»Diego hat recht!« rief Alvarez. »So machen wir's; und im übrigen verhalten wir uns neutral. Aber Carajo! Paßt auf! Wir werden geräuchert!«
In der Tat sah man unten im Tal kleine Flammen aufzüngeln. Wenn das Gras an den Berghängen recht dürr ist, wird es von den Einwohnern in Brand gesetzt, damit es um so rascher und üppiger nachwachse. Nun ist es für gewöhnlich im Oktober hierzu noch lange nicht Zeit; diesmal aber hatte eine außerordentliche Trockenheit auch während der Regenzeit die Dürre des Grases beschleunigt. In diesem Falle hatte das Anbrennen einen anderen Zweck: es war von den Regierungstruppen angesteckt, um die Rebellen aus einer günstigen Stellung zu vertreiben. Freilich blieb der Erfolg aus: das Gras war nicht trocken genug, um überall rasch Feuer zu fangen, und der Luftzug trieb es geradeswegs den Bergen zu; da fanden die Flammen reichere Nahrung und zogen in langen Streifen bis in den Urwald hinein, dürres Laub und abgestorbene Zweige prasselnd ergreifend. Der Wald setzte freilich wie immer dem Flammenmeere schließlich einen unüberwindlichen Damm entgegen; aber in der Gluthitze entwickelte sich ein Dampf und Rauch, die alles Leben in ihrem Bereich zu ersticken drohten. Tiere und Vögel flüchteten daher brüllend und kreischend den Berg hinan.
Die drei Mestizen, die zwar auf ihrer Höhe außer Gefahr waren und nur wenig von dem aufwirbelnden Rauch zu leiden hatten, sahen sich doch den Weg ins Tal bis auf weiteres versperrt; sie wandten daher kurz entschlossen ihre Maultiere und galoppierten den Berg hinab auf der Seite, von der sie soeben gekommen waren. Bald hatten sie die neue Straße erreicht, auf der sie nun außerhalb des Bereiches der Flammen um den Berg herum auf einem Umweg der Bahnlinie entlang nach dem Tale von Valencia weiterritten.
Viel schlimmer waren unsere Freunde daran, die schon beinahe den Saum des Urwaldes erreicht hatten, als plötzlich die Flammen emporzüngelten und dichter Qualm, mit Funken vermischt, sie einhüllte. Zugleich wurde es lebendig um sie: Jaguare, Puma, Schlangen, Affen, Kröten und alles Getier des Urwalds brachen aus dem Gebüsch hervor, hüpften und raschelten aus dem Laub und benutzten die sonst gemiedene Straße, um ungehinderter der Gefahr entrinnen zu können.
Die Angst und Eile der Tiere belehrte die Jünglinge alsbald zuversichtlicher als Manuels Erklärungen, daß ihnen von den erschreckten Geschöpfen kein Unheil drohte; Flammen und Rauch aber wurden ihnen lebensgefährlich, da am Saume des Waldes die dürren Zweige in Menge Feuer fingen und brennend herniederstürzten. Die Maultiere waren kaum mehr zu zügeln, auch sie schienen der wilden Jagd der anderen Kreaturen sich anschließen zu wollen.
»In den Fluß!« rief Manuel und zerrte die Maultiere vom Ufer hinab in das felsige Flußbett. Dort fanden die Gefährdeten zwischen hohen, überhängenden Felsblöcken eine geschützte Grotte, in der sie, bis zum Halse im Wasser stehend und von Zeit zu Zeit untertauchend, die Gluthitze ertragen konnten und auch vom Rauche wenig zu leiden hatten.
Als der Abend dämmerte, war dem Brande bereits ein Ziel gesetzt; doch war an ein Weiterkommen noch nicht zu denken, da die Straße mit glostenden, qualmenden Holzstücken übersät war. Unsere Freunde brachten daher die Nacht an einer trockenen Stelle des Flußbettes zu, um mit dem grauenden Morgen die Reise fortzusetzen.
DER Saum des Waldes und die Berghänge boten einen schwarzen, traurigen Anblick, als die drei Gefährten nach kurzem Ritt ins Freie gelangten. Ein widerlicher Brandgeruch erfüllte die Luft; das Laub der Bäume erschien welk, und die meisten Stämme waren hier, wo sie unmittelbar dem Feuer ausgesetzt gewesen waren, verkohlt, ohne daß sie deshalb ihre Lebenskraft eingebüßt hätten. Ein großer Teil der Ebene war mit Asche und Kohle bedeckt, so daß der Boden, der tags zuvor gelbbraun und struppig ausgesehen hatte, nunmehr öde und schwarz erschien. Rebellen und Regierungstruppen manövrierten da unten, aber die einen machten so wenig einen militärisch strammen Eindruck, wie die anderen; sie sahen schlappig und verkommen aus und erweckten nicht den Anschein, als wären sie zu kühnen Unternehmungen fähig.
Manuel riet, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, den Truppen möglichst aus dem Wege zu gehen und die verschiedenen Ortschaften, die meist militärisch besetzt waren, namentlich Nueva Valencia, zu umgehen. Dies wurde denn auch ausgeführt; aber die Bewegungen der Truppen waren der weisen Absicht Manuels hinderlich, und als die Reisenden in der Nähe des Granithügels Islote angelangt waren, sahen sie sich den Weg durch eine berittene Abteilung der Rebellen versperrt. Sie wären wohl dennoch weitergeritten, in der Hoffnung, daß man sie als harmlose Reisende unbehelligt lasse, aber da kamen in der Nähe drei Reiter vorbei, von denen der eine mit wildem Fluche auf sie wies und drohend sein Gewehr erhob.
Ulrichs scharfes Auge hatte sofort Don José de Alvarez erkannt, und da die Brüder wohl bemerkt hatten, wie der Mestize mit seinen beiden Genossen den Überfall auf dem Hafendamm geleitet hatte, versahen sie sich nichts Gutes von dem braunen Kleeblatt, wenn sie auch keine Ahnung hatten, weshalb die Mestizen ihnen so feindlich gesinnt waren. Rasch bogen sie daher um die Felsen herum und legten den Hügel zwischen sich und die Männer, die sich offenbar besannen, ob sie, drei gegen drei, einen Angriff wagen sollten.
Als unsere Freunde vorläufig geborgen waren, sagte Manuel: »Hütet euch vor diesem Alvarez, Sennores; ich kenne ihn von früher, er ist ein heimtückischer Mensch und hat viel auf dem Gewissen; auch die beiden anderen sind nicht viel mehr wert. Die drei sind es, wie ich in Puerto Cabello hörte, die das Volk gegen euch aufgehetzt haben, indem sie logen, ihr wäret die Söhne des ermordeten Sennor Schlüter und kämet, um Don Luis Felipe zu verderben.«
»Was sollen wir tun?« fragte Friedrich.
Ulrich schaute an dem steilen Islote empor und schlug vor: »Klettern wir da hinauf; der Hügel ist schwer zu erklimmen und der Gipfel ist wenig umfangreich, so daß er von drei Mann leicht gegen eine Übermacht verteidigt werden kann. Als gute Schützen können wir von da oben eine ganze Armee hindern, sich uns zu nahen.«
»Wenn sie uns nicht Herunterschießen wie Adler,« meinte Manuel ängstlich.
»Pah, wir werden uns eine gute Brustwehr bauen.«
Friedrich aber sagte: »Höre, Ulrich, auf Menschen schieße ich nicht; mir graust noch, wenn ich des sterbenden Affen gedenke, den Manuel gestern so grausam mordete. Versprich mir, daß auch du keinen Menschen verwunden willst.«
»Wie sollen wir uns denn anders verteidigen, wenn man uns angreift?« wandte Ulrich düster ein. »Ein Versprechen kann ich dir unmöglich geben. Daß ich nicht aus Übermut und ohne Not einen Menschen verletzen oder gar töten werde, das wirst du mir wohl zutrauen; wenn es uns aber an Freiheit und Leben geht, so erfordert die gerechte Notwehr rücksichtslose Selbstverteidigung: Krieg ist Krieg.«
»Ich wollte mich lieber wehrlos niederschießen lassen, als ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben oder meinen Todfeind auch nur zum Krüppel zu schießen,« erwiderte Friedrich. »Ich glaube nicht an das Recht der Notwehr, weil ich mein Leben in der Hand eines Gottes weiß, der geboten hat: Du sollst nicht töten!«
»Das ist beinahe türkischer Fatalismus!«
»Durchaus nicht! Das ist christliches Gottvertrauen: der Fatalismus hindert den Türken nicht an blutiger Selbstverteidigung; ich aber verwerfe die Notwehr nicht etwa, weil ich wähnte, der Erfolg bleibe derselbe, ob ich mich wehre oder nicht, sondern weil ich mein Vertrauen auf den setze, der seinen Jüngern das Waffentragen verbot, als er sie sandte wie Schafe mitten unter die Wölfe. Er gab ihnen den Trost, daß ohne Gottes Willen kein Haar von ihrem Haupte fallen könne, und daß die Menschen nicht zu fürchten seien, die nur den Leib töten können. Sagte er doch auch: ›Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren.‹ An Stelle des barbarischen Selbsterhaltungstriebes setzte der Stifter unserer Religion das Höchste und Edelste, das fröhliche Unrechtdulden in unbegrenztem Gottvertrauen. Ich glaube, die Notwehr überschätzt in unchristlicher Weise den Wert des eigenen Lebens und Wohlbefindens, wie auch die eigene Macht, während sie den göttlichen Schutz unterschätzt. Ja, ich bin überzeugt, die Notwehr kostet manchen das Leben, der gerettet worden wäre, wenn er sich nicht gewehrt hätte: eine Handlung wider Christi Gebot kann niemals wahrhaft gute Früchte tragen. Natürlich darf nicht Feigheit und Schwäche die Ursache sein, daß man sich nicht wehrt, sondern allein der gläubige Gehorsam, der lieber das Leben läßt, als daß er die Gebote des Christentums verletzte.«
»Du nimmst diese Gebote viel zu wörtlich und engherzig.«
»Ich glaube eben nicht, daß wir sie willkürlich auslegen und für unsere Leidenschaften zurechtstutzen dürfen, weil sie uns, so wie sie klar dastehen, nicht zusagen.«
»Praktisch läßt sich ein solch strenges Christentum einfach nicht durchführen, und Unmögliches konnte Jesus nicht von uns verlangen.«
»Warum sollte es sich nicht durchführen lassen? Die ersten Christen haben es doch auch durchgeführt und sich tatsächlich verhalten wie wehrlose Schlachtschafe! Und ist es nicht merkwürdig, daß eben diese Zeit des duldenden Christentums die Zeit seiner größten Siege, seines kräftigsten Emporblühens war? Das blutig kämpfende Heidentum wurde mit unwiderstehlicher Gewalt von diesen wehrlosen Christen besiegt: die Sanftmütigen sollen ja das Erdreich besitzen. Sobald aber die verweltlichte Kirche begann, die Waffengewalt für sich in Anspruch zu nehmen, fand ein Stillstand und Niedergang des reinen Christentums statt, und den Irrtümern war Tür und Tor geöffnet. Genau ebenso ging es der Reformation in Frankreich und Deutschland: sobald sie zur Notwehr griff und das Schwert statt des Wortes oder neben dem Wort als berechtigte Verteidigungswaffe anerkannte, geriet ihr gewaltiger Siegeszug ins Stocken, ja Rückschläge traten ein, die Gemüter verbitterten sich, und unter namenlosem Kriegselend entstand ein unheilbarer Riß, der auf Jahrhunderte hinaus den Fortschritt des Protestantismus lahmlegte.«
»Hör einmal, Friedrich, du bist doch ein sonderbarer Schwärmer; die Zeit des ewigen Friedens ist noch nicht da. Später mag es ja einmal so weit kommen, daß die Notwehr überflüssig wird; jetzt aber ist die Welt noch nicht reif für die Durchführung solcher Hirngespinste.«
»Wie soll es aber besser werden, wenn wir das Ziel für unerreichbar halten und unsere Pflicht, ihm näher zu kommen, leugnen, weil es unerreichbar sei? Ich meinesteils glaube, daß uns im Christentum eben unerreichbare, wenigstens vorerst unerreichbare Ziele gesteckt sind, damit wir unser ganzes Leben lang zu arbeiten und zu laufen haben und nie sagen können: Was ich nicht erreichen kann, darf mir auch nicht als erstrebenswertes Ideal vorgehalten werden. Hier aber handelt es sich um etwas, das für den einzelnen gut durchführbar ist, wenn wir auch vorerst noch nicht hoffen dürfen, daß es zu allgemeiner Anerkennung und Durchführung komme.«
»Nun, so jage meinetwegen deinem Ideal nach, ich halte mich inzwischen noch an die allgemein anerkannte Lebensweisheit, die uns auch als guten Christen die Notwehr gestattet. Das wird dir dein Gewissen jedenfalls nicht verbieten, aus den umherliegenden Steinen und Felsblöcken uns eine Schutzwehr aufrichten zu helfen.«
»Gewiß nicht!« erwiderte Friedrich, die Ironie in des Bruders Worten freundlich überhörend, und machte sich alsbald mit Ulrich und Manuel ans Werk, da sie unter den angeführten Gesprächen bereits die steile Höhe des Islote erklommen hatten.
Die Maultiere wurden in der Mitte des Gipfels in einer kleinen Mulde gelagert; die Arbeit des Schanzenbaus ging rasch voran, denn an Baustoff war kein Mangel, und nach kaum einer halben Stunde war eine kreisförmige Mauer errichtet, die, etwa einen Meter hoch, einen Raum von weniger als fünf Metern im Durchmesser umschloß. Durch die Lücken dieses einfachen Mauerwerks ließ sich die Ebene rings um den Hügel bequem überblicken; es war aber auch die höchste Zeit, daß die Bedrohten sich mit den Maultieren in ihre kleine Festung zurückzogen; denn schon sahen sie, daß eine ernstliche Gefahr ihnen nahte.
»WAS sagt Ihr, Don Alvarez? Auf dem Islote sollen sich verdammte Spione der Regierungstruppen befinden?«
»Es ist die Wahrheit, General! Ihr könnt Euch selber überzeugen: sie haben sich dort oben verschanzt und einige von ihnen bauen noch an der Schutzwehr.«
Der Reiter, den Don José mit »General« anredete und der einer der Rebellenführer war, richtete seinen Feldstecher nach dem Gipfel des Hügels und sah in der Tat drei Gestalten mit der Aufschichtung von Steinen emsig beschäftigt. Einen offiziermäßigen Eindruck machte der Rebellengeneral gerade nicht. Er war ein einfacher Llanero, das heißt ein Rinderhirte, und auch seine Truppen waren aus sehr zweifelhaften Elementen zusammengewürfelt, von Uniformen war fast nichts zu sehen. Aber was tat's? Die Regierungstruppen bestanden eher aus noch schlechterem Material, aus Mestizen, Mulatten und Indianern, welch letztere in Südamerika durchaus nicht so mutig und kriegsgewandt sind, wie im Norden. So geht es denn meist bei den Kriegen und Rebellionen in Südamerika ziemlich unblutig zu, und das ist ein Glück, weil die fortwährenden Unruhen sonst bald die Länder entvölkern müßten.
»Eine sonderbare Art zu spionieren!« sagte der General lachend, nachdem er das Treiben unserer Freunde eine Zeitlang durch das Glas beobachtet hatte. »Wenn unsere Gegner keine schlaueren Spione besitzen, werden sie nicht viel auskundschaften: hat man je gehört, daß sich Spione aus der Spitze eines kahlen Felsens verstecken, wo sie von allen Seiten her beobachtet werden können?!«
»Ich und meine Freunde hier haben die Verräter ausgespürt, als sie sich heranschlichen,« erwiderte Alvarez, »und da sie sich entdeckt sahen, flüchteten sie vor uns auf den Hügel und suchen sich nun, so gut es geht, zu decken, da sie wohl wissen, daß sie in der Mausefalle sitzen und wir sie mit aller Macht angreifen werden.«
»Wieviel mögen es sein?« erkundigte sich der General.
»Mindestens ein Dutzend,« log Don José, der befürchtete, wenn er die Wahrheit sage, möchte der General es gar nicht für der Mühe wert halten, die Stellung anzugreifen.
Der General war weder ein bedeutender Stratege, noch ein besonderer Schlaukopf; dennoch schüttelte er den Kopf: »Höret, Don Alvarez, ihr Mestizen lügt wie die Priester. Spione laufen nicht in Herden umher, und da oben hat kaum ein halbes Dutzend Platz.«
»Ihr vergeßt, daß die Regierungsleute weit entfernt sind, Eure kriegerische Erfahrung und Weisheit zu besitzen, und furchtsam sind wie die Hasen; und was den Raum da droben betrifft, so sieht er aus weiter Ferne eng genug aus, ich wette aber, daß sich wohl dreißig bis vierzig dieser hagern Heringe in die Schanze zwängen könnten.«
Der geschmeichelte General erwiderte: »Ihr mögt recht haben; jedenfalls wollen wir es den Schurken zeigen, daß sie Leute von anderem Kaliber zu Narren halten wollten. Sie mögen ihre Schutzpatrone anrufen, aber es wird ihnen nichts helfen: ihre letzte Stunde hat geschlagen.«
Als die Mestizen unsere Freunde hinter dem Hügel hatten verschwinden sehen, waren sie ihnen vorsichtig, aus Furcht vor einem Hinterhalt am Boden kriechend, nachgefolgt. Lange konnten sie nichts von den Flüchtigen entdecken, bis das Herabrollen eines Steines sie nach der Höhe blicken ließ, wo sie alsbald die Gesuchten erblickten, die schon dem Gipfel nahe waren. Ihnen dorthin zu folgen wäre allzu gefährlich gewesen, daher wurde beschlossen, sie den Rebellen zu verraten und diese durch falsche Vorspiegelungen zu einem Angriff auf den Hügel zu bewegen.
Dieser Plan war denn auch prächtig gelungen, wie wir soeben mit angehört haben. Der General brach mit zweihundert Reitern auf und jagte geradeswegs auf den Islote zu.
Das geschah, als die droben sich eben in ihre Verschanzung zurückzogen. Die Reiter konnten den steilen Hügel unmöglich stürmen ohne abzusitzen; und dann wäre es ein Leichtes gewesen, die langsam Emporkletternden, einen nach dem andern wegzuschießen; aber mit ihren weithin treffenden Gewehren konnten Schützen wie Ulrich und Friedrich schon stark unter ihnen aufräumen, ehe sie nur den Fuß des Felsens erreichten.
Da der ganze Trupp von einer Seite nahte, wendeten sich die Brüder dorthin, während Manuel angewiesen wurde, scharf aufzupassen, ob von irgend einer andern Seite Gefahr drohe.
»Ich werde nur nach den Pferden schießen,« sagte Friedrich. »Schon das kommt mir schwer genug an; aber ich will dich nicht im Stiche lassen und bitte dich nur, gib auch du deinerseits mir so weit nach, daß du Menschen verschonst.«
»Es ist zwar ein Unsinn,« brummte Ulrich; »aber solange es sich mit unserer Sicherheit verträgt, will ich dir zu Willen sein. Vielleicht genügt es, wenn wir den Kerlen einen heilsamen Schrecken einjagen.«
Die Venezolaner waren noch so weit entfernt, daß sie gar nicht an die Möglichkeit dachten, es könne vom Hügel aus auf sie geschossen werden; da krachte ein Schuß, und eines der vordersten Pferde stürzte, durch den Kopf getroffen, zu Boden. Über Roß und Reiter jagten die andern hinweg, ehe sie, von dem Vorfall erschreckt, ihre Pferde zum Stehen bringen konnten. Ein zweiter Schuß — und ein zweiter Reiter lag unter seinem verendenden Gaul.
»Carajo!« rief der General. »Was soll das bedeuten?« In diesem Augenblick stürzte auch sein eigenes Tier, und mit Mühe kam der Mann wieder auf die Füße.
Die Magazingewehre vom Hügel gaben einen Schuß um den anderen ab und in kurzer Zeit lag fast ein Dutzend der Pferde, in Kopf, Hals und Brust getroffen, auf dem schwarzen Grunde. Der General hatte sich ein anderes Pferd geben lassen und kommandierte: »Zurück!«
Im Nu sausten die Reiter davon, und das Schießen vom Islote hörte alsbald auf. Die der Pferde beraubten Soldaten rannten atemlos ihren Kameraden nach.
»Ein Glück, daß die Kerle nicht zielen können!« rief einer der Flüchtigen, »sonst lägen statt der Gäule die Reiter im Blute.«
»Dummkopf!« schrie der General. »Du würdest auf die Entfernung keinen Büffel treffen in einer Herde von hundert Meter Front!«
Nach einiger Zeit ließ der General wieder halten, und in der Meinung, daß nur die dichte Masse der Anstürmenden den Angegriffenen so viele Treffer erlaubt habe, löste er seine Truppe auf und ließ deren einen Teil den Hügel umreiten, mit der Weisung, in möglichst kleinen Gruppen den Angriff zu erneuern; in gleicher Weise drang er mit seiner Abteilung wieder vor, nachdem die Umgehungsbewegung von den anderen ausgeführt worden war.
Nun brauste es von allen Seiten her auf den Hügel zu. Die drei Verteidiger mühten sich nach drei Richtungen verteilen, wobei Manuel als verhältnismäßig schlechter Schütze kaum eine Hilfe war. Nur selten gelang ihm ein Treffer, auch nachdem die Reiter weit näher gekommen waren als das erste Mal; und wenn er dann auch den Gaul statt des Reiters traf, so war dies durchaus nicht Absicht, so sehr Friedrich ihm die Schonung von Menschenleben eingeschärft hatte.
Der General jagte diesmal nicht so kühn seinen Leuten voran, wie kurz zuvor, obgleich er bei seiner neuen Taktik glaubte, weniger befürchten zu müssen. Daß er sich hierin getäuscht hatte, sah er mit Entsetzen bald ein: kaum waren sie wieder dem Islote so nahe, wie das letzte Mal, so fingen auch wieder die Pferde an, sich zu überschlagen oder in die Kniee zu brechen; und da half es nichts, daß die Truppe in etwa zehn getrennten Abteilungen zu je zehn Mann vorrückte; wenn auch nie mehr als zwei Abteilungen zugleich einen Verlust erlitten, so schlugen doch die Schüsse der Reihe nach in jeder Abteilung ein.
»San Jago!« rief der General. »Das sind keine venezolanischen Regierungstruppen! Präsident Castro hat sich Buren von St. Helena zu Hilfe schicken lassen, anders ist es nicht möglich; aber vorwärts, Caballeros! sie sind nur ein Dutzend; sie müssen ihre Flinten auch wieder laden: unterdessen sitzen wir ihnen im Nacken!«
Aber Schuß auf Schuß krachte unentwegt weiter, und dem General begann es unheimlich zu werden. Wie es den Kameraden hinter dem Hügel erging, konnte er nicht sehen; wohl kaum besser, als auf seiner Seite! Und da lagen wieder an die dreißig verendende Gäule, deren abgestürzte Reiter zum Teil in kläglicher Verfassung das Weite suchten, da es sie nicht gelüstete, das Schicksal ihrer Tiere zu teilen.
Der General wetterte und fluchte in allen Tonarten: »Der verdammte Mestize ist ein Verräter und Regierungspion; er hat uns mit Absicht in eine Falle gelockt! Ein Dutzend, hat er gesagt! Bei San Jago de Campostella, er lügt: das sind mindestens fünfzig auserlesene Schützen, die uns zusammenpfeffern sollen. Und was für Kerle! Hat man je so etwas erlebt? Sie treiben ihren Spaß mit uns, wie die Katze mit der Maus: zuerst schießen sie uns alle Pferde weg; Carajo! was werden wir erst erleben, wenn sie anfangen, Ernst zu machen?« Obgleich diese Ausrufe den Mut seiner ohnedies nicht tollkühnen Truppen keineswegs zu erhöhen geeignet waren, hielten diese doch stand, da bis jetzt kein einziger der Reiter verwundet war und die abergläubischen Kavalleristen, die sich die unheimliche Wirkung der Geschosse nur durch höllische Zauberei zu erklären vermochten, zu glauben anfingen, die Freikugeln übten ihren Zauber nur gegen die Tiere aus und könnten einem Menschen überhaupt nichts anhaben.
Ulrichs scharfes Auge hatte indessen den General als Anführer der Feinde erkannt, obgleich er keine auffallenden Abzeichen seiner Würde trug. Der Jüngling hatte wohl bemerkt, welche Verwirrung die fast nie fehlenden Kugeln auf die Angreifer ausübten, und wie sie nur noch zögernd vordrangen; er gedachte daher den Mut des Anführers auf eine besondere Probe zu stellen, und schoß ihm zunächst das Pferd unter dem Leibe weg.

Alsbald mußte ein Reiter absteigen und sein Tier dem General abtreten; kaum saß dieser wieder im Sattel, als sein neues Pferd auch schon tödlich getroffen niedersank. Ein dritter und vierter Gaul hatten dasselbe Schicksal. Nun grauste dem guten General in solchem Maße, daß er sich mit dem fünften Pferde sofort zur Flucht wandte; auch dieses wurde noch von hinten von einer Kugel aus Ulrichs Büchse ereilt, und der gehetzte Feldherr, den seine gequetschten und zerschundenen Glieder schmerzten, war froh, daß ihn endlich ein sechster Renner außer Schußweite brachte. Natürlich folgten die Soldaten dem Beispiele ihres ausreißenden Führers.
Unterdessen hatte die Sache auf der anderen Seite des Hügels eine weit weniger günstige Wendung für die Helden des Islote genommen. Manuels Schießerei hatte, wie wir bereits gehört haben, wenig Erfolg und machte daher auch keinen großen Eindruck auf die von dieser Seite nahenden Feinde. Sie sprengten ebenfalls in mehreren zerstreuten Abteilungen heran, nicht ahnend, daß Manuels Unsicherheit für sie viel lebensgefährlicher war, als die unfehlbaren Kugeln der Schützen, die sich mit der Niederstreckung der Pferde begnügten.
Friedrich mußte bald Manuel zu Hilfe eilen, da die eingeschüchterten Truppen auf der anderen Seite keine so dringende Gefahr mehr boten. Doch auch er konnte das Andrängen der Reiter nicht mehr wirksam aufhalten; denn je näher diese dem Fuß des Hügels kamen, desto schwieriger war es, die einzelnen Abteilungen gleichzeitig im Auge zu behalten. Noch wenige Schritte, so konnten die Angreifer absitzen, um den Hügel zu erklettern. Don Alvarez, der sich auf dieser Seite befand, frohlockte bereits in Voraussicht des nahen Siegs, obgleich er sich auch über das unheimliche Schießen verwunderte und entsetzte, und nur die dumme Sentimentalität der Deutschen innerlich verspottete, die es nicht wagten, ihre Schießkunst wirksamer auszunützen und die Reiter statt der Tiere unschädlich zu machen. Er allein konnte übrigens die Taten der Belagerten in ihrer ganzen unerhörten Großartigkeit erkennen, da er bestimmt wußte, daß sich nur drei Personen dort oben befanden. Caramba! Was die Stürmenden für Augen machen würden, wenn sie, droben angekommen, die Sachlage erkannten; aber daß sie in der ersten Leidenschaft die jungen Helden niedermachen würden, stand ihm fest; im Notfall wollte er dafür sorgen.
Unterdessen waren die Feinde vor Ulrichs Schüssen gewichen, und dieser konnte sich nun auch bis auf weiteres der bedrohteren Stelle zuwenden. Don Alvarez war der erste, auf den sein Blick fiel; als er das widerlich triumphierende Antlitz des Mestizen sah, wallte es heiß in ihm auf, und er konnte der Versuchung nicht widerstehen, dem verräterischen Feinde einen Denkzettel zu erteilen. Überhaupt begann die Gefahr auf dieser Seite so dringend zu werden, daß es mit dem Abschießen der Gäule nicht mehr getan war, zumal wenn die Leute, wie vorauszusehen, in der nächsten Minute absaßen und an den Hängen emporkletterten. Ulrich überlegte nicht lange: »Dies für Don José,« rief er mit lauter Stimme. »Diesmal nur einen Finger der linken Hand!« Erschrocken blickte Alvarez empor— da krachte der Schuß, und seiner blutenden Linken entsank der Zügel. Mit einem Aufschrei warf er seine Flinte fort, ergriff die Zügel mit der Rechten und jagte von dannen. Er erschien nicht wieder; als er seinen bösen Plan scheitern sah, setzte er zunächst mit Lopez und Diego seine Reise fort, günstigere Gelegenheit zur Rache von der Zukunft erhoffend. Denn zu einem unversöhnlichen Todfeinde hatte sich Ulrich durch seine Tat den Mestizen gemacht. Freilich mochte dies insofern ziemlich belanglos sein, als ja Don José schon bisher nach dem Leben der jungen Helden getrachtet hatte und Ulrichs Rache angesichts dieser Tatsache noch als eine sehr gelinde bezeichnet werden mußte. Dennoch empfand der Jüngling ein Gefühl der Beschämung über seine rasche Tat und schlug vor Friedrichs vorwurfsvollem Blicke errötend die Augen nieder.
Die Verwundung und die jähe Flucht des Mestizen, der bisher die Rebellen auf dieser Seite am meisten angefeuert hatte, rief unter diesen eine plötzliche Verwirrung hervor, so daß sie ohne weitere Überlegung ebenfalls die Flucht ergriffen.
»Die jungen Sennores sind Teufel und keine Menschen,« sagte Manuel aufatmend und begleitete dieses, seiner Meinung nach höchstmögliche Lob mit einem Blick voll scheuer Bewunderung. »Mit solchen Helden wollte ich ohne Furcht bis ans Ende der Welt reisen.«
Ulrich wollte antworten, doch kam er nicht dazu, denn zu seiner unangenehmen Überraschung mußte er sehen, daß die fliehenden Truppen wieder umwendeten und aufs neue dem Islote zustürmten, und zwar in bedeutend verstärkter Zahl.
Der General hatte nämlich auf seiner Flucht bemerkt, wie günstig die Lage seiner Leute auf der anderen Seite des Hügels war; zugleich schämte er sich seines Rückzugs, ehe auch nur ein einziger Mann durch eine Kugel eine Verwundung erlitten hatte. Verstauchungen, Arm- und Beinbrüche waren allerdings vorgekommen; aber rechtfertigte das die Flucht von einigen hundert Mann vor einer Handvoll Feinde? Freilich, die ganz unerhörte Schießfertigkeit der Besatzung des Islote hätte auch einen europäischen Strategen aus der Fassung gebracht. Doch so sehr die venezolanischen Krieger, namentlich die Offiziere, den europäischen nachstehen, der Rebellenführer besaß persönlichen Mut und etwas Eitelkeit. Er sammelte daher rasch die flüchtigen Truppen und führte sie den stürmenden Kameraden zu. Als diese inzwischen mit dem verwundeten Don Alvarez wieder kehrt machten, wurden sie von dem erzürnten General aufgehalten, und eine drohende und ermutigende Ansprache trieb sie alsbald wieder vorwärts.
Der General war fest entschlossen, ein Ende zu machen. Freilich, schon wieder begann das Stürzen der Pferde unter den Schüssen vom Hügel; aber das durfte den Angriff nicht mehr aufhalten. Einige Salven wurden auf die Verschanzung dort oben abgegeben, hielten jedoch bloß das Vordringen auf, ohne eine sichtliche Wirkung auszuüben. Endlich aber war der Islote erreicht; die Reiter sprangen ab und machten sich sofort an die Erklimmung des Felsens. Es waren noch etwa hundert Mann, an die siebzig Pferde waren gefallen, und die gestürzten Krieger mitsamt etlichen entmutigten berittenen Kameraden hatten sich ins Weite zerstreut.
Als der Sturm begann — diesmal nur von einer Seite —, sagte Friedrich zu seinem Bruder: »Ergeben wir uns in unser Schicksal, alle könnten wir unmöglich totschießen; in weniger als zehn Minuten sind sie oben. Ich schieße keinesfalls mehr: ich will keinen Menschen verwunden. Wozu wolltet ihr unnütz Blut vergießen? Ihr könnt dadurch unser Schicksal höchstens verschlimmern, wenn es sich überhaupt verschlimmern läßt.«
»Tu du, was du willst!« erwiderte Ulrich erregt. »Ich werde mein und dein Leben teuer verkaufen. Mir selber graut vor dem ersten Mord, aber es ist Krieg, es ist Notwehr; also drauf!« und schon legte er auf den nächsten der Emporklimmenden an.
In diesem Augenblick rief Manuel entsetzt aus: »Seht, da kommt noch ein ganzes Heer von der anderen Seite her! Jetzt ist es wahrhaftig aus mit uns, Santa Maria!«
AUF Manuels Schreckensruf hin wandten sich beide Knaben um und sahen allerdings etwa dreihundert Reiter dahersprengen; aber alsbald rief auch Manuel in plötzlich verändertem, jauchzendem Ton: »Gute Mutter Gottes! Wir sind gerettet, gerettet, das sind ja Regierungstruppen! Es lebe Präsident Castro!« Schon der erste Ruf hatte die Angreifer stutzig gemacht; denn wenn er seinem Inhalte nach auch eher ermutigend für sie sein mußte, so konnten sie sich doch nicht denken, wer ihnen plötzlich zu Hilfe eile. Der zweite Ruf jedoch erfüllte sie mit jähem Entsetzen, und schneller, als sie emporgeklettert waren, stürzten sie nun hinab, um ihre Rosse wieder zu besteigen und womöglich den Feinden zu entkommen.
Aber bereits schlugen wieder die Kugeln von oben her in die Reihen der Gäule, und die wenigen Soldaten, die zur Bewachung der Tiere zurückgeblieben waren, jagten davon, erschreckt durch Manuels Ausruf und das plötzliche Zurückweichen ihrer Kameraden; den Fliehenden schlossen sich die ledigen Pferde in rasendem Galopp an, so daß keiner der unten anlangenden Rebellen sich mehr beritten machen konnte. Was half ihnen alles Fluchen, alle »Caramba« und »Carajo« über die ungetreuen, allzu eiligen Kameraden. Von diesen selber kamen nur wenige davon, weil Ulrich alsbald die Pferde der Davonreitenden aufs Korn genommen hatte und noch viele davon niederstreckte.
Schon waren die Regierungstruppen auf dem Platze und umzingelten die verzweifelten Feinde, die keinen Ausweg sahen und sich ergaben. Der Anführer der Sieger ließ sich den gefangenen General vorführen. »Ihr habt einen heißen Kampf gehabt?« fragte er. »Die Llanos ringsum sind mit Pferdeleichen bedeckt!«
»In der Tat, Exzellenz, Eure besten Schützen haben sich auf dem Islote verschanzt, und wir machen seit zwei Stunden vergebliche Versuche, ihnen beizukommen. Jetzt aber wäre es uns gelungen, wenn nicht das Unglück Euch herbeigeführt hätte.«
»Ich sah aber nur tote und verwundete Pferde: hattet ihr sonst keine Verluste?«
»Nein! unser Glück war es, daß die dort oben nur nach den Gäulen schossen; ich weiß wahrhaftig nicht, warum? denn ihre Kugeln sind unfehlbar; ich schätze, daß sie uns in zwei Stunden achtzig der schönsten Renner zuschanden geknallt haben, zuzeiten fiel ein halbes Dutzend in einer Minute. Hätten sie in ähnlicher Weise in uns selber hineingepfeffert, wir hätten schon längst den Angriff aufgegeben, obgleich wir uns vor keinem Teufel fürchten. Aber ich bin der Ansicht, daß es jetzt auch manchem der Unsern schlecht gegangen wäre, nachdem wir ihnen ernstlich auf den Leib rückten.«
»Wieviel Mann sind wohl dort oben verschanzt? Hm! Es scheint wenig Platz zu sein — höchstens für zwanzig bis dreißig, wenn sie recht eng aufeinander stehen. Drei Köpfe sehe ich über die Brüstung ragen. Werden auch große Verluste gehabt haben!«
»Das will ich meinen, Exzellenz! Caramba! wir haben ihnen einigemal so einen Kugelregen hinaufgesandt, der blutig unter ihnen aufgeräumt haben muß, wenn sie einigermaßen dicht standen; denn die Brüstung hat Lücken genug, durch die die Geschosse dringen konnten, und sie bietet nur für einzelne wenige vollkommene Deckung.«
»Und wieviel, sagt Ihr, waren droben?«
»Das mögt Ihr selber sehen! Don José, der Mestize, sprach von einem Dutzend; aber er ist ein Lügner und erwiesener Verräter: drei bis vier Dutzend müssen es gewesen sein; sollte mich aber wundern, wenn mehr als der vierte Teil von ihnen noch am Leben ist.«
»Nun, wir werden ja sehen!« meinte der Feldherr und ließ den Gefangenen abführen. Dann rief er nach dem Hügel hinauf: »Sennores, Kameraden, wer ihr auch seid, ihr habt euch wacker gehalten gegen eine Übermacht, gestattet, daß wir euch mit Ehren von eurer Festung abholen.«
»Wer als Freund kommt, ist uns willkommen!« rief Ulrich hinab.
Der General der Regierungstruppen hielt die Helden für würdig, daß er sie in eigener Person aufsuche und beglückwünsche. Auch war er neugierig, den so gut verteidigten Posten samt seinen Verteidigern, Toten und Verwundeten in Augenschein zu nehmen. Er fand bald den bequemsten Weg zum Aufstieg heraus und erkletterte mit einiger Mühe den Felsen in Begleitung eines Adjutanten und zweier Offiziere.
Weit riß er die Augen auf, als er, oben angekommen, über den Steinwall schaute und nur drei Maultiere und drei Mann erblickte, von welch letzteren zwei fast noch Knaben zu nennen waren, obgleich ihre pulverdampfgeschwärzten Gesichter einen männlich kühnen Ausdruck hatten.
»He!« rief der General verblüfft. »Wo zum Kuckuck sind eure Genossen hin verschwunden? Wollten sie nicht meine Ankunft abwarten?« Und er sah auf allen Seiten am Felsen hinab, konnte aber nirgends etwas von den Gesuchten erblicken.
»Wir sind noch alle hier oben,« sagte Friedrich, den das unverhohlene Staunen des alten Kriegers belustigte.
»Ja, wo ist aber denn euer Anführer?« stammelte der General.
»Einen eigentlichen Anführer haben wir nicht,« erwiderte Ulrich; »doch mag mein Bruder als solcher gelten, denn sein Befehl, nur auf die Pferde zu schießen, wurde ziemlich ausnahmslos befolgt.«
»O nein!« lehnte Friedrich ab. »Als Anführer kann nur mein Bruder Ulrich in Betracht kommen, als der ältere, mutigere und kriegerischere von uns. Wenn es auf mich angekommen wäre, so hätten wir uns wohl überhaupt nicht gewehrt; ich habe auch auf die Pferde nur mit großer Selbstüberwindung schießen können.«
Der General schüttelte immer wieder den Kopf: »Wo haben Sie denn nur Ihre Verwundeten und Toten untergebracht?« und dabei schien es, als wolle er den Felsengrund ringsum mit seinen Adlerblicken durchbohren, um irgend eine verborgene Höhlung zu entdecken.
»Verwundete und Tote?« sagte Ulrich lachend. »Gottlob! das hat es bei uns nicht gegeben; wie Sie sehen, wir sind alle gesund und munter.«
Nun brach auch der General in ein herzliches Gelächter aus: »Bravo, junge Herren! Der Scherz ist köstlich, und es ist Ihnen wirklich gelungen, meine Neugier aufs höchste zu reizen; aber nun lassen Sie es genug sein und führen Sie mich an den Ort, wo sich die Helden verborgen halten, die mit Ihnen diesen Platz so glänzend verteidigt haben; es drängt mich, Ihnen allen meine große Bewunderung auszusprechen, und wahrlich, Sie werden einer Erfrischung bedürfen, da Sie stundenlang alle Kräfte in Anspannung halten mußten: ich bitte Sie alle, mir als meine Gäste nach Nueva Valencia zu folgen, da mit Ihrer Hilfe die Umgegend von den Rebellen gesäubert ist.«
Der Adjutant und die beiden Offiziere, die sich entfernt hatten, in der Hoffnung, den geheimen Schlupfwinkel, dessen Vorhandensein auch ihnen feststand, mit strategischem Scharfblick ausfindig zu machen, kamen in diesem Augenblick ganz ratlos zurück: »Exzellenz!« sagte der erstere, »der Felsen ist so kahl wie Methusalems Schädel und zeigt nirgends die Spur eines Versteckes.«
»Das vermute ich auch,« bemerkte Friedrich. »Uns, die wir vor kaum drei Stunden diesen Platz zum erstenmal betraten, ist jedenfalls nichts dergleichen bekannt. Wir hätten uns wohl kaum solche Mühe gegeben, diese Brustwehr zu errichten, wenn wir einen solch unauffindbaren Schlupfwinkel gekannt hätten, wie Ihr ihn anzunehmen beliebt.«
»Ihr wollt doch damit nicht sagen, daß ihr drei ganz allein eine feindliche Armee drei Stunden lang aufgehalten habt?« fragte nun der General, starr vor Verwunderung.
»Wenn man zweihundert Mann in Venezuela eine ›Armee‹ nennt, so möchte ich Eure Frage bejahen.«
Der General sah verdutzt von einem zum andern, stets in der Meinung, es müßte ihm eine glaubwürdigere Aufklärung werden; da nahm Manuel das Wort.
»Es ist die reine Wahrheit, Euer Exzellenz; oder um noch genauer zu reden, diese beiden jungen Herren, die Ihnen auf tausend Schritt Entfernung jedes Haar einzeln vom Kopf schießen würden, falls Euer Exzellenz noch einige Haare besäßen, haben allein das Wunder vollbracht; denn was mich anbelangt, wahrhaftig, ich fing erst an, die Gäule zu treffen, während ich auf die Reiter zielte, als sie schon so nahe heran waren, daß meine Schießerei nichts mehr helfen konnte.«
»Santa Maria!« rief nun der General ganz außer sich. »Muß man sechzig Jahre alt werden, um Wunder zu erleben?! Ich bin ein alter General und habe manche Schlacht gewonnen, aber so etwas habe ich weder erlebt noch gehört. Ja, bis zu dieser Stunde hätte ich dergleichen nie für möglich gehalten. Verzeihen Sie mir daher meine Zweifel, sie gereichen Ihrem Heldenmut und Ihrer Gewandtheit zu um so größerer Ehre. Caramba! was sind das für Menschen, denen es überhaupt beifallen kann, zu zweit oder dritt einer solchen Übermacht Trotz zu bieten und dabei noch das Leben ihrer Angreifer zu schonen! Wenn wir das erzählen, so glaubt es uns niemand! Jetzt erst begreife ich's so recht, wie die Buren einer zehn- oder zwanzigfachen Übermacht so lange standhalten können; es ist doch etwas Großartiges um eine solche Schießkunst, alle Hochachtung!«
Auch die begleitenden Offiziere hielten nicht mit ihrer Bewunderung zurück, und unsere Freunde wurden im Triumph den Hügel hinabgeführt.
Mit scheuen Blicken sahen die Soldaten unten die Ankömmlinge an, als ihnen die Sachlage mitgeteilt wurde; dann aber brachen sie in wildjauchzende Hochrufe aus. Am meisten jedoch zeigten sich die gefangenen Rebellen verblüfft, als sie sahen, aus wem die Besatzung des Islote bestand, deren Kugeln ihnen solchen Schrecken eingejagt hatten und schuld an ihrer heutigen Niederlage geworden waren.
In Nueva Valencia wurden Ulrich und Friedrich als große Kriegshelden gefeiert, und ihre neue Rolle belustigte sie mehr, als daß sie stolz darauf gewesen wären; denn sie selbst waren sich keiner besonderen Heldentaten bewußt; das Schießen war schließlich alles, und das war eine Fertigkeit, die sie durch Übung und Sicherheit der Hand und des Auges, verbunden mit Kaltblütigkeit im Augenblicke des Ernstes, gewonnen hatten. Daß diese Venezolaner aus solcher Kleinigkeit so viel Wesens machten, bewies ihnen nur, daß sie einem leicht begeisterten Volksstamme angehörten und Talente, die ihnen selber — vielleicht nur aus Mangel an Ausbildung — abgingen, als etwas beinahe Übernatürliches anstaunten. Dennoch war es ganz angenehm, so umschmeichelt und geehrt zu werden von Offizieren und Generälen und einer staunenden Bevölkerung.
Doch alles ist nur ein Weilchen schön, und da die jungen Helden keine Lust hatten, trotz aller glänzenden Aussichten, die ihnen eröffnet wurden, venezolanische Kriegsdienste anzunehmen, verabschiedeten sie sich bereits am anderen Morgen von dem liebenswürdigen General zu dessen größter Betrübnis. Er bedauerte lebhaft, ihnen keine größeren Beweise seiner Dankbarkeit geben zu tonnen, als einige gute Gewehre, Jagdmesser und einige Vorräte an Lebensmitteln, meist aus besonderen Leckerbissen bestehend, die den Maultieren aufgepackt wurden.
Dann ging es weiter in den leuchtenden Morgen hinaus und an den Stätten ihrer gestrigen Großtaten vorbei den Bergen zu. Diese südlichen Berge bilden keine geschlossen zusammenhängende Kette; zwischen ihnen durch fließen an verschiedenen Stellen die Gewässer, die, südwestlich von Nueva Valencia entspringend, dem Rio Apure zueilen. Freilich ist dieses »Eilen« nicht wörtlich zu nehmen, denn in Wahrheit ist bei dem kaum merklichen Gefälle der Ebene ihr Lauf ein äußerst gemächlicher. Der Weg führte unsere Freunde über das Dörfchen Los Sitios nach Tocuyito und von da am Rio Tocuyito entlang nach Carabobo, wo die letzte Entscheidungschlacht gegen die Spanier am 24. Juni 1821 den Venezolanern die Unabhängigkeit verschaffte. In Carabobo wurde übernachtet.
Andern Tags ging es ins Gebirge, und zwar, da der hindurchführende Stromlauf wegen der Enge des Tales nicht verfolgt werden konnte, über die Galera del Pao, über Höhen und durch Täler, oft durch herrlichen Urwald, immerfort dem Süden zu. Auf der Höhe des Passes eröffnete sich eine prachtvolle Aussicht auf eine große Menge kahler Bergkuppen, die gleich Riesenzuckerhüten gen Himmel ragten. Hier befand sich eine Pulperia, d. h. eine Schenke am Wege, zugleich Zollhaus, und die Reisenden beschlossen, da der Tag sich neigte, in ihr zu rasten. Am folgenden Tag ging es vollends in die Ebene hinab durch Los Chaparros und von da an durch bebautes Land, hübsche Wäldchen, Platanen- und Yukka-Pflanzungen, El Pao zu.
San Juan del Pao, oder kurzweg El Pao, erwies sich als eine ziemlich öde, langweilige Stadt; zwischen dem Pflaster der breiten Straßen wuchs Gras, und alles sah schmutzig und verwahrlost aus. Die Stiche der hier sehr zahlreichen Moskitos ließen keinen rechten Schlaf aufkommen; doch ein erfrischendes Bad im Rio Pao ermöglichte es, am andern Morgen die Weiterreise ohne ein Gefühl der Übermüdung anzutreten. Der Weg führte durch ein Gebüsch von dürren Stachelpalmen und Mimosen nebst einigen Drachenblut- und Topfbäumen, von deren Früchten die goldgelb-scharlachroten »Guacamayos llaneros« naschten. Dies sind die Araras der Llanos, deren Name bei uns gewöhnlich in »Ara« verstümmelt wird. Diese prachtvollen buntschimmernden Vögel mit dem langen scharlachroten Schwanze erhoben sich bei der Annäherung der Reisenden mit heiserem Gekrächze hoch in die Lüfte.
Auf den Ästen der Bäume zeigten sich vielfach graugrüne, steifblätterige Orchideen, und das wunderliche Bartmoos hing gleich eisgrauen Urväterbärten von den Zweigen herab. Dann kamen dichte Gruppen von Agaven und hohem stachlichten Kaktus, deren Abzweigungen gleich Leuchterarmen starr emporragten oder wie Riesenschlangen in seltsamen Windungen aufstrebten. Wie eine Mauer zog sich eine Reihe großer schwarzer Felsblöcke durch den Busch, durch den nur ein schmaler Fußpfad führte, auf dem es oft schwer war, mit den Maultieren fortzukommen.
Endlich wurde wieder der Rio Pao erreicht, der hier durchwatet werden mußte; der Fußweg durch den Busch hatte eine weite Biegung des Flusses abgeschnitten. Auf dem linken Ufer war noch ein schönes Wäldchen zu durchqueren; dann aber öffnete sich den Reisenden der ungehemmte Blick in die eigentlichen Llanos von Caracas.
Die endlosen Steppen, die in Nordamerika »Savannah« oder »Prairie« genannt werden, sind von den Spaniern im Süden »Llanos« oder »Pampa« getauft worden. Es sind durchaus keine Wüsten, wenn auch in der Zeit der Dürre der Anblick öde ist. Zugleich aber macht die seltsame Öde einen großartigen und überwältigenden Eindruck auf die Beschauer; man vermeint, den unendlichen Ozean zu schauen, über dem die glühende Luft zittert und flimmert. Nur selten erheben sich kleine Wälder, Inseln gleich, da und dort aus der einförmigen Ebene, und meist schweift der Blick ungehindert bis zum verdämmernden bläulichen Horizont.
Lange Zeit hielten unsere Freunde am Saume der Heide, gebannt von dem nie gesehenen Schauspiel. Bald aber kam Leben in die tote Landschaft. Hunderte von Rindern bewegten sich dem Flusse zu, und hinter ihnen kam ihr Hüter, der Llanero auf flüchtigem Rosse, seine furchtbare Lanze in den Lüften schwingend. Von Mai bis November wogt sonst das grüne Gras hoch über dem Kopf eines solchen Reiters; diesmal aber fingen die verdorrten Stengel bereits an, in Staub zu verfallen, da die übermäßige Dürre sie vorzeitig ausgetrocknet hatte; in nächster Nähe der zahlreichen Bäche und Flüsse jedoch findet das Vieh auch im Hochsommer jener Gegenden, d. h. eben in der Zeit unseres nordischen Winters, saftige Weide.
Von einem Wege war in den Llanos nicht die Rede, wohl aber von Tausenden sich kreuzender Pfade, die durch die Rinder getreten waren.
»Wahrhaftig!« bemerkte Ulrich, »hier hätten wir wochenlang umherirren können, wenn uns ein kundiger Führer gefehlt hätte.«
»Es wird fraglich sein, ob Manuel selbst sich in einem solchen Gewirre noch auskennt,« entgegnete der Bruder. »Übrigens brauchten wir nur dem Flusse zu folgen, um nicht zu verirren.«
»Aber wer weiß, welche Umwege solch ein Fluß in der Ebene beschreibt!«
Inzwischen waren sie weiter geritten; auf Manuels Rat hatten sie Chaparroblätter auf ihren Hüten befestigt, um sich gegen die glühenden Sonnenstrahlen besser zu schützen. Viele Schlangen kreuzten ihren Weg, und oft mußte Manuel einige totschlagen, weil die Maultiere sonst durchaus nicht zu bewegen waren, weiterzugehen.
Gegen Mittag wurde ein Wald von Palmen der Art de Cobija oder de Sombrero erreicht. Diese Fächerpalmen, die nur in den Llanos nördlich des Orinoko vorkommen, standen zu Tausenden beieinander. Ihre dünnen, grauen, etwa fünfzehn Meter hohen Stämme glichen einem seltsamen Säulenwalde, der einen eigentümlich märchenhaften Anblick bot, da infolge der weitverzweigten, nicht tiefgehenden Wurzeln keine andere Pflanze im Schatten dieser Palmen gedeiht. Nur der Matapalo oder Würgebaum, dieser tödliche Schmarotzer, klettert hie und da an ihnen empor, und sein merkwürdig verzweigter Stamm, wie aus lauter Wurzeln geflochten, umhüllt die schlanken Säulen ringsum mit seinem weitmaschigen Netze, um über oder unter der zierlichen Fächerkrone sein dickblätteriges Dach auszubreiten. Das eisenharte Holz der Cobija leistet aber dem Parasiten erfolgreichen Widerstand, so daß diese Palme nicht, wie andre Arten, unter ihm leidet und zugrunde geht.
Mit größtem Erstaunen betrachteten Ulrich und Friedrich diese neuen Wunder der Tropen. Besonders reizend fanden sie es, wenn an dem Stamme der Palmen aus herabgefallenen Samenkörnern entsproßte Miniaturpalmen nach allen Seiten hervorlugten.
Bei der schwülen Witterung machte es sich doppelt geltend, daß die letzte Nacht infolge der Stiche der Zancudo beinahe schlaflos verbracht worden war; daher wurde beschlossen, hier die Hängematten an den Palmenstämmen zu befestigen. Manuel entzündete ein Feuer, um Kaffee zu kochen; die Maultiere wurden entlastet und mit zusammengekoppelten Vorderfüßen, damit sie sich nicht zu weit entfernten, freigelassen, um sich das spärliche Grün in der dürren Steppe herauszusuchen.
Nach einer einfachen Mahlzeit zündeten sich alle drei ihre Pfeifen an und legten sich in ihre Hängematten, wo sie noch eine Weile plauderten, bis bleierner Schlaf sich auf ihre Augenlider senkte.
Der Tag dämmerte noch nicht, als Friedrich plötzlich aus dem Schlafe auffuhr. In nächster Nähe vernahm er ein kurz abgebrochenes, wütendes Knurren. Als seine Augen sich an das Dunkel gewöhnt hatten, sah er, wie Manuel sich ebenfalls in der Hängematte aufrichtete. »Das ist ein Jaguar!« rief er Friedrich zu. »Ich fürchte, wir verlieren eines unserer Tiere.« Rasch sprang Friedrich zur Erde. »Vorsicht!« mahnte der Führer, und ein vielfältiges Geraschel am Erdboden ließ erkennen, wie angebracht diese Warnung war: offenbar trieben sich zahlreiche Schlangen hier herum. Glücklicherweise war Friedrich auf keine derselben getreten, und die durch seinen Sprung erschreckten Reptilien schienen die Flucht zu ergreifen.
»Wir sind leichtsinnig gewesen!« seufzte Manuel. »Ich hätte es wissen sollen, daß wir nicht alle drei in diesen Gegenden uns dem Schlafe überlassen durften; aber was! es war noch heller Tag, als wir uns zur Ruhe legten, und ich gedachte vor Einbruch der Nacht wieder zu erwachen. Ein andermal müssen wir uns in die Wache teilen, und sobald es dunkel wird, ein Feuer anzünden. Hoffentlich trägt uns meine Unvorsichtigkeit keinen Verlust ein.«
Mit diesen Worten hatte auch er die Hängematte verlassen und war vorsichtig zu Boden geglitten. Ulrich, der nun ebenfalls erwachte, rieb sich die Augen und fragte, was es gebe. Nachdem Manuel seine Frage beantwortet hatte, erhob er sich von seinem Lager und ergriff sein Gewehr, das blinkend an einem Palmenstamme lehnte. Friedrich und Manuel schlossen sich ihm an, und schußbereit schlichen die drei der Stelle zu, von der das Knurren erscholl. Bald fanden sie sich in der Nähe der Maultiere, die sich wie dunkle Schatten am Rande des Waldes hin bewegten; offenbar waren sie auf der Flucht, konnten aber wegen der kurzgekoppelten Vorderfüße nur schrittweise vordringen.
In diesem Augenblick schwang sich ein katzenartiges Tier von der Größe eines kleinen Tigers auf den Rücken eines der Maultiere, das verzweifelt aufschrie. Ulrich, als der kühnste der nächtlichen Jäger, war nur wenige Schritte von dem überfallenen Reittier entfernt; er sah deutlich die Augen des Jaguars funkeln, der im Begriff war, seine Zähne in den Hals seines Opfers zu schlagen: dieses brach, vor Schreck gelähmt, unter der Last des Angreifers zusammen. Der Knabe gab Feuer, und das Raubtier stieß ein zorniges Gebrüll aus. Die Kugel hatte es zwischen den Augen an der Stirne verwundet, war aber am harten Schädel abgeglitten. Ulrich befand sich nun in größter Lebensgefahr; denn die gereizte Katze zögerte nicht, sich auf den Schützen zu werfen, der es gewagt hatte, ihre Jagd zu stören; und gewiß wäre er verloren gewesen, wenn nicht Friedrich raschen Blicks die bedenkliche Sachlage erfaßt und den Bruder mit einem kräftigen Rucke zur Seite geschleudert hätte, als eben der Jaguar vom Rücken des verwundeten Maultiers mit einem Satz in die Luft schnellte. Ulrich flog unsanft zu Boden, entging aber durch die rasche Tat des Bruders den Krallen des blutdürstigen Feindes, der mit großer Gewalt ins Gras stürzte. Friedrich hatte keine Zeit mehr gefunden auszuweichen, und so streifte ihn der muskelstarke Leib des Tieres derart, daß er strauchelte und alsbald auch mit dem Boden Bekanntschaft machte.
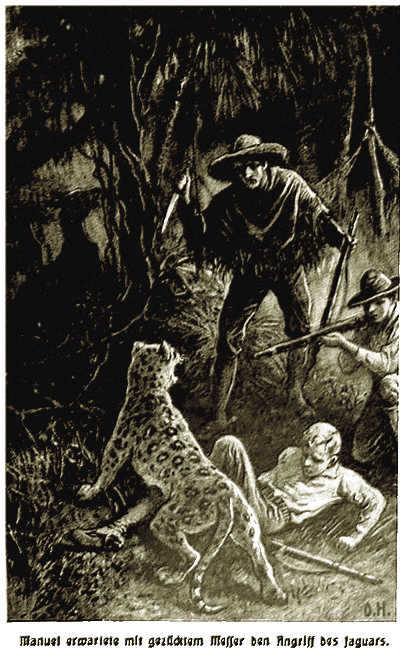
Nun war die Lage der beiden Brüder fast noch schlimmer als zuvor; Ulrich richtete sich zwar bereits wieder auf und tastete nach seinem Gewehr, das ihm beim Sturze entfallen war; Friedrich aber hätte keine Zeit gefunden, sich zu neuer Verteidigung zu rüsten, denn der Jaguar wendete sich sofort dem am Boden Liegenden zu. Schon hob er die rechte Vorderpranke zu einem tödlichen oder doch betäubenden Schlage, als eine Kugel aus Manuels Büchse ihm das Fußgelenk zerschmetterte, so daß er mit entsetzlichem Brüllen die gewaltige Tatze sinken ließ und die blutigen Augen dem neuen Angreifer zuwandte. Dieser erwartete mit gezücktem Messer den Angriff; unzweifelhaft aber wäre er aus dem ungleichen Kampfe nicht als Sieger hervorgegangen, wenn nicht im Augenblick der dringendsten Gefahr Ulrich mit einem Schusse dem schwerbedrängten Diener zu Hilfe gekommen wäre. Diesmal war das Raubtier in den Hals getroffen und konnte sich nur noch schwerfällig bewegen, die Wunde schien tödlich zu sein; dennoch hätte die Bestie im Todeskampf noch gefährlich genug werden können; aber Manuel stieß ihr nunmehr sein Messer in das eine Auge und gleichzeitig gab eine Kugel aus Friedrichs Gewehr dem brüllenden Unhold den Rest.
Während der Jaguar unter gewaltigen Zuckungen und Krämpfen verendete, untersuchten die siegreichen Jäger die Wunden des überfallenen Maultieres. Die Klauen des Räubers hatten diesem den Rücken bedenklich zerfleischt; glücklicherweise war noch kein Biß in den Nacken erfolgt, so daß eine unmittelbare Lebensgefahr für das kostbare Reittier nicht zu bestehen schien; immerhin durfte es in nächster Zeit in keiner Weise belastet werden.
Der Morgen dämmerte, als Manuel mit dem Verbinden der Wunden fertig war. Die beiden andern Maultiere wurden eingefangen, und zur Vermehrung des Ungemachs zeigte sich, daß eines von ihnen eine hohe Beule am Rücken hatte, ein Leiden, das die Lasttiere oft infolge des Drucks und der Reibung der ihnen aufgeladenen Lasten oder auch des Sattels plötzlich befällt. Ein derart erkranktes Maultier muß ebenfalls völlig von Sattel und Zaumzeug und jedem Drucke bis zur Heilung des Schadens befreit werden, die dann meist in kurzer Zeit erfolgt.
Es blieb nichts übrig, als das sämtliche Gepäck dem einzig gesunden dritten Tiere aufzuladen und die Weiterreise zu Fuß anzutreten. Zuvor wurde noch ein tüchtiges Frühstück eingenommen, und der Jaguar, der den Braten dazu liefern mußte, seines schön gefleckten Felles beraubt.
Es ging nun langsam und gemächlich weiter, namentlich aus Rücksicht auf das schwerbelastete Maultier, sowie auf seine wunden Kameraden.
Heiß und glühend stieg die Sonne über den Rand der öden Steppe empor, als unsere Freunde den Palmenwald verließen, den sie im dämmernden Morgenlichte durchschritten hatten. Das Schauspiel dieses Sonnenaufgangs war nicht minder prächtig, als es sich auf dem endlosen Ozean den entzückten Augen darbietet. Die Sonne stand noch nicht gar hoch am Himmel, als plötzlich ein wunderbarer Anblick die Aufmerksamkeit der Wanderer fesselte; eine gewaltige Rinderherde zog lautlos durch die Luft, Grabhügel und zerfallene Türme folgten ihr, bald näher kommend, bald in der Ferne verschwindend; dann zeigten sich die Ufer eines lieblichen Sees, und unter Palmen und blütenreichen Bäumen eine prächtige Stadt, aus deren Toren bewaffnete Reiter sprengten, so ging es wohl eine Stunde lang fort; kaleidoskopartig wechselten liebliche und großartige Bilder, und obgleich sie nicht etwa verkehrt standen, wie es sonst bei den Luftspiegelungen gewöhnlich der Fall ist, erkannten die Reisenden doch, daß es eine Fata Morgana sei, die mit ihren bunten Wundern ihnen die Wanderung durch eine eintönige Landschaft verschönte und reizvoll belebte.
Nachdem die »Sehnsucht der Antilope«, wie die Luftspiegelung im Sanskrit poetisch genannt wird, verschwunden war, nahmen die dürren Llanos, durch die unsre Freunde bisher gewandert waren, einen etwas freundlicheren Charakter an; es begann ein Abschnitt mit frischem, saftigem Gras, das auf die Nähe von Wasser hinwies. Bald wogten die Gräser hoch über den Häuptern der Tiere wie der Menschen, und Friedrich meinte, sie seien wie Gulliver ins Land der Riesen geraten, wo das Wiesengras Baumhöhe erreiche. Viele blütenreiche Malvenarten und Mimosen, deren feinfühlige Blätter sich bei der leisesten Berührung schlossen, brachten überdies Abwechslung in die Landschaft, und an Stelle der traurigen »Palma de Cobija«, die bisher allein in fast schattenlosen, vereinzeltstehenden Exemplaren den Baumwuchs vertreten hatte, trat die »Palma Real de los Llanos«, die mit ihren saftigen, handförmigen Blättern einen erfrischenden Anblick bot. Daneben zeigte sich auch die Sagopalme, Murichi genannt, die Mehl, Wein und Faden zum Anfertigen von Netzen, Kleidern und Hängematten liefert. An den tannenzapfenartigen, schuppigen Früchten hätten sich unsere Freunde gern erlabt, denn sie schmecken ausgezeichnet, ähnlich den Äpfeln, und ihre Röte zeigte ihre Reife an. Aber sie waren leider unerreichbar. Eine Wohltat war es immerhin, daß nun die drückende Hitze durch den Schatten der Gräser und Bäume gemildert wurde.
Unzählige Scharen von großgehörnten Rindern weideten auf diesen üppigen Fluren und inmitten derselben ganze Rudel von Matacani. Diese großen, damhirschartigen Rehe mit ihrem glatten, fahlbraunen, weißgetupften Fell lieferten den jungen Jägern einen ausgezeichneten Braten zum Mittagsmahl. Merkwürdig erschienen unter den friedlichen braunen Gesellen einzelne schneeweiße Exemplare, sogenannte Albino.
Da der heutige Tag, der 13. Oktober, gerade ein Sonntag war, beschlossen unsere Freunde, sich mit der kurzen zurückgelegten Strecke zu begnügen und den Nachmittag zu rasten. Ein kleines von Sagopalmen gebildetes Gebüsch lud mit seinem erfrischenden Schatten zur Ruhe ein. Dürres Gras und trockene Palmzweige wurden zusammengetragen, um in der Nacht ein Feuer unterhalten zu können. Auch den Maultieren sollte die Rast gut tun; denn das gesunde hatte schwer zu tragen gehabt, und die beiden anderen waren durch ihre Wunden, beziehungsweise Beulen, erschöpft und angegriffen.
Ulrich wollte den Versuch machen, einige Früchte von den Palmen herabzuschießen, was ihm gewiß gelungen wäre; Friedrich aber hinderte ihn daran: »Wozu sollen wir die zahlreichen Brüllaffen unnötig erschrecken, die in den Wipfeln umherspringen? Es fehlt uns ja gottlob nicht an Speise und Trank.«
Die Brüllaffen sind nämlich, wie schon Humboldt beobachtete, besonders lüstern nach den Früchten des Murichi und hatten sich auch in diesem Wäldchen in großer Herde eingefunden. Im weichen Moos liegend ergötzten sich die Rastenden an den lustigen Neckereien und possierlichen Sprüngen der drolligen Tiere, und selbst das kreischende Schreien erklang ihnen in dieser weiten Einsamkeit wie Musik.
Plötzlich stieß Friedrich einen unterdrückten Schrei aus; erschrocken wandten sich Ulrich und Manuel der Richtung zu, nach der er mit dem Finger wies. Dort erblickten sie eine wohl sechs Meter lange Riesenschlange, deren Leib in vielen Windungen den Stamm einer Palme umklammert hielt, während ihr gräßlicher Kopf an dem schlanken, metallisch glänzenden Halse mit feurigen Augen zwischen den Blättern der Krone hervorlugte. Ein Rascheln in diesen Blättern, das durch die schaukelnde Bewegung ihres Vorderleibes hervorgerufen wurde, hatte auch die Affen auf die entsetzliche Gefahr aufmerksam gemacht, und mit gellendem Angstgeschrei ergriffen sie die Flucht.
Aber die Boa mochte schon lange auf der Lauer gelegen haben und hatte sich bereits ein Opfer ausersehen: wie ein Blitz schoß sie mit dem Kopf zwischen den Blättern hervor und ergriff mit den scharfen Zähnen ein junges Äffchen. Sie erwischte es aber nur noch an einem Arme, denn das geängstete Tier war mitten im Sprunge, den Gefährten zu folgen. Herzergreifend war das klägliche Schreien des Opfers; man hätte meinen können, es sei ein kleines Menschenkind, das in Todesangst diese Töne ausstoße; aber noch ehe sich die Schlange mit ihrer Beute zurückzog, um sie zu zerdrücken und zu verschlingen, fiel ein Schuß, und Friedrichs wohlgezielte Kugel saß der Räuberin im Kopfe. Grauenerregend waren die Zuckungen und Windungen des Riesenleibes; aber nach wenigen Sekunden erschlaffte seine gewaltige Muskelkraft, die Ringe lösten sich, die Boa glitt am Stamme der Palme herab und fiel mit dumpfem Aufschlag zu Boden. Hier lief noch einigemal ein wellenförmiges Zittern durch ihren Leib; dann aber lag sie starr mit verglasenden Augen. Allein sie hielt noch im Tode das Äffchen mit den Zähnen fest, und vergeblich machte das arme Geschöpf krampfhafte Anstrengungen, seinen Arm aus der Klemme zu befreien.
Friedrich und Ulrich eilten hinzu, und mit Aufbietung aller ihrer Kräfte gelang es ihnen, ihre Jagdmesser zwischen die Kiefer der verendeten Schlange zu stoßen und ihren Rachen aufzubrechen. Vorsichtig zogen sie sodann den Arm des kleinen Affen aus den spitzen Zähnen, die ihn durchbohrten. Das erschöpfte, blutende Tier regte sich dabei kaum mehr. Doch es konnte sich bei ihm nur um eine Ohnmacht infolge des Schreckens, der Ermattung und namentlich des Blutverlustes handeln, da der Biß der Riesenschlange nicht giftig ist, und die kleinen Wunden am Arme, so zahlreich und tief sie auch waren, nicht lebensgefährlich sein konnten.
Die mitleidigen Knaben stillten alsbald das rinnende Blut und verbanden den Arm des Affen kunstgerecht. In der Folge dauerte es denn auch nur wenige Tage, bis der kleine Affe wieder völlig hergestellt war und selbst den Gebrauch seines geheilten Armes wieder erlangte. In dieser Zeit gewöhnte sich das possierliche Tier derart an seine sorgsamen Pfleger, daß es, ganz zahm, ihr ständiger Reisegefährte blieb, der ihnen viele Freude machte und sogar von schätzbarem Nutzen werden sollte.
In der nun bald einbrechenden Nacht wurde, wie auch künftighin, keine neue Unvorsichtigkeit begangen: die drei Gefährten teilten sich in die Nachtwachen und unterhielten währenddessen ein beständiges Feuer, das wilde Tiere und giftiges Gewürm von ihrem Lager fernhielt.
Andern Tags ging es wieder weiter, stets in gemächlicher Gangart und mit zahlreichen Rasten, namentlich zur Schonung der Maultiere. Gegen Abend langte man an einem Sumpfe an, der ein eigenartiges, belebtes Schauspiel bot: große weiße Riesenstörche mit kahlem schwarzem Kopfe und purpurrotem Halsring stolzierten in dem ziemlich klaren Wasser umher. Manuel erklärte, dies seien die »Garzones Soldatos«, die man ja nicht reizen dürfe, da sie mit ihrem gewaltigen, beinahe einen Meter langen Schnabel schwere Verwundungen beibringen könnten. Schneeweiße Garzetta mit schönen gefransten Rückenfedern, zierliche rotbraune Garza mit silbergrauem Gefieder trippelten leichten Schrittes am Ufer hin, und vornehme metallglänzend schwarzbraune Ibisse mit orangefarbener Wachshaut am langen, krummen Schnabel, standen im Wasser und suchten nach Würmern und Fröschen. Kleine Viriri-Enten schwammen in Ketten auf dem Wasserspiegel umher, und auf den Seepflanzen und großblätterigen prächtigen Sumpfblumen, die einen großen Teil des Wassers bedeckten, liefen niedliche blaue und rotbraune Wasserhühner mit ihren langzehigen Füßen geschickt einher und ließen ihre laute, klagende Stimme erschallen. Ganz besonders reizend aber waren die zartrosa Flamingo, in diesen Gegenden eine Seltenheit, die mit anmutiger Bewegung ihres schlanken Halses forschend das Ufer absuchten, um von Zeit zu Zeit den feinen Kopf mit dem starken, gekrümmten Schnabel ins Wasser zu tauchen und dann mit einem laut blökenden Ochsenfrosch als Beute wieder ans Licht zu kommen.
Unter den Wasserhühnern, die auf den Blättern der Seerosen nach Nahrung suchten, fiel unsern Freunden besonders der Jassana auf, dessen schwarzbraunes Gefieder ins Bläuliche schimmert. Im Nacken trägt er einen Busch von zwölf schwarzen Federn und im Winkel jedes Flügelgelenkes einen hornartigen Sporn als Verteidigungswaffe. Dieser sonst stille und scheue Vogel ist ein trefflicher Warner, kündigt er doch jede nahe Gefahr, die seinem scharfen Blicke nie entgeht, durch einen eigentümlichen schrillen Schrei an, weshalb ihn die Indianer häufig zähmen und als Wächter und Warner halten, wie etwa wir die Haushunde. Auch die Europäer in Südamerika benutzen ihn häufig zum Schutze ihres Geflügels; er nimmt nämlich den Kampf mit kleineren Raubvögeln, wie Habichten und Falken, mutig auf und bleibt dabei gewöhnlich Sieger.
Unsere Freunde sollten noch heute den kleinen Helden schätzen lernen; denn während sie, noch ganz versunken in den bunten Anblick, die prächtigen Farben und das unterhaltende Treiben der zahlreichen Sumpfvögel bewunderten, stieß plötzlich der Jassana einen gellenden Schrei aus. »Obacht, Sennores!« rief Manuel aufschreckend. Forschende Umschau haltend, erblickten sie in ihrer nächsten Nähe einen abscheulichen Kaiman, der, mit dem Leibe im Schlamme eingewühlt, nur den häßlichen und grauenerregenden Kopf herausstreckte, eben im Begriffe, mit seinem furchtbaren Gebisse nach Ulrichs Beinen zu schnappen.
Mit einem Schrei des Entsetzens sprangen die drei erschrockenen Naturfreunde zur Seite. Während sich der Kaiman vollends aus dem Schlamme wühlte, flogen die Vögel ringsum mit ohrenbetäubendem Stimmengewirr von dannen, und auch die mit knapper Not einem schrecklichen Unglück entgangenen Jünglinge entfernten sich rasch von dem unheimlichen Ufer.
Sie schritten auf eine schattige Baumgruppe zu, die in einiger Entfernung sich zeigte. Es waren Kopaiva- und Drachenblutbäume. Wer beschreibt die Überraschung unserer Freunde, als sie die Bäume erreichten und dort eine tiefe Erdspalte sich zu ihren Füßen öffnen sahen. Die Wände dieser engen Schlucht wiesen eine schöne rote Farbe auf, sie bestanden aus Carniz, dem farbigen Ton, der sich überall in den Llanos unter der Humusdecke ausbreitet und stellenweise zutage tritt; die Einwohner benutzen ihn häufig als Anstrichfarbe für ihre Häuser.
Aus der Schlucht wehte unseren Freunden eine solch angenehme Kühle entgegen, daß sie sich nicht enthalten konnten hinabzusteigen, was sich bei einiger Vorsicht leicht bewerkstelligen ließ. Unten angelangt, glaubten sie sich fast in ein Märchen versetzt: aus der Glut der Steppe waren sie in einen feuchten, frischen Grund gelangt, aus dessen Felswänden überall kristallklares Wasser sickerte, das sich in einem geräumigen Becken sammelte, in dem sich einige niedliche Fischlein tummelten. Diese glänzten wie Silber, und schwarze Streifen zierten ihre Seite. Waren das nicht die plätschernden Springbrunnen der Alhambra, die zum Bade einluden? Die Gelegenheit war zu verlockend, um unbenutzt gelassen zu werden. Wie erquickend war das Bad an diesem dämmerigen Ort, fern von allen Gefahren, die in den obern Gewässern die Badelustigen bedrohen!
Neu gestärkt entstiegen die Reisenden der silbernen Flut und wanderten noch eine Strecke weiter, um sich einen Platz für die Nachtruhe zu suchen.
ALS ein geeigneter Lagerplatz gefunden und Holz zu einem Feuer gesammelt war, brach schon die Nacht herein.
Manuel rupfte in der Dunkelheit zwei Sumpfenten, die Ulrich noch geschossen hatte, während dieser Holz und Bast aufschichtete. Friedrich blickte unterdessen träumend in die schwarze nächtliche Savannah. Plötzlich sah er aus der Gegend, wo der Sumpf lag, eine helle Flamme nahen. Er machte Ulrich durch einen leisen Ruf darauf aufmerksam. Manuel, der etwas abseits saß und zu seiner Arbeit eine schwermutsvolle Romanze sang, merkte nichts davon.
Die Brüder meinten, es nahe sich jemand mit einer Fackel; vielleicht waren es auch mehrere Menschen, denen ein Führer voranleuchtete. Jedenfalls fand Ulrich es ratsam, der Sache auf den Grund zu gehen, um eine etwa drohende Gefahr rechtzeitig zu erkennen. Er griff daher nach seiner Büchse und schlich sich vorsichtig in die Nacht hinaus, stets das Licht im Auge behaltend, das immer näher kam. Einigemal blieb er stehen und lauschte angestrengt, ohne daß er einen Laut vernehmen konnte; auch war außer der Flamme nichts zu sehen, keine Gestalt, kein Gegenstand, den sie in ihrer Nähe beleuchtet hätte. Manchmal hob oder senkte sie sich; im allgemeinen aber lief sie so schnurgerade parallel mit dem Boden, daß Ulrich ernstlich zu zweifeln begann, ob ein Mensch das Licht trage; infolge der Bewegung des Schreitenden hätte es viel regelmäßiger schwanken müssen.
Ulrich mochte der Flamme auf etwa hundert Schritte nahe gekommen sein und durfte hoffen, binnen kurzem sich mit Sicherheit überzeugen zu können, ob ein Träger vorhanden sei oder nicht, — da plötzlich stand das rätselhafte Licht still, und dann wich es zurück, erst langsam, bald aber immer rascher sich entfernend.
Ulrich verfolgte es eine Zeitlang; als er jedoch einsah, daß er es nicht einholen könne, begab er sich rasch zum Lagerplatz zurück, den er nur dank dem aufflammenden Feuer wieder entdecken konnte. Friedrich hatte sich nämlich gesagt, daß sich sein Bruder in der Dunkelheit nicht wieder zurückfinden könne; als er daher das Fliehen und allmähliche Verschwinden der Flamme bemerkte, entzündete er rasch den Holzstoß, so daß Ulrich einen sicheren Wegweiser hatte.
Manuel war inzwischen mit den gerupften und ausgenommenen Enten herbeigekommen und steckte sie an den Spieß, um sie über dem Feuer zu braten. Als er sich nach Ulrichs Verbleib erkundigte, berichtete ihm Friedrich von der rätselhaften Flamme. In dem Augenblick kam auch schon Ulrich zurück und erzählte, wie es ihm mit dem Irrlicht ergangen war, und wie es bei seinem Erscheinen plötzlich vor ihm zurückgewichen sei; er war nun überzeugt, daß es sich nur um ein Irrlicht handeln konnte.
»Das war die Seele des Tyrannen!« murmelte Manuel dumpf und bekreuzte sich.
»Die Seele des Tyrannen?« fragte Friedrich aufs höchste erstaunt.
»Ja, gewiß! Die Seele des Tyrannen geht nächtlich in den Llanos um und entweicht, wenn ein Mensch auf sie zugeht. Das ist der Fluch des Verfluchten!«
»Was für ein Tyrann ist es denn, von dem diese Sage geht?« forschte nun Ulrich seinerseits.
»Sage?« erwiderte Manuel verächtlich. »Es ist die lautere Wahrheit; ihr habt ja den irrenden Geist selber gesehen! Aber ich habe Hunger: wenn euch gelüstet, die Geschichte zu vernehmen, so wollen wir zuvor speisen; der Braten wird bald gar sein.«
Auch die Knaben hatten Appetit, und so wurde zunächst die köstliche Mahlzeit gehalten, und das Brülläffchen, das Friedrich »Salvado« (den Geretteten) getauft hatte, erhielt ebenfalls sein Futter; dann streckten sich die drei behaglich am Feuer auf dem Moose nieder und setzten ihre kurzen Pfeifen in Brand.
Friedrich war so begierig auf die romantische Erzählung, die er erwartete, daß er kaum so lange an sich halten konnte; dann aber mahnte er den Führer lebhaft an sein Versprechen: »Also! los jetzt, Manuel! Was ist's mit der Seele des Tyrannen?«
Und Manuel begann: »Ich weiß nicht, Sennores, ob euch die Geschichte dieser Länder bekannt ist, bei uns wird noch viel von den alten Zeiten erzählt, als die spanischen Konquistadoren ein Reich um das andre eroberten und ein Volk ums andre unterjochten; was sie aber vor allem begehrten und suchten, wofür sie den größten Gefahren trotzten und Gesundheit und Leben tausendfach wagten, das war das Gold.
»So große Schätze an Silber, Gold und Edelsteinen sie besonders in Mexiko und Peru fanden, so hatten sie doch nie genug; und als sie von den Indianern die Kunde von dem Goldlande der Omagua und von der Goldstadt Manoa mit dem goldenen Sonnentempel und dem Dorado vernahmen, ging all ihr Streben und Trachten nach dieser Heimstätte der größten Erdenreichtümer.«
»Von der El-Dorado-Sage habe ich auch schon gehört,« unterbrach Ulrich den Erzähler. »Vor Zeiten müssen zahlreiche Eroberer ausgezogen sein, dieses fabelhafte Goldland zu entdecken; es gelang aber keinem, und viele fanden dabei ihren Untergang; heute glaubt kein Mensch mehr an jenes El Dorado. Wenn du aber etwas Näheres über den Inhalt der Sage weißt, so teile es uns, bitte, mit: ich meinesteils bin von den Einzelheiten nicht unterrichtet.«
Manuel sah ihn spöttisch lächelnd an:
»Erstens ist El Dorado kein Land, sondern ein Priesterkönig; El Dorado, das ist ›Der Vergoldete‹. Die Goldstadt dieses vergoldeten Königs heißt Manoa. Freilich, wenn man heutzutage die Leute hört, so reden sie immer von El Dorado als von einem Lande; aber ich habe das alles in Büchern ganz genau gelesen und weiß es besser. Zweitens, meine jungen Herren, handelt es sich um keine Sage oder Fabel, sondern um eine sichere Überlieferung. Es ist wahr, die Konquistadoren, die Eroberer Südamerikas, haben die Stadt Manoa nicht gefunden; aber nicht etwa, weil sie nicht bestände, sondern einfach deshalb, weil jene Abenteurer alle nicht so weit vorgedrungen sind, als nötig gewesen wäre; es handelt sich um Gegenden, die bis heute noch keines Weißen Fuß betreten hat. Auch haben die Indianer aus Rache wegen vieler abscheulicher Grausamkeiten die Weißen absichtlich irregeführt und die wahre Lage des Goldlandes geheim gehalten. So ist es ja mit Hunderten von Silberminen in den Kordilleren auch gegangen; bis heute sind die wenigsten von ihnen wieder entdeckt worden.
»Ihr sagt, kein Mensch glaube mehr an die alte Sage vom Dorado? Wo ich noch hinkam, wissen die Leute davon zu sprechen, und ich habe Männer aus Chile, Peru, Ecuador, Colombia, Guayana, Brasilien und Bolivia getroffen, die alle bestätigten, daß die Kunde von den Wundern der Goldstadt bei ihnen noch lebendig sei.«
»Das mag wohl sein,« wandte Friedrich ein, obgleich er nur zu geneigt war, an die geheimnisvollen Überlieferungen zu glauben, von denen er schon viel gehört hatte, weshalb er mit leuchtenden Augen voller Spannung dem weiteren Berichte entgegensah. »Aber daß die Leute heute noch von den vergangenen Träumen etwas wissen, beweist nichts über deren tatsächlichen Hintergrund.«
»Sennores,« sagte Manuel, »als die Spanier nach Peru kamen, erzählten ihnen die Indianer vom Dorado; an der Mündung des Amazonas, viele tausend Leguen von Peru entfernt, wußten die Indianerstämme das gleiche zu berichten; am Orinoko war die Kunde von Manoa überall zu Hause; die Deutschen erfuhren sie in Venezuela. Man mochte hinkommen, wohin man wollte, man mochte die Eingeborenen der verschiedensten Völkerschaften ausfragen, die nie miteinander verkehrten, — es gab nicht einen, der unwissend gewesen wäre; ja, sie wußten Richtung und Wege anzugeben, und diese stimmten überall genau überein: in Bolivia wiesen sie nach Norden, in Peru nach Nordosten, in Ecuador nach Osten, in Colombia nach Süden, in Venezuela nach Südwesten, in Brasilien nach Westen. Aber damals waren die Schwierigkeiten, durch die unendlichen Wälder zu dringen, viel größer als jetzt, und alle El-Dorado-Sucher machten sich durch ihre Schandtaten die Eingeborenen zu Feinden; überdies hatten sie die Kenntnisse nicht, die man heute besitzt: es ist kein Wunder, daß sie Manoa nicht fanden. Wenn aber die Gelehrten von heute nur an die Goldstadt glaubten, eine wissenschaftliche Expedition würde sie bald entdecken müssen. Allein, wer denkt noch an jene abgelegenen Gegenden? Nur das Volk! Dieses aber liebt keine weiten, gefahrvollen Reisen, und deshalb ist das Land dort in der Ferne heute noch so unerforscht wie vor dreihundert Jahren. Ich meinesteils sage nur noch eins: woher haben die Napo den Goldstaub, mit dem sie ihre hohlen Bambusstäbe anfüllen, um in Quito Waren dafür einzutauschen, wenn es kein Goldland gibt?«
»Sei es, wie es wolle,« sagte Ulrich immer noch ungläubig, »was weißt du uns von Dorado zu berichten?«
»El Dorado, der Vergoldete, das ist der Priesterkönig von Manoa, der alle Morgen gesalbt wird und sich im Goldstaube wälzt, so daß sein ganzer Leib im Goldglanz leuchtet; des Abends spült er das Gold im heiligen See wieder ab und wirft alle Edelsteine ins Wasser, mit denen er tagsüber geschmückt war. So geht es Tag für Tag; denn die Schätze an Goldstaub und Edelgestein dort oben sind unerschöpflich.«
»Etwas Ähnliches sagt man vom See von Guatavita,« schaltete Friedrich sinnend ein. »Dieser See liegt im Norden von Santa Fe de Bogota auf der Sierra Cipaquira in den Anden Kolumbiens. Dort soll der Kazike der Idacanzaindianer vor Ankunft der Spanier alljährlich ein Opferfest abgehalten haben. Es wird erzählt, er habe sich dabei den Leib mit wohlriechendem Öl gesalbt, worauf er über und über mit Goldstaub bestreut worden sei; dann fuhr er in einer Piragua inmitten seines prächtigen Hofstaats auf den See hinaus, in den er Hände voll Gold und Smaragde als Weihopfer für den in der Tiefe hausenden Gott versenkte; zuletzt stürzte er sich selbst ins Wasser, den Goldstaub von seinem Leibe abzuspülen. Musik und Gesang und Jubel des Volkes widerhallten hierbei von den Bergwänden, die den See im Kreise umgeben, und Tanz und Trinkgelage beschlossen das Fest. Aber schon als Gonzales Pizarro, der Bruder des Eroberers von Peru, auszog, den Dorado zu finden, wurde dieses Fest nicht mehr gefeiert.
»Der See von Guatavita liegt nur 55 Kilometer nordöstlich von Santa Fe auf dem Südostabhange des Paramo de Cipaquira, einem westlichen Ausläufer der Cordillera de la Suma Paz; er befindet sich 2770 Meter über dem Meere im Krater eines erloschenen Vulkans. Bei einem Versuch der Ableitung des Sees, den vor dreihundert Jahren Herman Perez und Antonio de Sepulveda unternahmen, wurden riesige Smaragde und allerlei Goldgeschmeide zutage gefördert. Nach einem Sturm findet man noch heute Gold und Edelsteine an den Ufern, an denen auch noch herrliche Tempelruinen stehen. Erst neuerdings hat sich in London eine Gesellschaft gebildet, um den See abzulassen und die unermeßlichen Schätze zu heben, mit denen sein Grund gepflastert sein soll.«
Manuel hatte Friedrichs Bericht kopfschüttelnd angehört; als der Jüngling zu Ende war, hub er wieder an: »Was Ihr vom See von Guatavita erzählt, hat allerdings seine Richtigkeit; es ist dies aber durchaus nicht der See des Dorado von Manoa. Der Kazike von Guatavita hat nur den Dorado nachgeahmt, und was dieser täglich tat, begnügte er sich, einmal im Jahre zu tun, da er über die unerschöpflichen Reichtümer nicht verfügte wie El Dorado. Manoa selbst muß weit südlicher liegen als Guatavita, und wenn es heute vielleicht verlassen ist und in Ruinen liegt, so birgt es doch des Goldes und der Juwelen noch genug, namentlich im Schoße des heiligen Sees, um jeden Einwohner Südamerikas zum Millionär machen zu können.«
Als Manuel schwieg, erinnerte ihn Ulrich daran, daß er ihnen noch Aufklärung über »die Seele des Tyrannen« schuldig sei.
»In der Tat,« begann der Führer wieder; »das habe ich über El Dorado ganz vergessen. Also: als Gonzalo Ximines de Queseda die Provinz Bogota erobert hatte, begab er sich nach Spanien, um sich die Regierung dieses Gebietes übertragen zu lassen. Wie es aber damals meist ging, er bekam sie nicht, sondern sie wurde dem verdienstlosen Don Luis Alfonso de Lugo zuteil. Dieser hatte kaum drei Jahre von Santa Marta aus das neue Königreich Nueva Granada verwaltet, so wurde auch schon wegen seiner Mißwirtschaft ein anderer an seiner Stelle von dem indischen Rat zum Vizekönig ernannt: Don Miguel Diaz de Armendariz. Ich weiß diese Dinge genau, denn sie stehen in einem Buche, das mein Vater besaß, und das ich sehr oft gelesen habe. Während Don Miguel in Cartagena und den übrigen Küstenstädten die Untersuchung gegen seinen Vorgänger leitete, beredete er seinen Neffen Don Pedro de Ursua, einen Edelmann aus Navarra, ihn in Bogota zu vertreten. Trotz seiner Jugend bewies sich der ebenso tapfere wie liebenswürdige Ursua als der tüchtigste Regent, der je in Amerika geherrscht hat, und der berühmte Garcilasso Inka de la Vega, Sohn des Don Juan Munnos de Collantes und der Inka-Prinzessin Donna Francisca Coya, der auch durch Philipps II. Undank und Mißtrauen nach Spanien zurückberufen wurde, schildert ihn als großmütig, ehrenhaft, einen tadellosen Ritter, aller Liebling. Das hindert nicht, daß sich Ursua arglosen Indianern gegenüber als blutiger Verräter zeigte: was galten die Indianer den stolzen Spaniern?
»Als Don Pedro de Ursua von den Goldfahrten der Deutschen Hohemut und Federmann in das Land der Omaguas erfuhr und von der reichen Beute, die jene gemacht hatten, erwachte in ihm die glühende Sehnsucht, selbst eine solche abenteuerliche Unternehmung zu leiten und womöglich die Schneeberge zu erreichen, die die Deutschen nur von ferne sahen; dort hoffte er Manoa und dessen König El Dorado zu finden. Mit seinem Freunde Ortun de Belasco warb er vierhundert Freiwillige an, über die er von seinem Onkel Armendariz den Oberbefehl erhielt.
»Ursua drang zunächst in das Land der Lachesindianer und der Chitatero ein, woselbst er die wichtige Stadt Nueva Pamplona gründete. Nachdem sein Onkel infolge verleumderischer Anklagen in Ungnade gefallen und abgesetzt worden war, versuchte Ursua, die Muzoindianer zu unterwerfen; als ihm dies im offenen Kampfe nicht gelang, bat er die Häuptlinge unter Friedensversicherungen in sein Lager, wo er sie sämtlich ermorden ließ. Dennoch gelang ihm die Unterjochung der Muzo nicht. — Ich erzähle das, damit ihr seht, wie unsere Vorfahren mit den Indianern umgegangen sind, und wie recht wir hatten, uns von dieser grausamen Heimat loszusagen und eine Republik zu gründen.
»Bald darauf machte Ursua einen Versuch, die kriegerischen Tayronen zu bezwingen, deren Land reich an Gold und Silber war. Heute noch gräbt man dort goldene Götzenbilder und Geschmeide in Form von Schlangen, Kröten, Adlern, Hirschen, Fledermäusen, Eichhörnchen, Halbmonden und so weiter aus der Erde. Aber die Tayronen warfen Ursua zurück, und nur ein heldenmütiger Verzweiflungskampf rettete ihn vor völliger Vernichtung. Der edle, hochgebildete Stamm der Tayronen konnte nie unterjocht werden und ist auf rätselhafte Weise vom Erdboden verschwunden.
»Später segelte Ursua nach Peru, woselbst der Vizekönig Don Andres Hurtado de Mendoza, Marques de Cannete, ihm die Leitung einer Expedition zur Entdeckung El Dorados und der Goldländer der Omaguas anvertraute.
»Es war nämlich ein Häuptling der Tupinambaramas, namens Viraratu, in Lima eingetroffen. Dieser erzählte, er sei aus Tatendrang mit zweitausend Kriegern von seiner Heimat in Westbrasilien aufgebrochen und den Amazonas hinaufgefahren. Nach langer Reise sei er in eine weite, von hohen Gebirgen umschlossene Ebene gelangt. Dort sei ein See gewesen, an dessen Gestaden so zahlreiche und große Ortschaften gelegen seien, daß seine Leute kein Ende des Staunens fanden: dort befinde sich auch die Goldstadt Manoa und ihr Herrscher El Dorado. Bei dem Erscheinen seiner Flotte im See hätten die Eingeborenen sofort ein zahlreiches Geschwader von Piroguen und Kanus ihm entgegengesandt und ihn in einer Seeschlacht so völlig geschlagen, daß er nur mit knapper Not entronnen und unter tausend Gefahren nach langwieriger Flucht in Peru angelangt sei.
»Dieser Bericht des Häuptlings Viraratu bestärkte Ursua in seinem Verlangen, die Goldstadt aufzusuchen. Er rüstete ein gewaltiges Heer und ließ eine Flotte auf dem Huallagaflusse bauen. Die nötigen Mittel, die er zu seinem Unternehmen außer den Unterstützungen des Vizekönigs brauchte, scheute er sich nicht, zum Teil durch Erpressungen und grausame Gewalttaten aufzubringen. Ursua hatte zwei Jugendfreunde, Dias de Arles und Diego de Frias, zu Offizieren ernannt und ihnen Pedro Ramiro, der eine genaue Kenntnis des Landes und der Eingeborenen besaß, zeitweilig zum Vorgesetzten beigegeben, um die Spanier mit den Häuptlingen und Indianern in Verbindung zu bringen. Vertrauend, daß ihre Freundschaft mit Ursua ihnen Straflosigkeit gewährleiste, ließen die Offiziere den Ramiro meuchlings ermorden, bloß aus Eifersucht, weil er ihnen auf kurze Zeit vorgesetzt worden war. Ursua aber ließ die Mörder in Santa Cruz enthaupten.
»Sennores, wir sagen, daß ein Unternehmen, das mit Blut beginnt, auch mit Blut endigt: das ist wahr und bleibt wahr! Auch der Vizekönig, Marquis von Cannete, teilte diese Befürchtung; er warnte Ursua vor Meutereien, mahnte ihn namentlich, einen gewissen Lope de Aguirre aus seiner Schar zu entfernen und doch ja seine schöne Braut, die mutvolle Donna Inez de Atienza aus Truxillo nicht mit auf die gefahrvolle Fahrt zu nehmen. Ursua schlug die Warnung in den Wind und beantwortete sie nicht einmal.
»Gleich zu Anfang der Expedition wurden die Indianerstämme, durch deren Gebiet man kam, in schauerlicher Weise bekämpft, durch Verrat und Mord aufgerieben, während viele Männer und Weiber zu Sklaven gemacht wurden. Durch den Motilones oder Huallaga gelangte Ursua, talabwärts fahrend, in den Bracamoros, den Oberlauf des Maranon. Es folgte hieraus eine lange, anstrengende Fahrt durch verschiedene Nebenflüsse und Flußarme, teils flußauf, teils flußab. Zu ihrer großen Enttäuschung fanden aber die Spanier nur spärliche Ansiedlungen und gar kein Gold. Eine Meuterei brach bald aus; Ursua verzieh den Schuldigen, wie er stets große Nachsicht gegen die Soldaten übte. Aber weit entfernt, ihm die Milde zu danken, empfanden die Meuterer sie als eine entehrende Schmach, der sie den Tod vorgezogen hätten: so stolz sind wir Spanier, Sennores!
»Ursua ahnte nicht, daß er längst am goldreichen Lande der Omagua östlich vorbeigefahren war und drang immer weiter vor nach Osten. Mühen und Entbehrungen und die völlige Ungewißheit, ob und wo das Goldland zu finden sei, erzeugten unter Soldaten und Offizieren immer größere Unzufriedenheit: sie verlangten nach Peru zurück, und Lope de Aguirre nebst einigen anderen, die Ursua doch viel Dank schuldeten, schürten heimlich den aufrührerischen Geist.
»Die Meuterer boten dem Gonfaloniere Don Fernandez de Guzman den Oberbefehl an, und dieser sagte ihnen aus reiner Eitelkeit zu. Man beschloß, Ursua auszusetzen, während Aguirre auf seine Ermordung drang. Dieser schreckliche Mensch versprach Guzman, nach ihrer Rückkehr nach Peru den Vizekönig zu beseitigen und ihn an dessen Stelle zu setzen. Solche Aussichten bestimmten den ehrgeizigen Gonfaloniere, der Ermordung Ursuas beizustimmen. Ursuas Sorglosigkeit begünstigte die schwarzen Pläne; denn der Feldherr schlief ohne Wache in seinem Zelte. In der Nacht des 1. Januars 1561 wurde er nebst seinem Freunde Juan de Arze ermordet, nachdem seine Entdeckungsfahrt drei Monate und sechs Tage gedauert hatte. Er war erst fünfunddreißig Jahre alt.
»Unter den Meuterern brach alsbald der Unfriede aus; die einen wollten die Entdeckungsreise fortsetzen, während die andern, vornehmlich Aguirre, nach Peru zurückkehren und sich zu Herren des Landes machen wollten. Auch um die Gunst der Donna Inez stritten sich einige der Anführer. Aguirre war die Seele der Zwistigkeiten, die ihm Gelegenheit gaben, sich mehrerer Gegner durch Totschlag zu entledigen. Der Blutmensch plante nun, den Amazonas bis zur Mündung hinabzufahren und sich zur See nach Nombre de Dios zu begeben, die Stadt zu überrumpeln, den Statthalter und alle Beamten nebst allen Widerstand leistenden Einwohnern niederzumetzeln und die Stadt nach ausgiebiger Plünderung in Brand zu stecken. Ebenso wollte er mit Panama verfahren. Dann sollte mit Hilfe der erbeuteten Schiffe und Waffen und der sich ihnen anschließenden Einwohner nebst Tausenden entlaufener Sklaven Peru erobert werden.
»Durch solch verlockende Aussichten und Versprechung fürstlicher Belohnungen gewann Aguirre die Mehrzahl der Meuterer für sich. Alle Gegner, vor allem Don Fernandez de Guzman und Donna Inez, fielen durch Meuchelmord, und das Blut floß in Strömen. Aguirre übernahm alsdann den Oberbefehl und legte sich den Titel ›General‹ zu. Seine Soldaten nannte er ›Marannonen‹, das heißt Verschwörer.
»Aguirre hatte sich durch den Rio Negro und den Cassiquiare in das Stromgebiet des Orinoko verirrt, ohne es selber zu ahnen: er glaubte stets, sich auf dem Amazonas zu befinden, der seinen zweiten Namen ›Marannon‹ von eben jenen Marannonen herleitet. Aguirre hielt seine Leute in grausamer Zucht, und mit dem Argwohn des Tyrannen verbot er ihnen sogar bei Todesstrafe, miteinander zu reden oder sich zusammenzugesellen! Wer auch nur zufällig in seiner Gegenwart die Hand an den Schwertgriff legte, hatte ohne weiteres sein Leben verwirkt.
»Das Blutvergießen war den Spaniern so zur Gewohnheit geworden, daß sie ohne allen Grund friedliche Indianer niederschossen. Um die Wirkung des Pfeilgiftes zu beobachten, wurden einem gefangenen Indianer und einer Indianerin Wunden mit vergifteten Pfeilen beigebracht, an denen sie sterben mußten.
»Alle indianischen Männer und Weiber, die unterwegs zu Sklaven gemacht worden waren, setzte Aguirre, soweit sie sich noch am Leben befanden, trotz ihres Flehens in Gegenden aus, deren Einwohner Kannibalen waren.
»Als endlich das offene Meer erreicht wurde, steuerte Aguirre der Insel Margarita zu, der er sich durch Verrat bemächtigte, unter der königlichen Besatzung und den Einwohnern ein gräßliches Blutbad anrichtend. Diese sich im blühendsten Wohlstande befindende Insel wurde durch die Marannonen derart geplündert und verwüstet, daß sie gänzlich verarmte und sich nie wieder zur alten Blüte aufschwang.
»Aguirre bedurfte zur Ausführung seiner hochverräterischen Pläne noch mehrerer Schiffe; um solche zu kapern, sandte er einen seiner Kapitäne, Pedro de Moguira, aus. Dieser aber verriet Aguirres Vorhaben dem Ordensprovinzial von Santo Domingo, der sofort die königlichen Regierungen von Venezuela und Panama warnen ließ und selber auszog, Aguirre auf Margarita anzugreifen.
»Kapitän Franzisco Faxardo, ein Bürger der Stadt Nuestra Sennora de Carabelleda, des heutigen Caracas, brach sofort nach Eintreffen der Botschaft des Provinzialen gegen Aguirre auf. Dieser segelte, um den Nachstellungen zu entgehen, nach der Küste, besetzte Burburata, dessen Einwohner bei der Annäherung des gefürchteten Plünderers geflohen waren, und verbrannte seine Schiffe, um ein Entweichen seiner Soldaten unmöglich zu machen. Nachdem er die Stadt geplündert und eingeäschert hatte, begab er sich nach Nueva Valencia. Schauerlich wehten seine schwarzseidenen Fahnen, mit blutigroten, gekreuzten Schwertern übersät, den Rebellen voran. Auch Valencia war verlassen; die Bewohner hatten sich auf die Inseln des Sees von Tacarigua geflüchtet, von wo aus sie ihre geplünderten Heimstätten in Flammen aufgehen sahen.
»Nachdem Aguirre wieder viele seiner Soldaten, denen er nicht traute, hatte hinrichten lassen, zog er weiter nach Barquifimeto. Auch diese Stadt fand er verödet. Das Heer der Meuterer zählte noch hundertvierzig Mann; aber die königlichen Truppen hatten sich bereits in der Nähe zusammengezogen, und täglich liefen viele Marannonen zu ihnen über, trotz der grausamen Strenge, mit der sie von ihrem argwöhnischen Führer bewacht wurden. Als Aguirre wieder einen seiner Kapitäne hinrichten lassen wollte, verweigerten ihm die Soldaten den Gehorsam, und die meisten folgten dem Kapitän offen ins Lager der Königlichen.
»Da stürzte Aguirre verzweifelt in sein Zelt, in dem sich seine einzige, heißgeliebte Tochter, noch ein halbes Kind, befand. Mit den Worten: ›Es soll dich niemand die Tochter des Verräters heißen!‹ stieß er dem blühenden Mädchen seinen Dolch in die Brust. In diesem Augenblick drangen die Feinde ins Lager, und der grausame Tyrann wurde von zwei Kugeln seiner früheren Anhänger zu Tode getroffen. Sein Leichnam wurde zerstückelt; seine blutbefleckte Seele aber konnte keine Ruhe finden und irrt heute noch unstet als bläuliche Flamme in den Llanos umher, scheu entweichend, sobald ein ehrlicher Christ sich ihr naht. Ihr habt sie gesehen, ›el anima del Tirano Aguirre‹!
»El Dorado wurde späterhin noch von Martin de Provedo und Don Pedro Malaver de Silva nebst Don Diego de la Cerpa gesucht. Beide Unternehmungen endeten, obgleich die erstere dem Ziele nahekam, mit fast völliger Aufreibung der Teilnehmer unter unnennbaren Mühsalen und unter den Pfeilen erbitterter Indianer. Endlich suchten noch Don Antonio de Berreo und der Engländer Sir Walter Raleigh nach dem berühmten Goldsee; aber sie wähnten ihn im Lande Guayana zu finden, und man mag noch so sorgfältig suchen, man findet nie etwas an dem Platze, an dem es nicht ist. Der Engländer entdeckte zwar einen Goldberg und den fast dreitausend Meter hohen Kristallberg, der von Edelsteinen leuchtet, und von dessen Gipfel sich ein großer Fluß in die Tiefe stürzt, ohne die Felsenmauer zu berühren; aber nur aus weiter Ferne erblickte er diesen merkwürdigen Berg, der ihm wie ein weißer Riesenkirchturm erschien, und er vernahm das schauerliche Getöse der stürzenden Wassermassen. Den See von Manoa jedoch fand er natürlich nicht.«
»Höre, Manuel,« sagte Ulrich, nachdem der Erzähler zu Ende war, »solche ins einzelne gehenden geschichtlichen Kenntnisse hätte ich nie bei einem Diener des Herrn Lehmann vermutet, und du verstehst zu erzählen wie ein gelehrter Mann.«
»O!« erwiderte Manuel geschmeichelt, »ich habe das alles bloß in kurzen, großen Zügen erzählt, wie ich es im Gedächtnis behielt; in dem Buche meines Vaters steht noch viel, viel mehr, das meiste aber habe ich vergessen.«
AM 15. Oktober ging die Wanderung zeitig weiter. »In zwei Stunden erreichen wir die Mission Santa Elena,« versicherte Manuel. »Dort können wir unseren Proviant erneuern und in der Klosterkühle rasten.«
Nach Verlauf von anderthalb Stunden wies er auf eine Palmengruppe in der Ferne. »Dort befindet sich die Mission; ich erkenne den Platz genau an den Chapporobäumen, die in regelmäßigen Abständen das Palmenwäldchen umgeben; in dem Schatten dieser Bäume befinden sich die Hütten der Indianer, die aber alle Christen sind, und am Saume des Waldes erhebt sich das Missionsgebäude.«
Die Wanderer kamen dem Platze immer näher, und Manuel machte immer größere Augen. Sie erreichten die Bäume, sie gingen um das Palmenwäldchen herum, — aber überall wuchs hohes, saftiges Gras, von menschlichen Wohnungen fand sich keine Spur.
»Carajo!« fluchte Manuel. »Die Mission ist verhext!«
Friedrich lachte. »Guter Freund! Du wirst dich in der Gegend täuschen, vielleicht haben wir uns auch verirrt.«
»Ich versichere euch, Sennores, an diesem Platze befand sich noch vor zwei Jahren die blühendste Mission: seht doch! da stehen noch einige verwilderte Kaffeebäume, und hier wächst im Grase verborgen noch manches Plantagengemüse; und dort! seht die große Palme, die kenne ich gut! da muß das Bild der Santa Elena sich befinden!«
In der Tat fanden die erstaunten Jünglinge beim Nähertreten ein in den Stamm geschnitztes Heiligenbild.
»Ich sage es ja! Die Mission ist verhext!« rief Manuel triumphierend, als er die verblüfften Gesichter seiner jungen Herren sah.
»Vielleicht wurde sie von feindlichen Indianern zerstört,« vermutete Ulrich.
»Unsinn! Weit und breit gibt es keine so frechen Wilden mehr; und dann in solcher Nähe von Calabozo: es ist undenkbar! Santa Elena ist einfach verhext, der Mönch hat die Ansiedlung unsichtbar gemacht: ich weiß, er ist ein Teufelskerl und liebt es die Leute zu foppen. Gebt acht! wenn wir hier bleiben, so wird über Nacht die ganze Mission wieder erscheinen.«
Auf dieses Wunder wollten aber Ulrich und Friedrich nicht warten; sie versicherten Manuel, das dürfte erst am Sankt Nimmerlestag eintreffen.
»Caramba!« rief Manuel erstaunt. »Ich kann doch den ganzen Heiligenkalender auswendig, aber von dem San Nimerlos habe ich nie etwas gehört, er kann höchstens im Feste Allerheiligen mitinbegriffen sein. Wäre es eine Santa, so würde ich glauben, sie sei eine der elftausend Jungfrauen, deren Namen ich nirgends ausgezeichnet fand.«
»Beruhige dich!« sagte Ulrich, über Manuels Staunen und Eifer lachend. »Dieser Sankt Nimmerle ist ein besonderer Heiliger des Schwabenlands; ich glaube wohl, das; er in Venezuela unbekannt ist; aber bis zu seinem Tag können wir nicht warten. Hingegen meine ich, wir sollten den Versuch machen, von den Palmen einige Früchte herabzuschießen, um unsere zur Neige gehenden Mundvorräte zu sparen.«
Manuel sah an den himmelhohen Bäumen hinauf, deren Kronen eine Menge traubenförmiger Früchte bargen. »Es geht nicht!« sagte er kopfschüttelnd. »Wenn ihr auch auf diese Entfernung die Stengel treffen könntet, so hängen doch die Früchte so senkrecht herab, daß kein Stiel zu sehen ist; ihr würdet nur unnütz die Beeren zerfetzen und nichts Eßbares herunterbekommen.«
»Das stimmt!« sagte Ulrich, der die Richtigkeit von Manuels Wahrnehmung einsehen muhte. »Also diese Trauben sind uns zu sauer!«
Friedrich war unterdessen auf einen Gedanken gekommen; er nahm den fast völlig geheilten kleinen Brüllaffen vom Rücken seines Maultiers, wies auf die Früchte und brachte dann das Äffchen an den Stamm eines Baumes. Behende kletterte der Affe empor und naschte alsbald von den herrlichen Beeren.
»Heda, Salvado!« rief Friedrich. »Vergiß nicht deine Herren, wir sind auch hungrig!« Und er hielt die offenen Hände empor. Das Äffchen, das bereits gewöhnt war, auf seinen Namen zu hören, stutzte, begriff aber nicht. Manuel, dem es bekannt war, wie häufig sich die Affen durch Herabwerfen von Früchten rächen, wenn sie gereizt werden, schleuderte ein Aststück um das andere in die Höhe, ohne jedoch den Affen zu treffen, was er auch nicht beabsichtigte. Zugleich rief Friedrich immerzu: »Wirf herab! Wirf herab!« Salvado, durch Manuels Werfen geärgert, begann nun, eine Frucht um die andere hinabzuwerfen. Unsere Freunde fingen sie auf und riefen fortwährend: »Wirf herab!« Auf diese Weise gewöhnte sich der Affe späterhin, auf den Befehl: »Wirf herab!« jedesmal die Früchte des Baumes, auf dem er sich befand, herunterzuschleudern, und die Reisenden hatten noch oft Gelegenheit, die Talente ihres gelehrigen Gefährten in Beschaffung unerreichbarer Baumfrüchte in Anspruch zu nehmen.
Für diesmal hatten sie reichlichen Vorrat, um ihren Hunger zu stillen. Auf Friedrichs Ruf kletterte Salvado alsbald gehorsam herab und bestieg wieder das Maultier, auf dessen Rücken er in Ruhe den Anteil verzehrte, der ihm zugeteilt wurde.
Nach ausgiebiger Stärkung wurde rüstig weitermarschiert, und da die Wanderer sich nun, wie man sagt, tüchtig eingelaufen hatten, legten sie einen sechsstündigen Weg fast ohne Unterbrechung zurück. Die Sonne schickte sich schon an, unterzugehen, als Manuel plötzlich ausrief: »Die verhexte Mission!« Dabei deutete er auf ein weißes Gebäude, das einen palmenbeschatteten Hügel krönte, an dessen Fuße sich etwa fünfzig zerstreute Hütten befanden, umgeben von Kakao- und Kaffeebäumen und allerlei Nutzgewächsen wie von einem prächtigen Garten.
»Nun! da siehst du's, daß du dich doch in der Lage der Ansiedelung getäuscht hattest«, lachte Ulrich.
»Nein, wirklich!« erwiderte Manuel. »Getäuscht habe ich mich nicht, vor zwei Jahren stand die Mission an dem Platz, den wir vor sechs Stunden verließen. Der Mönch ist ein Hexenmeister und hat sie durch die Luft hierher gezaubert.«
»Woher willst du aber wissen, daß dies die gleiche Mission ist?« fragte Friedrich.
»Sollte ich Santa Elena nicht wieder erkennen? Das ist das Missionsgebände, wie ich es vor zwei Jahren gesehen habe, und kein anderes; nur, daß es jetzt auf einem Hügel steht statt am Waldessaum in der Ebene; und die Indianerhütten sind alle genau die gleichen wie vor zwei Jahren dort drüben, und ganz in derselben Ordnung stehen sie da. Nein! es ist kein Zweifel, die Mission ist verhext!«
Als die Wanderer den Hügel erstiegen, auf dem das Missionsgebäude malerisch emporragte, kam ihnen der Leiter der Mission, ein freundlicher, wohlgenährter Kapuzinermönch, Padre Martinez, entgegen und sprach seine lebhafte Freude über den unerwarteten und so erfreulichen Besuch der Fremden aus.
Die gastfreundlichste Aufnahme wurde ihnen zuteil, und der Padre versicherte immer, daß die interessanten Erzählungen seiner Gäste über ihre mannigfachen Abenteuer ihn zu größtem Danke verpflichteten; was er ihnen bieten könne, sei ja nicht der Rede wert; eine so angenehme Unterhaltung dagegen sei bei der Eintönigkeit des Lebens in dieser Abgeschiedenheit etwas Unbezahlbares.
Als unsere Freunde ihre Erlebnisse berichtet hatten, erzählte Friedrich noch zum Schluß Manuels Behauptungen über die Verhexung der Mission. Hierbei brach der Mönch in ein solch schallendes Gelächter aus, daß sein Doppelkinn wackelte.
»Euer Diener hat ganz recht,« sagte er endlich. »Vor zwei Jahren stand die Mission dreißig Kilometer nördlich, wo sich das Indianerdorf ursprünglich befand. Aber mir gefiel die Aussicht dort in der Ebene nicht; sehen Sie, hier ist sie weit schöner.« Hierbei wies er zu den Fenstern hinaus, die allerdings einen reizenden Überblick über die ganze Ansiedlung gewährten und die Blicke weit hinaus in die unendliche Ebene mit ihren Waldinseln schweifen ließen; namentlich bot sich eine schöne Aussicht auf die von hohem Gebüsch eingefaßten Ufer des Rio Tisnados, der in einer Entfernung von kaum einer Viertelstunde im Osten an der Mission vorbeifloß.
»Aber wie konnten Sie alle die Gebäude hierher verpflanzen?« fragte Ulrich verwundert.
»Nichts leichter als das! So ein Eingeborenendorf läßt sich beinahe so bequem abbrechen und weiterbefördern wie das Zeltlager eines Nomadenvolkes in Asien oder Afrika. Es ist gar nichts Seltenes, daß eine Indianerniederlassung ihren Standort wechselt: die Hütten werden innerhalb weniger Stunden abgebrochen und auf Pferde und Maultiere, vielleicht auch auf Rinder verpackt; dann geht es dem neuen Wohnplatze zu, an dem das ganze Dorf in zwei bis drei Tagen wieder aufgebaut ist, meist genau in derselben Anlage wie an seinem früheren Sitz. Diese Leichtigkeit des Umzugs mit Haus und Hof bringt es mit sich, daß der Indianer nicht so zäh am Grund und Boden hängt wie der Europäer und frei ist von jedem sentimentalen Heimatgefühl. Ich brauchte meinen Beichtkindern nur zu sagen, die Aussicht passe mir nicht, als sie sich alle sofort bereit zeigten, die Mission an diese von mir ausgewählte Stätte zu verlegen. Freilich, das Missionsgebäude selbst war etwas schwerer abzubrechen und fortzubringen; aber es gelang auch, und nach vierzehn Tagen gemeinsamer Arbeit hatten wir es auf diesem Hügel genau wieder so aufgebaut, wie es dort drüben stand. Sie sehen, das geht auch ohne Hexerei!«
Nach köstlicher Nachtruhe wollten die Reisenden wieder aufbrechen; der Padre aber hielt sie noch bis zum Nachmittag fest. Er riet ihnen, da die Maultiere noch der Schonung bedurften, aus einem Floße den Fluß hinabzufahren. In einer halben Tagereise etwa würden sie bis zur Höhe von Calabozo gelangen, das sodann in einem weiteren Tagemarsch bequem zu erreichen sei.
Die Indianer machten sich alsbald daran, ein Floß zu bauen, das auch mit Einbruch der Dämmerung fertig gestellt war. Unsere Freunde entschlossen sich zu einer Nachtfahrt, die keine weiteren Gefahren bot. Abwechslungsweise lenkte einer von ihnen das Steuer des langsam auf den dunkeln Fluten dahingleitenden Fahrzeugs, während die andern, möglichst weich gebettet, sich dem Schlafe hingeben konnten.
Manuel hatte die Morgenwache. Plötzlich stieß er einen Schreckensruf aus, der die jungen Schläfer jäh erweckte.
»Was gibt's?« rief Ulrich, indem er rasch aufsprang.
»Carajo! Sennores, — die verhexte Mission!« stammelte Manuel, kaum der Sprache mächtig.
Verwundert blickten Ulrich und Friedrich, der nun auch aufgestanden war, westwärts, und in der Tat, dort ragte auf einem Hügel ein Gebäude, genau wie die Mission von Santa Elena, die sie gestern verlassen hatten.
»Das sieht allerdings Santa Elena sehr ähnlich,« sagte Friedrich nachdenklich; »aber warum sollte in dieser einförmigen Gegend nicht ein zweiter Hügel vorhanden sein, auf dem ein Gebäude nach dem Muster von Santa Elena errichtet worden ist?«
»Tatsache ist, daß wir vor etwa sieben Stunden von Santa Elena abstießen und seither flußabwärts trieben,« stellte Ulrich fest. »Dieser Hügel aber liegt noch eine gute Strecke flußabwärts vor uns; er muß also bedeutend südlicher liegen als Santa Elena. Jedenfalls finde ich die Sache merkwürdig genug, um sie zu untersuchen.«
Manuel hatte inzwischen die Sprache wieder gefunden: »Sennores, kein Mensch kann bestreiten, daß wir die ganze Nacht den Fluß hinunter fuhren, und nun liegt Santa Elena vor uns, das wir doch gestern hinter uns ließen. Ich sagte es ja, die Mission ist verhext, und da mögen Sie sagen, was Sie wollen: der Padre hat sie durch seine Kunst über Nacht mitsamt dem Hügel weiter nach Süden gezaubert. Vielleicht begleitet er Sie auf diese Weise bis zu den Napo, so etwas sieht ihm ähnlich! Das hat den Vorteil, daß stets ein guter Imbiß und ein bequemes Nachtlager Sie erwartet, wo Sie hinkommen mögen; aber unheimlich ist es doch, scheußlich unheimlich!« und er bekreuzte sich.
Das Floß wurde ans Ufer getrieben und dort festgebunden, worauf die Brüder dem rätselhaften Hügel zuschritten; Manuel ging zaghaft hinter ihnen drein. Bald tauchten Indianerhütten auf, aus denen bekannte Gesichter verwundert herausschauten; und siehe, auf dem Hügel stand der Padre Martinez, den Sonnenaufgang im Freien zu bewundern.
Erstaunt musterte er die Ankömmlinge. »Oho! das ist erfreulich«, rief er munter, »daß meine lieben Gäste zurückkehren, aber warum übernachteten Sie nicht wieder bei mir, wenn Sie noch nicht Weiterreisen wollten? Es ist doch nicht etwa ein Unglück geschehen?«
»Verzeiht, Padre!« rief Manuel dazwischen. »Lasset die Verstellung genug sein; denn wir wissen, wie fein Ihr hexen könnet.«
Der gute Mönch wußte nicht, was er sagen sollte; er blickte verständnislos von einem zum andern, bis Friedrich ihm erzählte, sie seien die ganze Nacht stromab gefahren und befänden sich nun ganz unerklärlicherweise wieder oberhalb ihres Abfahrtpunktes.
»Aha!« rief der Padre, in herzliches Lachen ausbrechend: »Den Streich hat euch der alte Orinoko gespielt: da haben wir die Hexerei!« Und als er sah, daß seine Freunde nicht klüger waren als zuvor, fuhr er fort: »Seht, wir befinden uns hier gar nicht hoch über dem Meeresspiegel; der Tisnados fließt in den Apure, und dieser in den Orinoko, der dann noch 600 Kilometer lang ist bis zu seiner Mündung; nun ist es klar, daß das Gefäll dieser Flüsse ein kaum merkliches sein kann, so daß ein Gegenwind oder ein rasches Anschwellen des Orinoko die Flüsse nach aufwärts, ihren Quellen zu, treibt.
»Offenbar ist nun im Urwald ein starkes Gewitter niedergegangen, der Orinoko ist gestiegen und hat eine Strömung nach aufwärts im Apure und Tisnados veranlaßt. Darum ist euer Floß die Nacht über kaum von der Stelle gekommen und noch etwas nördlich getrieben, während es euch vorkam, als gleite es mit dem Fluß dem Apure zu. So glauben die Indianer oft, stromabwärts zu fahren, während sie in entgegengesetzter Richtung treiben. Ihr könnt von Glück sagen, daß ihr in keinen gefährlichen Strudel gerietet, denn solche bilden sich oft durch die beiden einander bekämpfenden Gegenströmungen.«
Nach dieser Aufklärung lud der freundliche Mönch die Herrschaften zum Frühstück ein, was sie nicht ausschlugen, und dann begleitete er sie zu ihrem Floß zurück, auf dem noch die Maultiere lagen. Da die Strömung nach oben noch anhielt, setzten die Reisenden aufs andere Ufer über, nach herzlicher Verabschiedung vom gastfreien Missionar. Von dort aus schlugen sie zu Fuß die südöstliche Richtung nach Calabozo ein.
Manuel aber murmelte: »Wir werden es ja bald sehen, daß uns der Padre mit seiner Mission noch weiter verfolgt! Ich meinesteils glaube seinen Märchen nicht und bleibe dabei: Santa Elena ist verhext!«
Die Maultiere waren nun so gründlich wiederhergestellt und durch die Ruhe, die sie genossen hatten, so gekräftigt und frisch, daß sie wieder ohne Bedenken belastet und bestiegen werden konnten. Im Laufe des Tages wurden die beiden Canno Guapo und Rastro überschritten. Mit dem Namen »Canno« werden kleinere Nebenflüsse und Bäche bezeichnet. Gegen Abend langten die Reiter in Rastro de Arriba an, einem Städtchen, in dem sie zu übernachten beschlossen. Die Nachtruhe wurde sowohl durch die stechenden Zancudos als auch durch große Fledermäuse gestört, die im Umherflattern öfters mit den Flügeln das Gesicht der Ruhenden streiften.
In der Morgenfrühe des 18. Oktobers ritt ein hagerer Mann von gelblicher Gesichtsfarbe auf einem dürren, aber muskulösen Gaul durch die Straßen von El Rastro. An jeder Posada, an jeder Pulperia hielt er an und erkundigte sich, ob nicht hier drei Reisende abgestiegen seien. Aber überall wurde ihm der gleiche verneinende Bescheid. »Diego hat doch sonst scharfe Augen,« murmelte er unmutig vor sich hin. »Sollte er sich getäuscht haben? Er erklärte mit aller Bestimmtheit, in der Abenddämmerung drei Reiter nach Rastro hineinreiten gesehen zu haben und glaubte, in ihnen diese deutschen Schufte mit ihrem elenden Führer zu erkennen!«
Endlich, am letzten Hause des Orts, ward dem Mestizen der erwünschte Bescheid; zugleich wurde ihm auf seine Frage mitgeteilt, die beiden jungen Herren wollten mit ihrem Diener noch in der Frühe nach Calabozo reiten. Diese Auskunft schien den Spion befriedigt zu haben; denn er wandte alsbald sein Pferd und sprengte in die Savannah hinaus. »Recht so!« knirschte er draußen. »Nach Calabozo sollt ihr kommen, aber nicht wieder heraus. Für einen Finger Don Joses sind zwei Menschenleben nicht zu viel!« Und dabei betrachtete er seine Linke, der ein Finger mangelte.
Nach kurzem Ritte traf er auf zwei andere Reiter, die ihn offenbar erwartet hatten und ihm zuriefen: »Nun, Alvarez, habt Ihr sie gefunden?«
»Du hast recht gesehen, Diego: jeden Augenblick können sie kommen. Lopez, behalte du den Weg im Auge und gib uns Nachricht, sobald du die Schufte erblickst. Wir werden indessen das weitere vorbereiten.«
Alvarez und Diego ritten alsbald in scharfem Trabe voran bis in die Nähe der Stadt Calabozo, von der aus eine bewaffnete Reiterschar ihnen entgegenkam. »Sie sind richtig angekommen, die verdammten Regierungsspione!« rief Alvarez dem Anführer der Truppe zu. »Nun will ich euch an einen geeigneten Platz führen, ihnen aufzulauern. Wir müssen sehen, daß wir sie mit List kriegen, denn es sind vermaledeite Schützen.«
Unterdessen hatten unsere Freunde ahnungslos El Rastro verlassen und ritten geradeswegs Calabozo zu. Zunächst ging es über saftige Weiden, dann zwischen ausgedehnten Sümpfen hindurch, an denen viele Alligatoren unbeweglich lagen und sich sonnten. Oft hätten die Jünglinge diese schrecklichen Tiere gar nicht bemerkt, da sie faulenden Baumstämmen täuschend ähnlich sahen; aber die zitternde Angst Salvados und der Maultiere und hier und da ein gähnend aufgesperrter Rachen mit bedrohlichen scharfen Zähnen ließen sie die Feinde erkennen, denen leicht aus dem Wege zu gehen war, da sie sich in ihrer trägen Ruhe durch die Ankömmlinge nicht stören ließen.
Da bot sich ihnen ein widerliches und doch interessantes Bild: am Wege lag ein halb in Verwesung übergegangener Alligator. Die abschreckend häßlichen schwarzen Aasgeier, die Zamuro, stritten sich schreiend und krächzend um sein faulendes Fleisch. Plötzlich schoß ein größerer, weiß und schwarz gefiederter Geier herab, dessen nackter Hals und Kopf rot und gelb gefärbt erschienen.
»Das ist der Rey de Zamuros, der König der Geier!« erklärte Manuel.
Die durch den neuen Ankömmling gestörten Raubvögel wichen scheu vor ihm zurück und warteten in achtungsvoller Entfernung, bis er sich gesättigt hatte, und erst nachdem er fortgeflogen war, wagten sie wieder zu nahen.
Nach zweistündigem Ritt erreichten die Reisenden das steile Ufer des Rio de Guarico, dessen Gewässer bereits zu versiegen anfingen. Ein schöner Wald zog sich zu beiden Seiten des Flusses hin, und einzelne tiefere Wassertümpel im Flußbette luden zu einem erfrischenden Bade ein. Die Maultiere wurden an Bäume festgebunden und die Waffen neben sie auf den Waldboden niedergelegt. Dann stiegen unsere Freunde in die Tiefe hinab, entkleideten sich und kühlten die erhitzten Glieder in den Fluten.
Nach dem Bade zogen sie sich rasch an und erstiegen das Ufer; aber wer beschreibt ihren Schrecken, als sie entdecken mußten, daß sowohl ihre Tiere als auch ihre Waffen verschwunden waren! Im Augenblick dieser entmutigenden Entdeckung vernahmen sie drohende Rufe, und ringsum sprangen hinter den Bäumen Soldaten vor, die sich auf die Wehrlosen stürzten, sie zu Boden warfen und ihnen die Hände auf dem Rücken fesselten.
»An den Galgen mit den Verrätern!« schrie gleichzeitig eine widerliche, ihnen nur zu wohl bekannte Stimme. Mit höhnischem Lachen trat Don José de Alvarez vor sie hin, hielt ihnen seine verstümmelte Hand vor die Augen und raunte ihnen zu: »Nun, ihr Zirkusschützen, wollt ihr auch den Tanz am hohen Seil kennen lernen: das wird euer letztes Kunststücklein sein!«
Eine Viertelstunde später befanden sich die Gefangenen bereits im Kerker zu Calabozo; denn die Stadt war in den Händen der Rebellen, und auf das Zeugnis der drei Mestizen hin sollte den Unglücklichen tags darauf der Prozeß als Regierungsspionen gemacht werden.
Trübe Gedanken erfüllten die Herzen der Knaben, die so früh ihr Leben als Verbrecher enden sollten. Kaum, daß sie, durch den Hunger getrieben, etwas von der kargen Nahrung zu sich nahmen, die ihnen geboten wurde. Wenn sie daran dachten, wie die Lügen der Mestizen sie schon zweimal in die größte Lebensgefahr gebracht hatten, damals in Puerto Cabello und dann wieder auf dem Islote, so hatten sie wenig Hoffnung, gegen die Verleumdungen ihrer schändlichen Feinde aufkommen zu können oder gar Mitleid und Schonung bei ihren Richtern zu finden, die ja zu denen gehörten, die sich gegen Gesetz und Ordnung aufgelehnt hatten.
Manuel seinerseits schimpfte und fluchte gewaltig, namentlich darüber, daß er nur Wasser zu trinken hatte und nichts als Brot essen sollte; dennoch entwickelte er einen gewaltigen Appetit und Durst, und ans Sterben dachte er nicht ernstlich; dazu war noch Zeit, wenn ihm der Strick um den Hals gelegt wurde.
»Manuel,« sagte Friedrich ernst. »Das Fluchen mußt du dir in unserer Gesellschaft noch abgewöhnen.«
»Dazu werde ich keine Zeit mehr haben. Übrigens ist Caramba gar kein Fluch, sondern nur ein Ausruf wie ach! und o!« verteidigte sich der Spanier.
»Aber Carajo ist ein richtiger Fluch.«
»Alle Spanier fluchen, junger Herr!«
»Schlimm genug! Ich kann es einmal nicht hören, ohne daß mir ein Stich durchs Herz geht. In unserem Elternhause hörten wir nie den leisesten Fluch. Leider fluchen ja auch viele Deutsche, aber nur ungebildete oder schlecht erzogene Menschen.«
»Herr, ich will es versuchen, mir's abzugewöhnen,« erwiderte Manuel kleinlaut. »Aber es wird schwer halten, und wie die Sachen stehen, fürchte ich, bleibt mir nicht genug Frist dazu.«
So hatte es allerdings den Anschein, und diese Bemerkung erinnerte die Brüder wieder an ihr trauriges Geschick. Sie suchten einander zu trösten. Am schwersten bedrückte es sie, daß sie nun ihren Vater nicht wiederfinden sollten, und der Gedanke an seinen Schmerz, wenn er den Verlust aller seiner Lieben erfahren würde, wirkte am niederschlagendsten auf sie. Dennoch ließ das erhebende Bewußtsein ihrer Schuldlosigkeit sie mit Eintritt der Dunkelheit einen ruhigen Schlaf finden, und als sie frischgestärkt erwachten und heller Sonnenschein durch die Gitterfenster ihres Kerkers aus die Steinfliesen fiel, erwachte auch neue Lebenshoffnung in ihren jungen Herzen: konnte nicht der Gott, der sie aus den Wellen des Meeres und zweimal aus den Händen der Feinde errettet hatte, auch diesmal seine Macht an ihnen beweisen? Und wenn er das nicht wollte, nun, so wußten sie so manches Beispiel unschuldig Gemordeter, die getrost dem Tode entgegengesehen hatten, und wollten sich an den Spruch halten: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht mögen töten.
Während sie mit solchen Gedanken beschäftigt waren und sie einander zu gegenseitiger Stärkung mitteilten, öffnete sich die Tür ihres Gefängnisses, und sie wurden vor das Kriegsgericht geführt.
Die finstern Rebellenoffiziere schienen von Anfang an wenig geneigt, den Ausländern Glauben zu schenken, wogegen sie alles, was Don José, unterstützt durch das beistimmende Zeugnis Diegos und Lopez', vorbrachte, für bare Münzen nahmen. Am schwerwiegendsten war offenbar der Umstand, daß die jungen Leute auf dem Islote die Rebellen bekämpft hatten und von den Regierungstruppen befreit worden waren. Das leugneten sie ja auch nicht, nur versicherten sie, in reiner Notwehr gehandelt zu haben.
Die Richter liebten offenbar keine langen Verhandlungen; besonders Manuels Schimpfen und Wettern brachte sie noch mehr auf, und sie waren im Begriff, kurzen Prozeß zu machen und im Zweifelsfalle das Todesurteil zu sprechen, als ein hochgewachsener Greis mit edlen Gesichtszügen sich nahte, dem alles mit scheuer Ehrfurcht Platz machte.
»Was wollt ihr, Don Guancho Rodriguez?« forschte der Vorsitzende des Gerichtes finster, aber doch mit unwillkürlichem Respekt.
»Ich möchte für die jungen Leute hier ein gutes Wort entlegen,« erwiderte der Alte. »Ich kenne sie zwar nicht; aber wirklich, man sieht es doch ihren Gesichtern an, daß sie keine Spitzbuben und Verräter sind! Es sind ja Ausländer — und noch so jung!«
»Ja, Deutsche sind es, Hunde von Deutschen,« knurrte der Richter, der einen persönlichen Haß auf die Deutschen hatte, »und ihre Verräterei ist erwiesen.«
Don Guancho wandte alle seine Beredsamkeit auf, die Angeklagten zu retten; denn er sah wohl, daß hier keine Beweise Vorlagen und nur das Zeugnis schurkischer Menschen, denen man den persönlichen Rachedurst anmerkte, den Ärmsten den Hals brechen sollte. Aber unglücklicherweise war der Rebellenoffizier diesem Don Guancho nichts weniger als gewogen: er war eifersüchtig auf den Ruhm des alten Generals und zürnte ihm, daß er nicht tätig mit den Rebellen gemeinsame Sache machte. So wurde des edlen Mannes Fürsprache den unschuldigen Jünglingen eher zum Schaden als zum Nutzen, und das Urteil lautete auf Erschießen, und zwar sollte es ohne Verzug vollzogen werden. Betrübt und finster zog sich Don Guancho zurück.
DIE Verurteilten wurden abgeführt, während die Zurüstungen zum Blutgericht getroffen wurden: diese waren von kurzer Dauer; es handelte sich nur darum, den Ort der Hinrichtung zu bestimmen und eine Abteilung Soldaten zum Vollzug derselben zu kommandieren. Im übrigen gewährte man den Todeskandidaten bloß eine einstündige Frist zu einer Henkersmahlzeit und zur Vorbereitung auf ihr Ende; zu letzterer sollte ihnen ein Priester behilflich sein, der ihnen denn auch wacker Trost zusprach und sie auf das ewige Heil hinwies. Was die Mahlzeit betraf, so fand sie diesmal angesichts des grausamen und ungerechten Urteils wenig Zuspruch; war doch die Seele der Verurteilten zu sehr umdüstert, um noch auf leibliche Sättigung irgend einen Wert zu legen.
Die Stunde war bald abgelaufen, und begleitet von einer großen Volksmenge wurden die Bedauernswerten auf einen freien Platz vor die Stadt geführt, an eine Mauer gestellt und entfesselt, während man ihnen die Augen verband. Manuel machte alsbald einen Fluchtversuch; während seinen jungen Gebietern die Augen verbunden wurden und man seiner weniger achtete, sprang er mit einigen Sätzen in die Volksmenge, die, stets bereit, sich gegen die jeweilige Obrigkeit zu entscheiden, ihm willig Raum schuf, um sich hinter ihm alsbald wieder wie eine Mauer zusammenzuschließen.
Natürlich wurde sofort eine Abteilung Soldaten zur Verfolgung des Entwichenen entsandt; aber den Häschern ward es viel schwerer, sich einen Weg durch die Menge zu bahnen, die sich diesmal nur langsam und widerstrebend auseinanderdrängen ließ. So gelang es dem Spanier, aus der Stadt zu entkommen und den Wald zu erreichen. Hier aber drohte ihm eine neue Gefahr: im Waldesschatten lagerte ein größerer Trupp der Rebellen, und Manuel erblickte in der Hast seiner Flucht die Feinde erst, als er selber schon von ihnen gesehen war. Rasch machte er kehrt; statt aber rechts oder links auszubiegen, eilte er wieder der Stadt zu; denn plötzlich war ihm der Gedanke gekommen, daß es eigentlich unrecht sei, das eigene Leben zu retten und sich seiner Herren nicht weiter anzunehmen; er beschloß, irgendeinen, wenn auch tollkühnen Versuch zu ihrer Befreiung zu machen, sollte er darüber auch selber seine kaum erlangte Freiheit wieder verlieren. Gewiß ließ sich das Volk, das so willig seiner Flucht Vorschub geleistet hatte, auch zu einem Handstreich zugunsten seiner Leidensgefährten aufreizen.
Aber Manuels Pläne waren vergeblich: seine Eile war den Truppen im Walde von Anfang an als höchst verdächtig ausgefallen, und sein schneller Rückzug bestärkte den Verdacht; im Nu saßen einige Soldaten zu Pferde und jagten ihm nach. Binnen kurzem hatten sie denn auch den keuchenden Flüchtling erreicht und schleppten ihn vor ihren Anführer.
Dieser bekleidete einen hohen Rang in der Rebellenarmee und war ein mildgesinnter, wohlwollender Mann. — Als Manuel zu ihm geführt wurde, vernahm der Spanier da und dort einige verwunderte Ausrufe; mehrere Soldaten schlossen sich ihm an, und er hörte, wie sie einander zuriefen: »Das ist einer der drei Schützen vom Islote! Caramba! Ein Teufelskerl; den sollten wir für uns gewinnen!«
Die Leute, die sich derartig äußerten, waren selber an dem Kampf um den Islote beteiligt gewesen, und einzelne von ihnen waren damals auch in die Gefangenschaft der Regierungstruppen geraten, aber mit Hilfe guter Freunde in Nueva Valencia alsbald wieder entkommen.
Während Manuel vom General verhört wurde, sahen Ulrich und Friedrich dem Tode ins Angesicht. Einen Aufschub hatte Manuels Flucht freilich bewirkt; zunächst wurden den Jünglingen alsbald die Füße gefesselt, damit sie nicht ebenfalls entkämen; dann wartete man den Erfolg der Jagd auf Manuel ab, um alle drei zugleich hinzurichten.
Inzwischen nahm das Gemurmel in der Volksmenge zu; die gleichmäßige, kaltblütige Ruhe der blühenden Jünglinge erweckte ihnen überall Wohlwollen. Die Venezolaner sind zwar leicht erregbar und, zum Zorn gereizt, rascher Gewalttaten fähig, aber die kalte Grausamkeit der Spanier ist ihnen im allgemeinen fremd; das kann man schon bei den Stiergefechten beobachten, die in Venezuela ziemlich unblutig verlaufen, und bei denen selbst das Leben der Stiere geschont wird.
Einer raschen Hinrichtung hätte die Menge wohl ruhig zugesehen; je länger sich aber die Sache hinzog, desto mehr Stimmen wurden laut: »Was haben sie eigentlich getan?« — »Für die Regierungstruppen gekämpft? Deswegen erschießt man einen doch nicht!« — »Es ist eine barbarische Schändlichkeit, die armen Burschen so lange auf den Tod warten zu lassen!« — »Und wie mutig und ruhig sie sind, obgleich noch halbe Knaben! Wahrhaftig, man sollte es nicht dulden, daß man die jungen Helden erschießt.« — »Wenn ihr Männer wäret, so ließet ihr's nicht zu! Gebt acht, wir Frauen werden uns noch ins Mittel legen: so jung und so schön, und grausam hingemordet werden!«
So schwirrten die Stimmen durcheinander, und der Offizier, der persönlich die Hinrichtung leitete, merkte, daß das Publikum sich zu erhitzen anfing; er wartete daher nicht weiter auf die Einbringung Manuels, sondern erteilte rasch seine Befehle.
Ulrich und Friedrich hatten einen schweren Stand; sie bewahrten zwar äußerlich ihre Ruhe, aber innerlich wurden sie von den widersprechendsten Gefühlen umgetrieben. Es ist schwer, unter blauem Himmel, in lachendem Sonnenschein, im Vollgefühle der Jugendkraft, an den nahen Tod zu glauben! Und hatten sie sich auch mit dem Gedanken vertraut gemacht, — Manuels Flucht, die lange Verzögerung und das Murren der Menge, aus dem heraus hier und da ein verständlicher Satz an ihre Ohren drang, belebte aufs neue ihre Hoffnung, und nun war es ihnen nicht leicht, sich darein zu finden, daß alles umsonst sein sollte und ihr Schicksal dennoch besiegelt sei.
Aber was war noch zu hoffen, als ein möglichst rasches Ende? Schon standen die Soldaten in einer Reihe mit angelegten Gewehren und warteten nur noch des Kommandos »Feuer!« Ach! und diesen mehr als mittelmäßigen Schützen war es wohl zuzutrauen, daß sie ihre Opfer nicht einmal sofort tödlich trafen!
Wahrlich, es waren keine angenehmen Gedanken, die in diesen letzten Minuten die Seelen der beiden Verurteilten erfüllten, und sie waren nahe daran, ihre ganze Widerstandskraft einzubüßen; namentlich Friedrich fühlte allmählich seine Augen feucht werden und seine Kniee zittern; aber jetzt war der letzte Augenblick gekommen. Hoch erhob der finster blickende Offizier den Arm und öffnete die Lippen, um das todbringende Kommandowort auszurufen.
Da donnerte eine Stimme: »Halt!« Es war Don Guancho Rodriguez, der sich mit kräftigen Armen Bahn durch die Menge brach und plötzlich vor dem Offizier stand.
»Was untersteht Ihr Euch?« schrie dieser ihn wütend an. »Hier habt Ihr nichts mehr zu befehlen, die Zeiten sind vorbei!« Und als ob er fürchtete, seine Opfer könnten ihm entrissen werden, rief er sofort mit lauter Stimme: »Feuer!«
Die Soldaten, die, durch die plötzliche Störung verwirrt, zum mindesten eine nochmalige Verzögerung der Hinrichtung erwartet hatten, legten in aller Eile wieder an und gaben Feuer, ohne weiter zu zielen.
Eben in diesem Augenblick rannte Manuel, der gleichzeitig mit Don Guancho erschienen war, über den Platz auf seine jungen Herren zu.
So kam es, daß die ohnehin schlechten Schützen mit ihren mangelhaften Gewehren weiter kein Unheil anrichteten, als daß sie den treuen Manuel durch einen Streifschuß am Arme verwundeten.
»Carajo!« rief Manuel erzürnt den Soldaten zu. »Paßt doch auf, wenn da Menschen laufen! Wie leicht hättet ihr ein Unglück anrichten können.« Er vergaß ganz, daß ein zum Tode Verurteilter solche Rücksichten eigentlich weder fordern noch erwarten durfte.
Der kommandierende Offizier jedoch war wütend über die Erfolglosigkeit der Salve und befahl, die Gewehre wieder zu laden, da seine Soldaten keine Magazingewehre besaßen. Don Guancho, aufs höchste empört und erschreckt durch das vorhergegangene rasche Kommando des Befehlshabers, hatte bereits seine Dazwischenkunft für gescheitert angesehen. Als er nun sah, daß seine Schützlinge noch unversehrt waren, rief er nochmals donnernd: »Halt!« und legte zugleich seine Eisenfaust schwer auf den Arm des Offiziers.

»Diese leichtfertige Hinrichtung wird nicht stattfinden,« sagte er drohend. »Die Sennores sind schuldlos, und die Klage war verleumderisch. Hier sind die Zeugen!«
Gleichzeitig erschien auf dem Platze ein Trupp Soldaten, denen die Menge bereitwilligst Platz machte.
Don José de Alvarez, der mit Diego und Lopez zugegen war, um sich am Sterben seiner Feinde zu weiden, rief nun dem Offizier zu: »Exzellenz werden sich doch nicht durch Leute behindern lassen, die Eure Angelegenheiten nichts angehen?«
»Fällt mir nicht ein!« rief der Offizier. »Das Urteil ist gesprochen, und ein Zeugenverhör ist nun nicht mehr am Platze: dem Recht muß sein Lauf gelassen werden.«
»Ja! dem Rechte, aber nicht dem Unrecht!« donnerte eine herrische Stimme hinter dem Offizier. »Tretet ab, Sennor Capitano: ich will hier das Kommando übernehmen.« Erschrocken wandte sich der Angeredete um und grüßte verdutzt den General, seinen Vorgesetzten, der hochaufgerichtet vor ihm stand.
Der General aber wandte sich an einige der neu angekommenen Soldaten: »Sind das die Verteidiger des Islote, die Mitkämpfer Don Manuels, den ich soeben auf euer Zeugnis hin freiließ?«
»Sie sind es!« bestätigten die Gefragten. »Wir haben sie mit eigenen Augen gesehen, als wir damals in Gefangenschaft der Regierungstruppen gerieten, denen wir seither glücklich entronnen sind.«
»Und ihr bleibt bei eurer Aussage, daß sie nur auf die Pferde geschossen haben und keinen Menschen verwundeten?«
»Sie schossen uns fast alle Pferde tot, und wenn sie gewollt hätten, hätten ebensoviele von uns ins Gras gebissen; denn solche Schützen gibt es sonst nicht mehr. Aber sie wollten nicht; nur dem Herrn Mestizen dort haben sie einen Finger weggeschossen.«
»An dem liegt uns nichts!« sagte der General geringschätzig.
Alvarez knirschte mit den Zähnen.
»Also, ihr Leute! Jener Mestize dort hat vor Nueva Valencia einen unserer Generäle angelogen, diese harmlosen Reisenden seien Regierungsspione, genau wie es der freche Verleumder hier wiederum gemacht hat. Unsere Leute griffen die jungen Sennores an, und diese waren gezwungen, sich zu wehren; und dennoch haben sie mit Absicht das Leben unserer braven Soldaten geschont und nur auf die Pferde geschossen. Es wäre schändlich, das Blut solcher edelmütiger junger Helden zu vergießen. Dank sind wir ihnen schuldig! Die Herren Verleumder sollen machen, daß sie aus dem Bereiche meiner Macht kommen; die Gefangenen aber werden sofort auf freien Fuß gesetzt!«
Alvarez, Diego und Lopez waren im Nu verschwunden, denn ein drohendes Gemurmel hatte sich in der Menge erhoben; unter Jubelrufen aber drängten sich die Leute um die hochaufatmenden Brüder, denen Manuel die Stricke durchschnitt.
»Nun hast du recht behalten!« sagte Ulrich zu seinem Bruder. »Eine Notwehr, wie ich sie verstand, hätte uns heute das Leben gekostet, nur dadurch sind wir heute gerettet worden, daß wir damals deinem mildherzigen Rate folgten und unsere Angreifer schonten.«
Der General ließ sich hierauf die Befreiten vorführen und bat ihnen das voreilige Verfahren eines übereifrigen Offiziers ab, zugleich ihnen Glück wünschend, daß er rechtzeitig zu ihrer Befreiung gekommen sei, und ihnen seine Bewunderung über ihr mutiges Verhalten hier und auf dem Islote ausdrückend; ihre Gewehre und Maultiere wurden ihnen auf Befehl des Generals wieder ausgefolgt. Don Guancho aber bat sie, für die nächsten Tage seine Gäste zu sein, und führte sie alsbald in seine Wohnung. Hier wurde Manuels Wunde verbunden, die sich nur als eine Hautschürfung erwies und ihm wenig Schmerzen verursachte. Alle drei erholten sich rasch von den ausgestandenen Todesschrecken und gaben sich dem Vollgefühl der wiedererlangten Freiheit hin.
Don Guancho Rodriguez war von Hause aus ein Llanero. Ein Mann von scharfem Verstande und ungewöhnlicher Körperkraft, besaß er ein treues, edles Gemüt und dabei eine den Kreolen meist fremde Bescheidenheit. Als Jüngling tat er es im Reiten und Schwimmen und namentlich auch im Jagen allen seinen Altersgenossen zuvor: mit Leichtigkeit riß er den wilden Stier am Schwanze zu Boden oder bändigte ihn von ferne mit seinem nie fehlenden Lasso; am Apure nahm er einst den Kampf mit drei Jaguaren zumal auf und blieb Sieger.
So war er schon in jungen Jahren ein bewunderter Held, zugleich aber wegen seines offenherzigen, freundlichen Wesens und seiner Gastfreundschaft allgemein beliebt. Das Jahr 1868 brachte ihm Kriegsruhm und den Generalstitel, denn er war es, der mit nur zweihundert Lanzenreitern die von zweitausend Mann besetzte Stadt Calabozo erstürmte.
Das war der Mann, dessen großmütiges Herz sich den Unterdrückten und ungerecht Verfolgten zuwendete, der auch heute, sobald er von dem Prozesse gegen unsere Freunde vernommen hatte, Erkundigungen einzog und in der Überzeugung, daß es sich um kein todeswürdiges Verbrechen handle, für die Gefährdeten eintrat.
Als sein erster Versuch ihrer Rettung scheiterte, ließ er es keineswegs dabei bewenden; er suchte seine Freunde auf, er ließ die Bevölkerung von Calabozo von den Vorgängen und seiner Meinung darüber unterrichten und hatte alle Aussicht, die Bluttat noch im letzten Augenblicke gewaltsam verhindern zu können, als ihm noch unerwartete Bundesgenossen kamen. Auf Manuels Bericht hin war der Rebellengeneral, von Bewunderung für die Helden vom Islote erfüllt, in die Stadt eingerückt und lieh dem von ihm hochgeachteten Greise williges Gehör. Er erklärte hierauf dem erfreuten Don Guancho, daß es eben seine Absicht sei, den Verurteilten womöglich noch Rettung zu bringen, und so kam es, daß Don Guancho und Manuel in banger Sorge und Hoffnung der verhängnisvollen Stätte zuflogen und eben noch im rechten Augenblick dort ankamen. Der General folgte ihnen mit denjenigen Soldaten, die als Augenzeugen das Verhalten der ungerecht Beschuldigten bei jenem Kampfe um den Islote bestätigen konnten. Auf solche Weise wurden denn drei junge Menschenleben gerettet, dank den Bemühungen eines edlen Greises und eines treuen Dieners, in letzter Linie aber infolge ihres eigenen edelmütigen Verhaltens, als sie auch aus der Notwehr keinen Grund machten, Menschenblut zu vergießen.
DER 20. Oktober, den unsere Freunde im gastfreundlichen Hause des Generals Rodriguez verbrachten, war ein Sonntag. Nachmittags führte sie ihr Beschützer auf sein zwei Stunden entferntes Hato »Los Tamarindos«. »Hato« bedeutet auf spanisch so viel wie Landgut.
Unterwegs machte sich Don Guancho ein Vergnügen daraus, seine Begleiter auf verschiedene merkwürdige Bäume aufmerksam zu machen. »In diesem glücklichen Lande,« sagte er scherzend, »kann man die meisten Handwerker und Fabriken als überflüssig entbehren; denn was die Industrie in Europa mühsam erzeugt, das wächst hier auf den Bäumen, und zwar schon ganz gebrauchsfertig. Man sollte meinen, hier sei das Land Schlaraffia, wenn nur die vielen wilden und giftigen Tiere und Insekten nicht wären: die erinnern einen daran, daß man im Reiche der Wirklichkeit lebt. Die Indianer, die allerdings sehr genügsam sind, bedürfen weder einer Spinnerin noch eines Webers noch eines Schneiders; sie holen sich ihre dürftige Kleidung fertig von den Bäumen. Seht hier diese Palme; auf ihr wachsen die schönsten Hüte, wie man sie sich zum Schutze gegen die Sonnenstrahlen nicht besser ausdenken könnte; dort ist die Dachpalme, die uns die Dächer für unsere Hütten liefert, und da wachsen Besen und Fächer — alles auf Palmen. Die Morichepalme, die ihr dort seht, ist unser Lebensbaum; sie allein könnte einem bescheidenen Menschen für alle Bedürfnisse genügen, ihre Früchte sind ausgezeichnet, ihr Mark ist nahrhaftes Mehl, ihr Saft ist Wein, ihre Rinde besteht aus Fischnetzen und Hängematten, ihre Blätter sind Dachziegel, und sie selber kann als luftige und doch regendichte Sommerwohnung bezogen werden.
»Und unser Filterbaum! Betrachtet einmal die Früchte dieses Baumes: sehen sie nicht aus wie künstlich geschnitzte Trichter? Und da sie mit einem schönen, schwammigen Gewebe ausgepolstert sind, könnt ihr sie zum Filtrieren des trüben Llanoswassers benutzen. Aber jetzt paßt auf: habt ihr schon so etwas gesehen? Das ist unser Bürstenbinder!«
Ulrich und Friedrich mußten laut auflachen, als sie den Baum erblickten, denn es sah gar zu komisch aus, wie er voller striegelartiger Kratzbürsten hing, als sei er in der Tat von einem Bürstenbinder zur Ausstellung seiner Waren benutzt worden.
»Und hier holen wir uns Schüsseln, Teller und Flaschen aller Größen herunter,« fuhr Don Guancho fort, indem er auf eine Crescentia Cujete wies, die von den Eingeborenen »Totumo« genannt wird.
Inzwischen hatten sie den Hato »Los Tamarindos« erreicht und erqickten sich an der herrlichen Milch und dem frischbereiteten Käse, die hier erzeugt wurden. Hierauf zeigte ihnen der General mit dem Stolz eines Großbauern seine Rinderherden und seine Schweine nebst allen anderen Sehenswürdigkeiten des Ranchos. In Hängematten wurde die Nacht verbracht, und da sich unsere Freunde nicht länger halten ließen, schenkte ihnen Don Guancho aus seinen reichen Vorräten, was er für das Notwendigste hielt, nämlich Patronen, sowohl für die deutschen Magazingewehre, deren er selber einige besaß, als auch für die Büchsen, die ihnen in Nueva Valencia verehrt worden waren. Dann verabschiedete er sich aufs herzlichste von ihnen, ihre lebhaften Dankesbezeigungen energisch abwehrend und ihnen viel Glück zur Reise wünschend.
Er hätte sie gern ein Stück Wegs begleitet, aber eine Karte, die ihm die vorübergehende Ankunft eines Freundes mitteilte, berief ihn unverzüglich nach Calabozo zurück.
Äußerst angenehm waren unsere Freunde überrascht, als sie nach halbstündigem Ritt durch die Llanos vor sich einen herrlichen Urwald sahen, dessen Schatten sie bald darauf aufnahm. Wie wohltuend erschien ihnen außer der angenehmen Kühle der liebliche Anblick der blütenreichen Orchideen, die bunt durch die geheimnisvolle Dämmerung leuchteten. Und welche abwechslungsreiche Pracht der Bäume! Hier die zarten Mimosen, deren Blätter sich bei der leisesten Berührung schlossen, dort der Guazimo, aus dessen unregelmäßigen Hauptästen die Nebenäste wie Orgelpfeifen schnurgerade in die Höhe schossen; dann wieder der riesige Algarrobo und der niedrige Samanbaum mit seiner prachtvollen weitverzweigten Krone.
Manuel ritzte die Rinde eines Drachenblutbaums und zeigte seinen jungen Herren den blutigroten Saft, der aus der Wunde floß. Auch den Guazimo schnitt er an, um den unter seiner Rinde befindlichen süßen Gummi zu allseitiger Erquickung zu gewinnen. Salvado wurde sodann auf die Bäume geschickt, um einen reichen Vorrat wohlschmeckender Früchte zu beschaffen.
Und welches Leben in diesem buntfarbigen Waldesdunkel! Der schöne Carpintero, der rotköpfige Specht, hämmerte an den Stämmen herum, zahlreiche Kolibri schwirrten leuchtend, in allen Farben schillernd von Blüte zu Blüte, mit der feinen Zunge die Insekten aus den Kelchen herausholend, ohne sich niederzusetzen. Kleine braune Tauben und blaue Azulejo hüpften durch die Zweige, und der feuerrote Turupial glühte durch das Laub, hinter dem er seinen entzückenden Gesang hervorschallen ließ.
Einen unbeschreiblichen Lärm aber vollführten die zahllosen Papageien aller Arten, die in ganzen Schwärmen den Wald durchzogen und von allen Zweigen ihr prächtiges Gefieder leuchten ließen.
Aber auch das Unangenehme machte sich unter all diesen Herrlichkeiten bemerkbar, das war die Pica-pica, an deren Schoten die Reiter alle Augenblicke vorbeistreiften, wobei ihnen jedesmal eine Anzahl feiner Brennhaare in der Haut stecken blieb, die bei weitem peinlicher juckten als die der europäischen Brennesseln.
Plötzlich war den Reisenden der Weg versperrt: sie standen an einem sieben Meter hohen steilabfallenden Flußufer; unten wälzte sich der etwa dreißig Meter breite trübgelbe Oritucu.
Obgleich Don Guancho sie vor diesem Gewässer ganz besonders gewarnt hatte, wollten sie doch keinen weiten Umweg machen; denn bei der geringen Breite des Stromes hofften sie unangefochten hinüberzukommen. Manuel steckte ein Stück Kautabak zwischen die Zähne, da dieses Mittel, wie er versicherte, unempfindlich mache gegen die Bisse und Schläge der schrecklichen Fische, die sich in diesem Flusse besonders zahlreich vorfinden sollten.
Bald war eine Stelle gefunden, an der sich leicht hinabklimmen ließ. Friedrich wagte sich als der erste ins Wasser; er kam auch glücklich hinüber; nur sein Maultier empfing eine Wunde durch den Biß eines Caribenfisches.
Der nachfolgende Ulrich hatte schon mehr zu leiden: das Blut aus der Wunde von Friedrichs Maultier zog eine Unmenge der bösartigen Cariben an, die mit ihrem kleinen, aber aus sehr scharfen Zähnen bestehenden Gebiß nicht bloß sein Reittier angriffen, sondern auch ihm selbst mehrere schmerzhafte Wunden an den Beinen beibrachten. Diese Cariben sind äußerst blutdürstig und greifen alles Lebende an. Nicht nur Fische, Schildkröten und Wasservögel fallen ihnen zum Opfer, sie wagen sich selbst an den Kaiman, dem sie Zehen und Schwimmhäute abbeißen. Fingerdicke Stecken, ja, feste stählerne Angelhaken durchbeißen sie ohne Schwierigkeit.
Glücklicherweise war Ulrich schon dem jenseitigen Ufer nahe; plötzlich aber schrie er laut auf vor Schmerz: starke elektrische Schläge durchzuckten seinen Körper. Entsetzt blickte er ins Wasser und sah einen fast zwei Meter langen Aal, von dem die elektrischen Entladungen ausgingen, so oft er mit dem Kopf oder Schwanz Ulrichs Beine berührte; noch mehrere dieser elektrischen Gymnoten, von den Venezolanern »Tembladores« genannt, schwammen daher und lähmten das Maultier durch ihre furchtbaren Schläge. Die neugierigen Zitteraale waren aus ihrer Ruhe aufgestört worden, als die Saumtiere im Durchwaten des Flusses das Wasser aufwühlten, und nun griffen sie die Ruhestörer in empfindlicher, ja, gefährlicher Weise an. Ulrich, anfangs von Schrecken und Schmerz gelähmt, gewann bald seine Kaltblütigkeit wieder, mit einem Satze sprang er ans Ufer, wo er erschöpft niedersank, während Friedrich dem Maultiere heraushalf. Auch dieses legte sich sofort zu Boden.
Am schlimmsten war Manuel daran: sein Kautabak erwies sich als völlig unwirksam sowohl gegen die Bisse der Cariben als gegen die Schläge der Tembladore. Er hatte kaum die Mitte des Flusses erreicht, als der Angriff der Cariben erfolgte. Er befand sich in wirklicher Lebensgefahr; zum mindesten schien sein Maultier unrettbar verloren; denn es mußte von Blutverlust erschöpft sein, ehe es das Ufer gewann, dem es mit höchster Eile zustrebte.
Die Gymnoten erschienen hier als Lebensretter, denn ihre große Zahl hatte bald mit den Cariben aufgeräumt, die, von den elektrischen Schlägen betäubt, zum Teil sogar getötet, von ihren Opfern abließen; aber nun wurden Manuel und sein Maultier von ihren Lebensrettern um so übler geplagt. Der Spanier fluchte, schrie und jammerte, während sein Tier fünf Schritt vom Ufer, wie unfähig, sich weiter zu schleppen, stehen blieb und alsbald in die Kniee sank. Es blieb Manuel nichts übrig, als in das Wasser zu springen, obgleich er nun auch am ganzen Leib den Schlägen der Zitteraale ausgesetzt war. Er riß das Maultier empor und war mit ein paar Sätzen so weit, daß Friedrich und Ulrich, der sich wieder aufgerafft hatte, ihm ans Land helfen konnten.
Das Maultier, das sie auch emporzogen, war von den Bissen der Cariben übel zugerichtet. Nachdem Manuels Wunden verbunden waren, erhielten auch die Tiere die beste Pflege. Ulrich war schon zuvor von Friedrich verbunden worden.
Unerklärt ist es, wie es möglich ist, daß die Tembladore gegen die elektrischen Schläge ihres eigenen Körpers, die in voller Stärke durch ihren Leib hindurchgehen, und gegen die ihrer Artgenossen unempfindlich sind.
Doch die Schrecken waren noch keineswegs zu Ende: unfähig sich zu regen lag Manuel da, als plötzlich der Boden unter ihm schwankte und sich hob. Der erschrockene Spanier rollte zur Seite, und ein fast fünfzig Meter langer Kaiman erhob sich aus der Erde, die sich als der eingetrocknete Schlamm erwies, in den sich das Krokodil zum Sommerschlaf vergraben hatte. Das grimmige Amphibium dachte jedoch an keinen Angriff, blöde sah es sich um, sperrte den entsetzlichen Rachen gähnend auf, um ihn gleich wieder zuzuklappen; dann kroch es schwerfällig dem Flusse zu und plumpste vom hohen Ufer hinab ins Wasser, so daß der Gischt hoch aufspritzte.
MEHRERE Stunden dauerte es, namentlich bei Manuel, bis die Folgen des schlimmen Abenteuers im Oritucu so weit überwunden waren, daß an die Weiterreise gedacht werden konnte. Erst um die Mittagszeit erfolgte der Aufbruch; von einem Besteigen der Maultiere war keine Rede, und Manuels schwerverwundetes Tier durfte auch nicht mit Gepäck belastet werden.
»Es ist nur gut,« meinte Manuel im Weitermarsch, »daß nicht auch noch der Stachelrochen an uns geraten ist; mit seinem skorpionartigen Schwanz, der mit Widerhaken versehen ist, bringt er einen äußerst schmerzhafte und gefährliche Wunden bei, und man muß froh sein, wenn man mit einem giftigen Geschwür, das sehr schwer heilbar ist, und mit einigen Krampfanfällen davonkommt; denn es ist keine Seltenheit, daß man einer solchen Wunde erliegt.«
Bald hörte der Urwald auf, und die Llanos begannen sich wieder in unendlicher Öde auszudehnen, hier und da unterbrochen von größeren Wäldern der Cobijapalme.
Meist ging der Weg am Rio Guarico hinab, der vielfach von lustig sich tummelnden Süßwasserdelphinen belebt war; aber auch zahlreiche Krokodile hausten an seinen Ufern. In der Steppe fanden sich oft in der Nähe der Waldungen ganze Kolonien seltsam geformter Termitenhügel; die einen glichen plumpen Kegeln, die anderen unregelmäßigen Halbkugeln, wieder andere zeigten die Form ungeschlachter Riesenpilze. Manuel schoß eine Kugel in einen solchen Termitenbau, um seinen jungen Herren einen Beweis von der Festigkeit der Lehmwandungen zu geben. Wirklich blieb die Kugel im Lehme stecken, ohne auch nur bis in einen der zahlreichen Gänge im Innern eindringen zu können.
Da die Reise, um die langsam sich erholenden Maultiere zu schonen, in sehr gemütlichen Tagemärschen vollführt wurde, brauchten unsere Freunde volle fünf Tage, um San Fernando de Apure zu erreichen, während sie unter gewöhnlichen Verhältnissen von Los Tamarindos aus in drei Tagen hätten hingelangen können.
Am Vormittag des 26. Oktobers trafen sie endlich dort ein.
San Fernando ist eine kleine, aber bedeutende Handelstadt und vermittelt die gesamte Ein- und Ausfuhr ausgedehnter Länderstrecken. Von hier aus nimmt auch der berühmte Varinasknaster seinen Weg nach Europa. Bis hierher hatte Manuel unsere Freunde zu begleiten; es wurde ihm freilich der Abschied sehr schwer; anderseits hätte er doch auch die Weiterreise durch die ihm völlig unbekannten Urwälder des Orinoko gescheut.
Über den Sonntag wollten Ulrich und Friedrich hier verweilen, und so lange beschloß auch Manuel zu rasten.
Sehr merkwürdig erschien es unseren Freunden, in den Hühnerhöfen die Zamurosgeier zu beobachten. Diese tranken und fraßen friedlich mit den Hühnern und waren dabei so frech, daß sie nicht zu verscheuchen waren, wenn man auch mit Steinen nach ihnen warf; kaum daß sie ein wenig aufflatterten, um nicht unmittelbar getroffen zu werden. Anderseits waren die Raubvögel wiederum so feige, daß sie vor den Schnabelhieben der Hühner zurückwichen, obgleich ein einziger von ihnen den ganzen Hühnerbestand hätte morden können.
In der Posada riet Manuel, das Gepäck wegen der Termiten auf Holzstücke zu stellen. In der Nacht erwachte Friedrich an einem Geräusch. Als er Licht machte, sah er wohl an die zwanzig Ratten, die in aller Ruhe die Ballen anzunagen begannen. Friedrich weckte alsbald seinen Bruder und Manuel, und nun begann eine Jagd, die aufregend genug war; denn die großen Ratten wichen durchaus nicht, griffen vielmehr ihre Feinde an, wobei sie Sätze machten, daß sie manchmal beinahe die eine oder andere Nasenspitze erreichten. Einige schmerzhafte Bisse in Beine und Hände bekam jeder der drei Rattenfänger ab, bis endlich alle Störenfriede erlegt waren; dann erst konnte wieder ans Schlafen gedacht werden.
Der Sonntagmorgen brachte die unangenehme Überraschung, daß Manuels Vorsicht das Gepäck durchaus nicht vor den Termiten bewahrt hatte; diese hatten über Nacht tiefe, mit Lehm ausgekleidete Gänge mitten in die Ballen geführt und bereits einen großen Teil der Vorräte und die Holzstiele einzelner Werkzeuge teils entführt, teils ausgehöhlt. Ganze Häuser fallen diesen unheimlichen Gästen in kurzer Frist zum Opfer: sie höhlen Balken, Bretter und Möbel aus, ohne daß man äußerlich etwas davon merkt, bis alles in sich zusammenfällt. Merkwürdigerweise sind die Ameisen die schlimmsten Feinde der Termiten und vertilgen diese zu Tausenden.
Die Vorräte und Werkzeuge, die von den Termiten gestohlen oder zerstört worden waren, ließen sich zum Glück durch Neuankäufe ersetzen. Manuel wurde von den dankbaren Knaben reichlich mit allerlei Dingen, die ihm Freude machten, beschenkt, da sein Herr ihm strengstens verboten hatte, Geld von ihnen anzunehmen.
Ulrich und Friedrich wollten sich zu Schiff bis in den Orinoko begeben und von da zu Lande durch den Urwald stromaufwärts dringen. Die drei Maultiere erklärte Manuel im Auftrag des Herrn Lehmann für ihr bleibendes Eigentum. Zwei davon sollten sie als Reittiere benutzen und eines als Lasttier, da es notwendig sei, sich auf den zum Teil ziemlich weit voneinander entfernten bewohnten Plätzen stets reichlich mit Lebensmitteln und Munition zu versehen. Ferner erklärte er es für unumgänglich, daß sie sich mindestens zwei zuverlässige Indianer als Diener mieteten, ehe sie den äußerst gefährlichen Ritt durch den Urwald anträten.
Die Jünglinge widersprachen ihm nicht, um ihn nicht zu beunruhigen; im stillen aber dachten sie, dieser immerhin bedenklichen Begleitung entraten zu können; kühn genug waren sie, ein Unternehmen zu wagen, das bisher unerhört war.
Am Montag, den 28. Oktober, verabschiedeten sie sich in aller Frühe von Manuel, dem sie noch viele Grüße und den Ausdruck ihres wärmsten Dankes an Herrn Lehmann auftrugen; dann bestiegen sie ein Segelschiff, das den Apure hinabfuhr.
Manuel winkte ihnen tränenden Auges nach, solange das Schiff noch zu sehen war.
ULRICH und Friedrich hatten sich an ihren spanischen Gefährten, der ihnen mehr Freund als Diener gewesen war, so sehr gewöhnt, daß ihnen der Gedanke schwer fiel, nunmehr ihre Reise allein fortsetzen zu müssen, wenn sie auch die Gefahren nicht scheuten, denen sie entgegengingen. So fuhren sie stundenlang dahin, ihren Gedanken nachhängend, nach und nach jedoch nahm die Landschaft an beiden Seiten des Flusses, namentlich aber am rechten Ufer einen so großartig wilden Charakter an, daß ihre Aufmerksamkeit völlig davon gefesselt wurde und sie sich in lebhaften Ausrufen der Überraschung ergingen, einander auf ihre Beobachtungen aufmerksam machend.
Sie hatten geglaubt, den Urwald genügend kennen gelernt zu haben; nun aber sahen sie, daß er ihnen noch eine Fülle des Neuen zu offenbaren hatte. Die Urwälder, die sie bisher durchquert hatten, waren sozusagen zivilisiert gegen die Wildnis, durch die der Apure seine Fluten wälzt.
Das rechte Ufer zeigte sich von einem etwa anderthalb Meter hohen Gebüsch gesäumt, das meist aus kastanienblättriger Sauso bestand und so gleichmäßig sich hinzog, daß man glauben konnte, eine regelrecht beschnittene Hecke vor sich zu haben. Dahinter erhob sich der majestätische Wald in geheimnisvollem Dunkel, durchleuchtet von der Pracht farbenreicher Riesenblüten. Die Palmen waren, im Gegensatz zu den Wäldern der Llanos, hier äußerst selten.
Durch die Sausohecke hatten die Tiere des Waldes sich zahllose Durchgänge gebrochen, und hier konnte man die riesigen Jaguare, den Tapir, die Pekarischweine ihren Durst löschen sehen, sowie eine Menge unseren Freunden noch unbekannter Geschöpfe von den seltsamsten Gestaltungen mit drohendem Aussehen und funkelnden Augen. Nur langsam und zögernd wichen sie zurück, wenn das Schiff näherkam, so daß man sie aus geringer Entfernung mit Muße betrachten konnte.
»Das ist wie im Paradies!« rief Friedrich entzückt aus. »Diese Pracht einer wilden erhabenen Natur und darin das Leben und Weben aller Arten von Vögeln und Vierfüßlern, die kaum eine Scheu vor dem Menschen zeigen! Und dabei sind es größtenteils Wundertiere der jungfräulichen Wildnis, die man bei uns in keiner Tierbude, in keinem zoologischen Garten, ja, kaum in einem Museum zu sehen bekommt!«
»Ja,« sagte Ulrich, »bezaubernd ist dieses Schauspiel wohl, solange wir es vom sicheren Boot aus betrachten können; wenn wir uns aber bald mitten hindurch wagen sollen, wird es uns auch seine unheimliche und bedenkliche Seite zeigen.«
»O! Nur keine Angst! Du wirst sehen, wie herrlich es ist, den Gefahren in nächster Nähe zu trotzen; ich freue mich schon darauf.«
Der Reiz dieser niegesehenen, stets abwechslungsreichen Bilder verlor nichts von seiner Anziehungskraft, auch als die Fahrt durch die Wildnis schon mehrere Tage gedauert hatte. Hier und da sah man aus den Baumwipfeln herabhängend das Haupt einer Riesenschlange sich hoch in den Lüften wiegen; manchmal dehnte sich ein flacher Strand vor dem Gebüsche aus, da lagen dann ganze Herden ungeheurer Krokodile, regungslos mit weitaufgesperrten Kinnladen, als erwarteten sie, wie echte Schlaraffen, daß ihre Opfer ihnen von selber hineinspazierten. Auch der Strom selbst wimmelte von diesen gewaltigen Amphibien, und zwar waren es keine Kaimane, sondern echte, dem Nil- und Gangeskrokodil ähnliche Krokodile. Manche dieser Riesenechsen maßen zwischen sieben und acht Meter Länge.
Nicht selten sah man auf dem Wasser sich ganze Rudel von Wasserschweinen, Chiguire genannt, umhertummeln. Diese armen, wehrlosen Geschöpfe von der Größe unserer Hausschweine wurden in großer Zahl von den Krokodilen verschlungen — ein gräßlicher Anblick! Oft retteten sie sich dadurch, daß sie rasch umwendeten und in entgegengesetzter Richtung dem Ufer zu schwammen. Ihr unheimlicher Verfolger konnte im Wasser, namentlich gegen die Strömung, die Bewegung des Umkehrens nur langsam ausführen, während sie ihm am Lande leichter gelingt; dadurch entkam manches der geängsteten Chiguiren ans Ufer, freilich oft nur, um dort die Beute eines Tigers zu werden. Einzig die außerordentlich rasche Vermehrung der Wasserschweine erklärt es, daß sie, trotz aller ihrer furchtbaren Feinde zu Wasser und zu Lande, noch so zahlreich sind.
Merkwürdigerweise bemerkte man oftmals die harmlosen Geschöpfe am Ufer, wie sie sich furchtlos um ein träges Krokodil herumtrieben, wahrscheinlich, weil sie wußten, daß das Krokodil des Apure und Orinoko auf dem Lande niemals angreift, wenn es nicht gereizt wird.
Unheimlich klang das Rauschen der Panzerschuppen, wenn sich ein Krokodil am Ufer bewegte. Nicht selten sah man kleine schneeweiße Reiher auf den Amphibien sorglos umherspazieren.
Am zweiten Tage fuhr das Schiff an einer Insel vorbei, die einen wunderbar prächtigen Anblick bot, da Tausende von Flamingo, rosenfarbigen Löffelgänsen, Reihern und Wasservögeln in buntestem Farbenspiel sie belebten. Man meinte, sie könnten sich kaum regen, so dicht gedrängt standen diese Vögel. Dies war die Isla de Aves, die Vogelinsel, von der schon Humboldt berichtet.
Am Morgen des 1. Novembers sah man über dem Urwald im Süden die Granitfelsen von Curiquima, den »Zuckerhut« von Caycara und die Cerros del Tirano emporragen; das Schiff lief gegen Mittag in den Orinoko ein, und da es seine östliche Fahrt hinunter nach Ciudad de Bolivar, dem früheren Angostura, fortsetzte, wurden Ulrich und Friedrich mit ihrem Gepäck und den drei Maultieren ans Ufer gebracht; denn ihre Reise ging in entgegengesetzter Richtung, den Orinoko hinauf, zunächst südwestwärts, später fast geradeswegs gegen Süden.
Es war doch ein eigentümliches Gefühl für unsere Freunde, als sie sich nun ganz allein, wie ausgesetzt, im Urwalde befanden: ein rechter Trost waren ihnen ihre drei Maultiere und der zahme Brüllaffe. Sie sahen dem Schiffe nach, bis es bei einer Biegung dem Auge entschwand; dann aber schüttelten sie alle trüben Gedanken ab: sie waren doch wenigstens zu zweit, und es galt die Auffindung des geliebten Vaters. »Vorwärts!« hieß die Losung unentwegt.
NACHDEM die Maultiere zweckentsprechend bepackt worden waren, wobei den zum Reiten bestimmten Tieren nur die notwendigsten Mundvorräte und Munition, dem dritten aber das übrige Gepäck aufgeladen wurden, begann der Ritt durch den majestätischen Urwald.
Salvado, der Affe, befand sich meist bei Friedrich oder Ulrich, zuweilen machte er sich's auch auf dem Packtier bequem, das, stets von einem der Brüder an einer Leine geführt, hinter den Reitern herschritt. Hier und da vergnügte sich das Äffchen damit, einen überhängenden Zweig zu erhaschen und blitzschnell daran emporzuklettern, um dann von Ast zu Ast, von einem Baum zum anderen über den Köpfen der kleinen Karawane hinweg weiterzuturnen und sich gelegentlich wieder auf eines der Maultiere herabzulassen. Hierbei brachte es öfters die eine oder andere genießbare Frucht mit sich und trug somit nicht bloß zur Unterhaltung, sondern auch zur Lebensmittelversorgung bei.
Übrigens erwies sich Salvado auch als ein guter Warner; denn der Brüllaffe ist so furchtsam, daß er jede Gefahr durch ein klägliches Geschrei ankündigt.
Soviel als möglich ritten unsere Freunde am Flußufer hin, da dies der einzige Weg in jenen Urwäldern ist, die noch kein Weißer im Innern erforscht hat. Gebahnte Wege oder gar Straßen gab es freilich auch da nicht, und oft bildeten Gebüsch und Lianen solche Hindernisse, daß abgestiegen werden mußte und das Vorwärtskommen sich nur mühsam erkämpfen ließ. Sich zu weit vom Flusse entfernen bedeutet aber so viel, als sich im Urwald verirren, und in welch verzweifelter Lage ein Mensch sein muß, der sich in einem schier undurchdringlichen Walde verirrt hat, der eine Fläche bedeckt, die etwa viermal so groß ist wie das Deutsche Reich — das läßt sich denken!
So waren unsere Freunde nicht gar weit gekommen, als der Tag sich neigte, und da sie die Nacht in der Wildnis zubringen mußten, machten sie beizeiten halt, um sich für ein solches Wagnis gehörig vorzusehen.
Zunächst wurden die Maultiere entlastet und mit Futter und Wasser versorgt; dann wurde Holz und Reisig in Menge zusammengetragen, um ein Feuer zu unterhalten, das die Raubtiere in achtungsvoller Entfernung halten sollte.
Zu zweit war nicht wohl an Nachtwachen zu denken, da sonst entweder die Ruhezeit allzusehr verlängert oder die Kräfte übermäßig in Anspruch genommen werden mußten. Doch hatte Manuel versichert, daß die wilden Tiere das Feuer mieden außer den Krokodilen, die dadurch angezogen würden, immerhin aber ohne sich in gefahrbringende Nähe zu wagen; auch werde der Mensch in der Hängematte von keinem Vierfüßler des Urwalds angegriffen.
So zündeten denn die Jünglinge zu beiden Seiten ihrer Hängematten große Feuer an, indem sie die Vorsicht gebrauchten, langgestreckte Holzbeigen zu errichten, die nur nach und nach von den langsam fortschreitenden Flammen verzehrt werden konnten und mehrere Stunden zu brennen vermochten; nachdem sie dann aus ihren Vorräten eine Nachtmahlzeit gehalten hatten, empfahlen sie sich dem Schutze Gottes, um alsbald friedlich einzuschlafen.
Doch sollte ihre Nachtruhe nicht ungestört bleiben: kurz nach Mitternacht wurden sie durch einen furchtbaren Lärm jäh aus dem Schlummer geschreckt.
Die Feuer waren ziemlich herabgebrannt; der rote Glutschimmer, der von ihnen ausging, machte die Finsternis ringsum nur noch unheimlicher. Und in dieser Finsternis schien die Hölle los zu sein: ein Seufzen, Stöhnen, Flöten, Brüllen und Kreischen scholl wild durcheinander, als sei die ganze Tierwelt des Urwaldes in Streit miteinander geraten.
Salvado schrie ängstlich und flüchtete sich in Friedrichs Hängematte; die Maultiere waren unruhig, und selbst den mutigen Knaben zitterte das Herz; ein solcher Aufruhr, solch furchtbare Laute in hundertstimmigem Chor, — das war ihnen etwas zu Ungewohntes und Unerwartetes, um ihnen keine Besorgnis einzuflößen. Das Mark und Bein erschütternde Gebrüll ertönte in solcher Nähe, daß sie jeden Augenblick erwarteten, eine rasende Herde von Tigern, Jaguaren, Pumaen und wer weiß was sonst noch für Ungeheuern auf sich zustürzen zu sehen.
Sie strengten ihre Augen aufs äußerste an, um das Dunkel zu durchdringen; aber zu sehen war nichts, während das Brüllen, Wüten und Toben noch zuzunehmen schien: es mußte ein wilder Kampf zwischen den Beherrschern der Wälder entbrannt sein, deren Wutgeheul die furchtsameren Tiere zu Schreckensrufen veranlaßte. So oft das dumpfe, grollende Gebrüll der größeren Raubtiere einigermaßen verstummte, gellte das Geschrei des Faultiers, des Bisamschweines, das Kreischen der Vögel und das schrille Gepfeif der flüchtenden Affen, das bisher im allgemeinen Lärm nicht zu unterscheiden gewesen war, durchdringend in die Ohren der betäubten Jünglinge.
»Ich will das Feuer heller anfachen!« rief Ulrich dem Bruder zu, als einmal ein kurzes Nachlassen des Lärms ihm gestattete, sich vernehmlich zu machen.
»Halt, halt!« rief Friedrich: er hatte in den Ästen eines Baumes über Ulrichs Hängematte eine dunkle Masse erblickt, die katzenartig vorwärts schlich und mit glühenden Augen hinunterspähte.
Sofort griff Friedrich zum Gewehr, das er vorsorglich so gelegt hatte, daß er es von der Hängematte aus ergreifen konnte. Schon sah er das Raubtier zum Sprunge auf Ulrich ansetzen, woraus ersichtlich war, daß die Matte keinen so zuverlässigen Schutz gegen derartige Angriffe bietet, wie die Eingeborenen versichern; da drückte Friedrich los. Mit dumpfem Brüllen stürzte das schwergetroffene Tier dicht an Ulrichs Matte vorbei zu Boden, überschlug sich, machte einen verzweifelten Satz und kollerte gerade in die Glut des Feuers. Gräßlich klang das Schmerzgeheul des gequälten Pumas, denn im Schein der Flammen erkannten unsere Freunde ein besonders großes Exemplar dieses mähnenlosen Löwen des tropischen Amerika, der auch Kuguar genannt wird. Mit einer krampfhaften Anstrengung wälzte sich der sterbende Löwe aus dem Bereich der Gluten, und nun sprang Ulrich zur Erde und warf dem sinkenden Feuer neue Nahrung zu, so daß es bald wieder hell aufflammte.
Ulrich streckte den Puma, der sich immer noch in Todeszuckungen wand, durch einen Schuß vollends nieder; dann machten sich die Knaben daran, die besten Stücke seines Fleisches herausschneiden, um einen saftigen Frühstücksbraten zu erhalten. Es ging zwar erst gegen zwei Uhr, aber an Schlaf war nicht mehr zu denken und, wie es gewöhnlich geht, wenn man sich mitten in der Nacht ermuntert, der Hunger begann sich bereits mächtig in ihnen zu regen.
»Hör einmal, Ulrich,« sagte Friedrich, während er den Braten über dem Feuer drehte, »ist es nicht ein erhabenes Gefühl, sich so als die einzigen menschlichen Wesen in einer endlosen Wildnis zu wissen? Sieh! So hell unser Feuer aufflackert, so leuchtet es doch kaum bis an die untersten Blätter des Laubdachs, und ebenso ringsum zeigt es in zweifelhaft wechselndem Licht einige mächtige Stämme, und dahinter und darüber ist alles in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Das ist wie ein gewaltiger Dom, dessen Ende weder in der Höhe noch in der Länge und Breite abzusehen ist, alles verdämmert im Unendlichen. Und da befinden wir uns mitten darinnen, als winzige Zwerglein. Wir kommen überhaupt nicht in Betracht im Vergleich zu diesen ungeheuren Maßstäben — und doch! getrost im Vertrauen auf den göttlichen Schutz und kühn im Bewußtsein unserer menschlichen Gaben können wir durch die Unendlichkeit hinschreiten und den Schrecken, die uns umgeben, Trotz bieten, als seien wir Herren und Könige dieser Wildnis.«
»Sehr schön gesagt!« erwiderte Ulrich, nicht ohne Anflug von Spott. »Mir aber wäre es lieber, die Einsamkeit wäre nicht so groß; nur noch ein paar Menschen um uns her, so wäre mir viel wohler! Furcht habe ich ja nicht gerade, aber es liegt doch etwas Grauenhaftes darin, sich in seiner Kleinheit und Schwäche so verlassen zu fühlen in einer solchen Wildnis, voller feindlicher Wesen, von denen ein einziges unser Leben auslöschen kann, wenn es ihm gelingt, uns unversehens zu überraschen!«
»Auf den Schutz der Hängematte und des Feuers dürfen wir freilich nach den letzten Erfahrungen nicht allzufest vertrauen,« entgegnete Friedrich, »um so mehr aber auf den göttlichen Schutz, der uns bisher schon so oft zuteil wurde.«
»Gewiß! Aber ich sage dir, ich sehne mich bereits nach Menschen, obgleich wir erst einen halben Tag allein wandern, es war doch etwas ganz anderes, als Manuel noch bei uns war; schon der Gedanke, daß so ein Mann, als Sohn des Landes, mit den Gefahren und den nötigen Vorsichtsmaßregeln vertrauter sei als wir, flößte ein gewisses beruhigendes Gefühl der Sicherheit ein.«
Die Brüder unterhielten sich ziemlich laut; denn wenn auch der Lärm im Walde sich merklich entfernte, so war er doch noch stark genug, um ein Erheben der Stimmen notwendig zu machen.
Friedrich meinte: »Ich glaube, wir gewöhnen uns bald an die Einsamkeit; käme es aber bloß auf den Wunsch an, so würde ich mir gewiß auch menschliche Reisegesellschaft wünschen.«
»Na! Da könnte ja vielleicht Rat werden,« rief eine Stimme aus nächster Nähe.
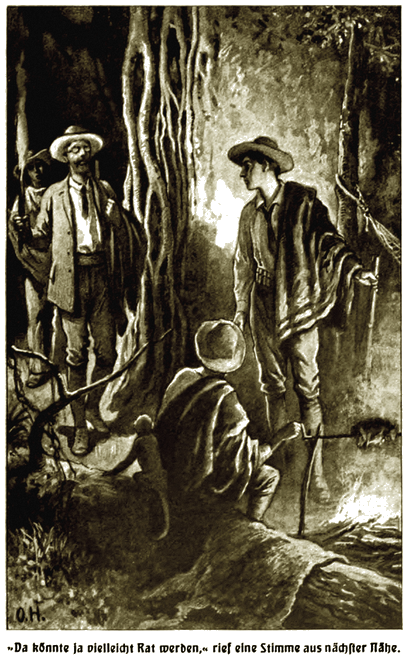
Aufs höchste erstaunt, fast erschrocken sahen sich unsere Freunde um.
Ein schlanker Mann mit braunem Vollbart, eine Brille auf der Nase, trat herzu. Er hielt eine Fackel in der Hand und war von einem Indianer gefolgt, der ebenfalls eine Fackel trug.
»Mein Name ist Schulze,« sagte der Ankömmling, als die Jünglinge ihn immer noch verblüfft anstarrten. »Jawohl, Schulze aus Berlin. — Na! Von Berlin werden Sie doch schon gehört haben? Berlin an der Spree, gar nicht weit von Potsdam. Ich bin nämlich ein wenig naturforschen gegangen; aber es ist wirklich kolossal, was es hier alles gibt in der Natur: es ist nicht damit fertig zu werden; es ist klüger, man fängt erst gar nicht damit an und erforscht nur, was es hier nicht gibt, und das ist auch der eigentliche Zweck meiner Reise. — Aber ich schwatze und weiß noch gar nicht, mit wem ich die Ehre habe!«
»Ulrich Friedung — und hier mein Bruder Friedrich.«
»Hübsch! Ulrich und Friedrich Friedung, na ja! Ganz in der Ordnung, wenn Sie sich mir im Tiergarten oder Unter den Linden, meinetwegen bei Dressel oder in einer Abendgesellschaft so vorstellten! Aber wieso im Urwald am Orinoko? Bei Gott, wenn ich nicht die uns Berlinern angeborene Redegabe hätte, ich wäre einfach sprachlos. Und ich versichere Sie, ich bin es! Ich meine, Sie sollten in Prima oder Sekunda stecken, aber nicht im Urwald. Wenn ich das in Berlin wiedererzähle, etwa so: Treffe ich da eines Nachts, mitten im Urwald am Orinoko, zwei deutsche Jünglinge mutterseelenallein, die sich gemütlich in der Muttersprache unterhalten ... Ne! da würden meine Zuhörer sagen: Paßt mal auf, Schulze fängt an zu flunkern, und mit den wissenschaftlichen Ergebnissen seiner Reise ist ihm dann auch nicht zu trauen; er ist gewiß nicht weiter gekommen als bis in den Spreewald und hat sich da ausgesonnen, was er uns über seine Reise in die Tropen aufbinden will.«
So neugierig der Naturforscher Schulze auch war, ihm stieg in diesem Augenblick ein Bratenduft in die Nase, der ihn eine Antwort nicht abwarten ließ.
»Oho!« rief er aus. »Da gibt's Rostbraten oder ähnliches. Hören Sie mal, meine jungen Freunde, da lassen Sie mich mithalten, nicht? Ich schwöre Ihnen, alle Leckerbissen, die ich mit mir führe, stehen Ihnen dafür zur Verfügung. Braten habe ich nämlich schon seit sechs Wochen nicht mehr gekostet. Sie sehen wohl, ich trage eine Flinte, bin aber elend kurzsichtig, und obgleich ich letzthin ein riesiges Krokodil auf drei Schritt Entfernung mitten in seinen ungeheuren Rachen getroffen habe, gelang es mir doch sonst noch nie, ein Stück Wild zur Strecke zu bringen. Und die zwei Indianer, die ich mit mir führe, oder die mich führen, wie man sagen will, sind leider zivilisiert und stammen aus Bolivar. Von der Jagd haben sie keine viel größere Ahnung als meine Wenigkeit. Aber was ist das wohl für Braten?«
Friedrich wies auf den in der Nähe liegenden Kuguar, und Schulze wich erschrocken einen Schritt zurück: »Was seh ich! Felis concolor! Alle Achtung, den haben Sie erlegt? Oder wohl zufällig verendet gefunden?«
»Nein, nein! Friedrich hat ihm eine Kugel zwischen die Rippen gejagt, als er mich in meiner Hängematte überfallen wollte.«
»In der Hängematte? Ich danke! Die Indianer versichern, in der Hängematte sei man sicher vor solchen Überfällen, und überdies hieß es, der Puma sei feige und falle keinen Menschen an.«
»Keine Regel ohne Ausnahme, wie Sie sehen, Herr Schulze.«
»Ist mir höchst unangenehm! Ich wünsche nämlich nicht, ein Märtyrer der Wissenschaft zu werden, so berühmt mich das machen würde. Na! und bisher verließ ich mich auf die Schwindelaussagen der Indianer. Jetzt aber werde ich nicht mehr ruhig schlafen können. Ist ja schauerlich, dieser sogenannte Urwald! War doch ein Höllengelärm, den die Fauna vorhin zu nachtschlafender Zeit verführte. Ich sage Ihnen, wenn so etwas in Berlin vorgekommen wäre, alle Beteiligten säßen bereits hinter Schloß und Riegel; denn Nachtruhestörung, das gibt's nicht! Dazu haben wir unsere Polizei. Aber hier in diesem Urwald ist mir noch kein Schutzmann begegnet: einfach scheußliche Zustände, was? Na! und wie wir dem Schauerkonzert lauschen und unser Feuer höher schrauben, hör' ich einen Schuß fallen, ganz in der Nähe. Freunde, sag' ich zu den Indianern, euer Vater — sie nennen mich nämlich ›Vater der vier Augen‹ wegen meiner Brillengläser —, euer Vater hat die Stimme einer Büchse vernommen. Ich liebe es nämlich, mit diesen Kindern der Wildnis in ihrer bilderreichen Sprache zu verkehren. ›Deine Söhne vernahmen sie auch!‹ erwiderten die Roten. Hierauf begab ich mich in Begleitung von Unkas hierher. Er nennt sich zwar Luciano, aber ich bitte Sie! das ist doch kein Indianername! Ich habe ihn also Unkas getauft, und er hört bereits darauf; ebenso nenne ich den andern, der sich den prosaischen Namen Celestino beilegt, Matatoa: das klingt viel echter. Übrigens können Sie sich meine Verblüffung und Freude denken, wie ich da mitten in der Einöde zwei junge Herren erblicke, die sich in deutscher Sprache unterhalten!«
»Wir sind wahrhaftig nicht weniger freudig überrascht worden durch Ihre Erscheinung, Herr Professor,« nahm Friedrich das Wort.
»Professor? Na! nennen Sie mich immerhin Professor, ich gedenke es bald zu werden, und hierzulande legt man sich gern des Respektes halber einen schönen Titel bei. — Aber wohin geht denn die Reise, meine jungen Herren?«
»Das sollen Sie gleich hören; aber jetzt bitte ich zu Tische, der Braten ist fertig!« mahnte Friedrich.
Schulze beauftragte »Unkas«, den andern Indianer mit den Lasttieren und seinem Gepäck herbeizuholen, während Friedrich noch zwei saftige Fleischstücke vom erlegten Wilde herunterschnitt und sie übers Feuer setzte, damit auch die Indianer den Braten zu kosten bekämen.
Diese erschienen bald, denn Schutzes Lagerplatz lag nur wenige hundert Schritt entfernt, und wenn das Gebüsch nicht so dicht gewesen wäre, hätte von jedem der Lager aus der Feuerschein des Nachbarlagers bemerkt werden müssen.
Unkas und Matatoa drehten mit Vergnügen ihre Bratenstücke über dem Feuer, während die drei Deutschen sich ihr köstliches Frühstück munden ließen, zu dem Schulze das Kassavebrot, und, zur Feier des festlichen Ereignisses, wie er sagte, eine Flasche Wein spendete.
Da sowohl Celestino wie Luciano stolz waren auf die wohlklingenden Namen, die Schulze ihnen beigelegt hatte, und sich selber nicht anders mehr nannten, so werden auch wir sie künftig nur Matatoa und Unkas heißen.
SOBALD der Morgen dämmerte, wurde die Weiterreise angetreten. Als Schulze erfahren hatte, daß seine jungen Landsleute den gleichen Weg hatten wie er, war er außer sich vor Freude. »Jetzt will ich wieder ruhig in meinem Hängenetz schlafen,« meinte er, »wenn ich zwei so tüchtige Jäger bei mir habe; überhaupt wird es der Wissenschaft zugute kommen, wenn Sie mir hier und da ein interessantes Tier schießen, damit ich es genau untersuchen kann.«
Die beiden Brüder waren auch äußerst erfreut, so angenehme Reisebegleitung gefunden zu haben, und das Gefühl größerer Sicherheit erlaubte gewiß auch ein rascheres Vorwärtskommen.
Das Landschaftsbild, das sich den Augen der Reisenden am Ufer des Stromes bot, war ein entzückendes. Der Orinoko war hier so breit, daß man die seltsam geformten Berge von Encaramada wie über einen See hinüber frei vor sich liegen sah; aber die ausgedehnten freien Sandflächen, die noch Humboldt an beiden Uferseiten beobachtete, waren verschwunden: der Wald hatte auch von ihnen inzwischen Besitz ergriffen.
Merkwürdig erschien der Tepupano de los Tamanacos, der Berg, an den sich die Mission von Encaramada lehnt; auf seinem Gipfel stehen drei gewaltige Granitzylinder, von denen der eine fast fünfundzwanzig Meter hoch senkrecht emporragt, während die anderen sich gegen ihn neigen; sie machen den Eindruck eines Kolossaldenkmals, von Giganten errichtet.
Rasch näherte sich die kleine Karawane diesem Wahrzeichen von Encaramada. Herr Schulze erzählte unterdessen, was er überhaupt in den entlegenen Gegenden wollte, die er aufzusuchen beabsichtigte. »Es tauchen nämlich immer wieder Gerüchte auf von einem ganz fabelhaften Tier, das in Columbia hausen soll. Es soll eine Art Flußpferd oder Reptil sein von der Größe eines Walfisches. Dasselbe sei der Schrecken nicht bloß der Indianer, sondern auch der ganzen Tierwelt des Landes, und was das unglaublichste ist, es besitze die Fähigkeit, sich kilometerweit unter der Erde fortzuwühlen, so daß es dem ahnungslosen Wanderer plötzlich vor der Nase auftauchen könne, buchstäblich der Erde entstiegen. Ein Europäer will nun die frisch abgeworfene Haut eines solchen Ungetüms in einer Höhle aufgefunden haben und sandte Proben davon in die Heimat. Na! merkwürdig genug war der Fund, aber mit dem Fabeltier ist es natürlich nichts, das gehört in das Gebiet der Sagen, wie die Drachen, der Vogel Roch und der Phönix. Nun gibt es aber immer noch phantastische Köpfe in der Gelehrtenwelt, die freilich der Wissenschaft wenig Ehre machen, denn sie sind stets geneigt, all den Mumpitz zu glauben, der ihnen vorgeschwatzt wird. Und nun vollends, wenn er aus so einem Lande kommt, wo noch fast alles unerforscht ist!
»Überhaupt eine merkwürdige Tatsache das! In Nordamerika sind die wilden, grausamen Indianerstämme nahezu ausgerottet, alles ist dorthin ausgewandert, es beginnt schon lange an Land zu mangeln, und an Stelle des endlosen Urwalds sind Städte und Staaten mit Eisenbahnen und Telegraphen entstanden, und hierher, wo das Land umsonst zu haben wäre und ein viel reicheres Land, als es je in Nordamerika gab, hierher, wo sich im Handumdrehen Reichtümer gewinnen ließen, und wo die Indianer harmlos und ungefährlich sind, — ja hierher kommt niemand! Der Urwald ist noch so unerforscht wie zur Zeit der Entdeckung Amerikas; die Indianer sind noch so frei wie damals, weder im Äußeren noch in ihren Sitten verändert. Alles wird erforscht, den Nord- und Südpol will man mit aller Gewalt entdecken trotz der schauerlichen Kälte und Öde, die im ewigen Eise herrschen; nach Tibet und ins Innerste von Afrika dringt man unter tausend Lebensgefahren, — aber Südamerika ist vergessen: es ist, als ob die tollen Goldfahrten mit ihren Enttäuschungen Europa so entmutigt hätten, daß alles geographische und sonstige wissenschaftliche Interesse für diese überaus merkwürdigen Wildnisse ein für allemal erloschen sei.
»Darum glaubt man eben jeden Schwindel, der von hier ausgeht, und nun bin ich aufgebrochen, um einmal in unerforschte Gebiete zu dringen, namentlich aber um nachzuweisen, daß von dem Dasein jenes Fabeltieres keine Rede sein kann.«
Unter diesen Erörterungen von seiten des zweifelsüchtigen Naturforschers waren sie in Encaramada angelangt, wo eine langgestreckte Insel den Strom in zwei Arme teilt. Seit die Republik in Venezuela eingeführt wurde, sind die Missionen größtenteils aufgehoben worden, die meisten sind verlassen, und kaum noch Ruinen bezeichnen ihre ehemalige Stätte. Die Indianer, die in den Missionen als bekehrte Christen lebten, sind wieder in ihre Wälder zurückgekehrt, und die beginnende Kultur ging rasch wieder verloren. Von zwölf blühenden Missionen, die Humboldt an den Ufern des Orinoko besuchte, sind überhaupt nur noch fünf als Ortschaften vorhanden, und auch da ist die einstige Blüte nicht mehr zu schauen: die zerfallenden Kirchen sind das Wahrzeichen der freien Republik, die keinen Sinn hat für das christliche Kulturwerk unter den Eingeborenen.
Auch San Luis del Encaramada machte den Eindruck einer gefallenen Größe, und unsere Freunde hätten sich nicht weiter hier aufgehalten; allein, da es Samstag war und Ulrich und Friedrich grundsätzlich den Sonntag als Ruhetag feierten, worein sich Schulze gerne fand, beschlossen sie, ihr zweimaliges Nachtlager an diesem Orte aufzuschlagen und zunächst einen Ausflug in die benachbarte Savanne zu unternehmen, wohin sie ein einheimischer Indianer als Führer begleitete.
Es war trotz all der unerschöpflichen Reize, die die großartigen Landschaftsbilder des Urwalds bieten, eine wahre Erquickung für die Wanderer, auch einmal wieder freies, unbewaldetes Land zu sehen.
Mitten auf der weiten Grasfläche erhob sich ein hoher Felsen, zu dem der Führer die Reisenden geleitete. »Dies ist der Tepumereme,« sagte er, indem er an der ungeheuren, schroff abfallenden Wand emporwies.
Es war ein erhabener Anblick, wenn man von unten an der Fläche emporsah, die bei ihrer gewaltigen Ausdehnung den Eindruck der Glätte einer Schiefertafel machte und oben im Blau des Himmels zu verschwinden schien.
»Was ist denn das?!« rief Friedrich aus. »Da oben ist ja alles voller Bilder: Tiere und Menschen, Pflanzen und Gestirne sind dort kunstvoll in den Stein gemeißelt.«
»Wahrhaftig,« sagte Schulze verwundert. »Das ist ja die reine Unmöglichkeit: ohne ein Luftschiff konnte da kein menschliches Wesen hingelangen. Heda! Herr Indianer, wie hat man denn dieses Wunder fertig gebracht?«
Der Führer lächelte. »O Sennor, die Sache ist einfacher, als sie aussieht; zur Zeit des großen Wassers sind unsere Väter im Kanu so hoch oben gefahren, und damals wurden die Bilder in den Felsen gemalt, heute freilich wäre dies unmöglich.«
»Köstlich! Das habt ihr wohl von euren früheren Missionaren, die euch die Geschichte von der Sintflut erzählten?«
Der Indianer schüttelte den Kopf und erwiderte ernst: »Sennor, lange ehe der Fuß eines Weißen die Savannen des Orinoko betreten hat, haben unsere Väter erzählt von dem großen Wasser, das vor Zeiten die Erde überflutete. Es stieg zuletzt so hoch, daß es die Gipfel der Berge bedeckte und alle Menschen und Tiere ertranken. Nur der Tamanaku am Ufer des Asiveru ragte noch über die Wasser empor, und dorthin flüchteten sich ein Mann und ein Weib, die der große Geist bestimmt hatte, die Erde wieder zu bevölkern. Die Früchte der Mauritiapalme, die sie über ihre Köpfe wegwarfen, verwandelten sich nach dem Willen des Weltenherrn in lebende Wesen, und so belebte sich wieder die Erde, nachdem sich die Flut verlaufen hatte.«
»Es ist merkwürdig,« meinte Ulrich, »daß die Kunde jener großen Weltkatastrophe über die ganze Erde verbreitet ist, keine geschichtliche Tatsache ist je so allgemein verbürgt gewesen.«
»Na, junger Freund! ist eben ein uraltes Ammenmärchen. He, großer Häuptling von Encaramada, dein Bruder hat scharfe Augen und sieht ins Vergangene wie in die Gegenwart; aber da sieht er keine Möglichkeit, daß die Wasser jemals die Zinnen der Berge bedeckt haben könnten.«
»Mein weißer Sohn ist weise,« sagte der alte Indianer etwas spöttisch. »Er hat vier Augen, zwei für die Vergangenheit, zwei für die Zukunft. Wenn er aber auch die Dinge der Gegenwart so scharf beobachten kann wie die fernen und verborgenen Dinge, so wird er noch oft solche Bilder an hohen, unersteiglichen Felsen entdecken; dann möge seine Weisheit ihm kundtun, wie diese Bilder entstanden sind, wenn er von der großen Flut nichts wissen mag, von der unsere Väter erzählen.«
Schulze zermarterte sich vergeblich den Kopf, wie er dem Indianer eine wissenschaftlichere Erklärung geben solle, aber er fand keine. »Großer Häuptling,« sagte er etwas kleinlaut, »diese Bilder sind das Geheimnis des Felsens; solche Rätsel löst der vernünftige Mensch nicht stante pede; aber die Zeit wird nicht ferne sein, wo auch die Geheimnisse dieser Riesenmauern vom untrüglichen Lichte unserer alles ergründenden Wissenschaft durchleuchtet sein werden. Zu eurer Sage jedoch wird sie sich nie bekehren, die ist ihr nicht wissenschaftlich genug.«
Der »große Häuptling« verstand nicht viel von dieser Rede, so viel aber dachte er bei sich, daß mancher mit vier Augen nicht so viel sehe wie ein anderer mit zwei.
Friedrich dachte etwas Ähnliches: er verglich im stillen die Wissenschaft mit einer scharfen Brille, die den blöden Augen aushelfen soll, während nun aber mancher meint, mit Hilfe seiner Brille sehe er hundertmal schärfer als irgend ein brillenloser Mensch, sieht in Wahrheit ein von Natur geschärftes Auge gar manches viel deutlicher, als das beste Augenglas es erkennen läßt.
Als sie den Urwald wieder betraten, dunkelte es bereits, und nun ward ihnen ein Schauspiel, wie sie es in dem Maße noch nie gesehen hatten: zahllose Glühwürmer und riesige Leuchtkäfer flogen in Scharen umher. Tausende von Lampyriden ließen ihr weißgelbes Licht blitzen; wie Irrlichter schaukelten die großen Käfer vom Geschlecht des Photinus zwischen den Stämmen hin und her, und Raketen gleich schnellten die strahlenden Elateriden bis in die Urwaldwipfel empor, so rasch, daß ihr Doppellicht einem orangeroten Streifen glich. Es war, als sei der Sternenhimmel zur Zeit der größten Sternschnuppenfälle in den Urwald herabgekommen. Diese schwirrenden und schwebenden, aufblitzenden und wieder verschwindenden, zitternden und zuckenden Goldflammen, die da und dort den Boden, das Gebüsch, die Baumstämme und die Wipfel zeitweise hell erleuchteten, verwandelten den Walddom in ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht.
AM Sonntagnachmittag begaben sich die drei Deutschen an das Ufer des Stromes, um ein Bad zu nehmen, was, wie man sie versichert hatte, an einer bestimmten Stelle ganz gefahrlos geschehen könne.
Dumpfe Schwüle brütete über dem Urwald. Schwermütig klang das Zirpen Tausender von Zikaden vom Flußufer herüber, sonst war es beinahe still; selten nur ließ sich ein Papagei vernehmen und in der Ferne ein Trupp Affen: es war, als ob auch die Natur durch besonders feierliche Ruhe ihren Sabbat feiern wollte.
Prächtige Schmetterlinge von leuchtenden bunten Farben und merkwürdigen Zeichnungen, oft mit wunderlich geformten Flügeln, entzückten das Auge. Von dem Glanz und der Glut dieser flatternden Blüten hätten sich unsere Freunde keine Vorstellung machen können, ehe sie in den Llanos und namentlich im Urwald ihre ganze Herrlichkeit zu sehen bekamen.
Einzelne Arten waren ziemlich einfarbig, andere wiesen die buntesten Farbenzusammenstellungen auf; aber jeder dieser zum Teil ganz riesenhaften Falter hatte seine eigenartige überraschende Schönheit. Ganz besonders merkwürdig erschienen die grünen und goldenen Farbflecke auf den Flügeln einzelner Schmetterlinge, Farben, die kein europäischer Schmetterling aufweist.
Auf dem Boden und an den Baumstämmen krabbelten die verschiedenartigsten Käfer umher, namentlich der große braune Bockkäfer und der gehörnte Herkules, der eine Länge von fünfzehn Zentimetern erreicht und olivenfarbige Flügeldecken trägt. Auch viele andere seltsam geformte und mit bunten Arabesken sonderbar gezierte Käfer erregten Schulzes größte Aufmerksamkeit und die freudige Bewunderung seiner jungen Begleiter. Namentlich staunten sie über die Farbenpracht und den leuchtenden Metallglanz vieler Wanzenarten, deren größte, die Edessa, sich in fünf Zentimeter langen Exemplaren vorfand.
Als die Reisenden ans Ufer gelangten, trat eine Schar Wasserhühner aus dem Gebüsch; kaum hatte diese sich entfernt, so machte ein Geräusch in den Zweigen eines überhängenden Baumes unsere Freunde aufmerksam. Emporblickend sahen sie einen Wickelbären, ein etwa einen halben Meter langes Tier mit glänzend hellbraunem Pelz und kurzem, dickem Kopf. An seinem langen Ringelschwanz ließ er sich von einem Ast herab und erfaßte, sich fallen lassend, den nächsten mit den scharfen, eingebogenen Krallen. Auf diese Weise erreichte er behende den Boden, griff ins Gebüsch hinein und holte ein Ei heraus; dann setzte er sich auf die Hinterbeine und schliff mit den scharfen Zähnen eine Öffnung in die Schale, dabei hielt er das Ei so vorsichtig zwischen den Vorderpfoten, daß es nicht zerdrückt wurde. Als es geöffnet war, legte er den Kopf zurück und schlürfte das Ei aus, genau wie ein durstiger Zecher seinen Humpen leert. Dieser Anblick war so reizend, daß sowohl Schulze wie die Jünglinge stehen blieben, bis der Wickelbär sämtliche Eier verzehrt hatte, die er im Gebüsch vorfand, wobei ihn die Anwesenheit der ihn beobachtenden Menschen in keiner Weise störte.
Da der Wickelbär am oberen Orinoko eine Seltenheit ist und für gewöhnlich erst nachts auf Beute geht, war das beschriebene Schauspiel ein wirkliches Ereignis.
Dann aber ging's ins Wasser. Das Bad war erfrischend trotz der ziemlich hohen Wärme des Flusses, doch sollte es nur zu bald durch einen schrecklichen Vorfall gestört werden. Sei es, daß die Gefahrlosigkeit nicht so groß war, wie man die Badelustigen versichert hatte, sei es, daß sie die richtige Stelle verfehlt hatten — kurz, ein ungeheures Krokodil tauchte plötzlich auf und faßte mit weit aufgesperrtem Rachen Friedrich, der arglos im Wasser umherschwamm, mitten um den Leib.
Ulrich und Schulze stießen entsetzte Schreie aus; letzterer gewann rasch das Ufer, um nach seinem Gewehr zu springen. Allein abgesehen davon, daß er ein schlechter Schütze war, wäre seine Hilfe viel zu spät gekommen. Ulrich dagegen stürzte sich sofort auf das Ungetüm zu, obgleich es Wahnsinn schien, an eine Rettung des Bruders zu denken. Er hatte von Manuel gehört, daß man ein Krokodil nur zu streicheln und zu kratzen brauche, so lasse es alles mit sich anfangen. Zwar hatte er diese ganz richtige Bemerkung für eine Fabel gehalten, jetzt aber in der Todesangst um den Bruder wollte er doch einen Versuch damit wagen.
Obgleich nun Ulrich, ohne sich mit längeren Überlegungen aufzuhalten, das Krokodil kühn anfaßte, sobald er sich vom ersten lähmenden Entsetzen erholt hatte, wäre Friedrich doch kaum gerettet worden, wenn er nicht selber sich auch eines Mittels erinnert hätte, das Manuel ihnen seinerzeit angab. Kaum fühlte er sich von den scharfen Zähnen erfaßt, so griff er auch mit bewundernswerter Geistesgegenwart der Riesenechse in beide Augen, was den augenblicklichen Erfolg hatte, daß das Krokodil ihn laut aufbrüllend ins Wasser fallen ließ.
Das fürchterliche Gebiß des Tieres hatte Friedrichs Körper glücklicherweise nur ganz leicht gepackt; so trug er die zwar blutenden, aber nicht tiefgehenden Spuren der scharfen Zähne, hatte jedoch noch so viel Kraft, dem Ufer zustreben zu können.
Inzwischen war ein zweites Krokodil angekommen, das schon nach Ulrich schnappte, der hinter dem Bruder hereilte. Schulze stand nun zwar mit angelegtem Gewehr am Ufer, wagte aber keinen Schuß, aus Furcht, einen der beiden Knaben zu treffen. Da stellte sich ein unerwarteter Lebensretter in Gestalt eines Schwertfisches ein.
Dieser gewaltige, im Orinoko häufig vorkommende Fisch stieß seine scharfe Waffe, mit der er hier und da ein Boot durchbohrt, dem Krokodil in den Hals, als es im Begriff war, Ulrich zu erfassen. Das verwundete Tier krümmte sich mit dumpfem Gebrüll und wandte sich seinem Angreifer zu. Dieser aber entschlüpfte dem tödlichen Biß mit großer Gewandtheit und brachte dem blutenden Feinde noch mehrere Wunden bei, die bald dessen Tod zur Folge hatten.
Unsere Freunde sahen dem merkwürdigen und grausigen Kampfe wie gebannt zu; erst als er zu Ende war, dachte Friedrich daran, seine Wunden zu pflegen. Schulze führte stets Pflaster und Verbandzeug bei sich und nahm den Verwundeten in Behandlung. Er staunte, zwar zahlreiche, aber nur oberflächliche Wunden vorzufinden, die leichten Eindrücke der scharfen Zähne des Krokodils. »Na!« sagte er, »Sie sehen aus, als hätten Sie sich in einem Dornbusch gewälzt! Aber Sie dürfen froh sein, so glimpflich davongekommen zu sein, sah es doch aus, als wollte das Untier Sie mitten entzwei beißen, und nun haben Sie nichts als eine Sammlung von Nadelstichen im Leib. Geistesgegenwart haben Sie bewiesen, das muß ich sagen!«
»Ich weiß selber nicht, wie es kam,« meinte Friedrich. »In solch kitzlicher Lage denkt man nicht mehr nach, man handelt mehr unbewußt; es ging ja alles wie der Blitz. Gefühlt habe ich nicht viel: es war mir, als habe mich das Tier so gelinde gefaßt wie etwa ein Hund, der im Spiel die Hand seines Herrn packt. Freilich waren die Zähne so scharf, daß sie dennoch blutige Spuren zurückließen.«
»Stimmt, stimmt!« bestätigte Schulze. »Es paßt ganz zu den Berichten der Reisenden, namentlich auch Humboldts. Im Schwimmen schließt das Krokodil die Kinnladen nicht fest, und wenn es einen Menschen um den Leib faßt, so ist dieser erste Biß meist ungefährlich. Es gibt viele Beispiele von Rettungen aus dem Rachen eines Alligators, die ebenso glücklich verliefen. Es kommt freilich auch vor, daß so ein Tier mit einem Schnapper einen Arm oder ein Bein abbeißt wie ein Haifisch. Das ist aber so wenig die Regel, daß Doktor Junker zum Beispiel gar nicht daran glauben wollte, bis ihm einmal ein Negerjunge vorgeführt wurde, dem ein Krokodil den Unterarm glatt abgebissen hatte.«
»Ein Glück, daß der Räuber nicht mit dir unter Wasser tauchte,« schaltete Ulrich ein.
»Ja, da hätte er Sie wohl ersäuft!« nahm Schulze wieder das Wort. »Aber gewöhnlich schleppt das Krokodil sein Opfer eine Zeitlang über Wasser fort, ehe es untertaucht. Auch dies bestätigen mehrere Berichte, nach denen viele Augenzeugen den Kampf von Menschen mit den widerlichen Schuppentieren bis zu Ende mitansehen konnten.«
Ulrich wandte sich nun an Schulze mit der Frage: »Glauben Sie, daß solch ein Ungeheuer sich wirklich durch Kitzeln von seiner Mordlust abbringen läßt? Ich habe von diesem Mittel gehört und wollte es, so unglaublich es mir schien, versuchen.«
»Die Tatsache kann allerdings nicht geleugnet werden,« erwiderte Schulze. »Paez und Emerson Tennent wissen von solchen Vorkommnissen zu berichten, und Sachs hat den gleichen Fall erlebt: ein Krokodil hatte sich in dem Netze verfangen, mit dem er Gymnoten fischen wollte. Ein Eingeborener tauchte unbedenklich unter Wasser und löste das Tier aus den Maschen, indem er es durch Kitzeln an den Weichteilen besänftigte. Das beweist zugleich, daß selbst unter Wasser der Kampf mit dem Kaiman aufgenommen werden kann. Das Mittel jedoch, das Friedrich anwendete, dem Ungeheuer in die Augen zu greifen, scheint das sicherste zu sein. Es ist in Südamerika allgemein bekannt, und auch die Neger Afrikas wenden es an. Der Diener Mungo Parks rettete sich zweimal auf diese Weise. Humboldt erzählt ferner von einem Mädchen aus Uritucu, das sich dadurch half. Auch Sachs bezeugt es: solchen gewichtigen Zeugnissen gegenüber kann der eingefleischteste Zweifler nicht mehr die Tatsache leugnen. Freilich hilft das Mittel nicht jedesmal. So erzählt Humboldt von einem Guayqueriindianer, der, von einem Krokodil am Beine gepackt, zunächst vergeblich nach einem Messer in seiner Tasche suchte, dann den Kopf des Tieres packte und ihm die Finger in beide Augen stieß. Statt aber, wie es sonst geschah, mit Gebrüll seine Beute fahren zu lassen, tauchte in diesem Fall das Krokodil unter und ertränkte den Unseligen. Jedenfalls soll uns das heutige Abenteuer zur Warnung dienen: fortan wird nur noch in solchen Gewässern gebadet, die durchaus frei von derartigen Gefahren sind!«
Beizeiten wurde am Montag aufgebrochen; die Reise ging stets am Ufer des Orinoko hin. Mitten im Strome erschienen von Zeit zu Zeit ausgedehnte Inseln. »Das sind die berühmten Playa,« sagte Schulze, »das heißt seichte Stellen, die bei niedrigem Wasserstande als Inseln im Flusse auftauchen. Die Playa, die Sie hier sehen, sind durch die Schildkröten berühmt geworden. Wahrhaftig! da krabbelt ja schon so ein Tier!«
Es war eine riesige Schildkröte, deren Rückenschild wohl dreiviertel Meter lang war. Sie bewegte sich schwerfällig am Ufer hin, verschwand aber bald darauf im Wasser.
»Ihre Zeit ist noch nicht gekommen,« lachte Schulze. »Wenn wir aber so etwa zwei Monate später vorbeikämen, würden wir unser Wunder erleben: das muß wirklich jeder Vorstellung spotten! Denken Sie sich ein paar Hunderttausend solcher Arahuschildkröten, die in langen Prozessionen von allen Seiten her diese Sandinseln aufsuchen! Alle Schildkröten des Orinokogebietes versammeln sich alljährlich nach Neujahr an dieser Stelle.«
»Ja wozu denn?« fragte Ulrich verwundert.
»Wozu? Das ist ja eben das Tolle: um ihre Eier hier abzulegen! Man sollte wirklich meinen, diese Tiere stehen unter dem Einfluß eines altüberlieferten Aberglaubens, nach dem sie zu diesem Geschäft aber auch kein anderes Plätzchen aussuchen dürfen als eben die paar Orinokoinseln zwischen dem Rio Meta und dem Apure. Warum sie so hartnäckig hieran festhalten und die weitesten Reisen zu diesem Zweck unternehmen, ist und bleibt ein Rätsel. Dann graben sie tiefe Löcher in den Sand, die reinsten Bergwerkstollen, und dort unten legen sie Ei an Ei: keine ist zufrieden, ehe sie's nicht auf zweihundert Stück gebracht hat. Die Eier sind kleiner als unsere Hühnereier, aber so hartschalig, daß die Indianerkinder sich belustigen, damit Ball zu spielen.«
»Da müssen ja die Schildkröten riesig überhandnehmen,« bemerkte Friedrich.
»Tun sie auch! Das heißt, sie nehmen wenigstens nicht merklich ab. Freilich, die Menschen werden in ihrer tollen Habgier es dennoch fertig bringen, auch diese nützlichen Tiere auszurotten; denn abgesehen davon, daß die Schildkröten zu Tausenden ihren Feinden aus der Tierwelt zum Opfer fallen, werden Millionen ihrer Eier alljährlich ausgegraben. In der Zeit der Eierernte gleicht dann diese öde Gegend einem Jahrmarkt zu Groß-Nowgorod: ganze Indianerstämme schlagen ihre Zeltlager hier auf, und die Händler strömen von ferne herbei.«
»Sind denn die Eier solch außerordentliche Leckerbissen?« fragte Ulrich.
»Das nun gerade nicht; aber sie bestehen zu zwei Dritteilen ihres ganzen Inhaltes aus einem vorzüglichen Speiseöl, das man mit Vorliebe auch zum Backen benutzt. Mit Stöcken stupsen die Indianer in den Sand, um zu untersuchen, an welchen Stellen Eier zu finden sind. Die erbeuteten Eiermassen werden in Holztrögen zerstampft, das Öl oben abgeschöpft und der Haltbarkeit wegen gekocht, und damit ist es fertig. Man kann sich keinen leichteren Verdienst denken.«
»Man sollte aber doch glauben, daß die Tiere bald solche Plätze mieden, wo ihre Brut in solcher Menge geraubt und vernichtet wird,« wandte Friedrich ein.
»Tun sie eben nicht! Instinkt, alles Instinkt! Geradezu lächerlich! Die Schildkröte kommt und legt ihre Eier, und damit basta! Da mag der gefräßige Jaguar hereinbrechen, da mögen die Krokodile nach ihr schnappen — nichts bringt sie draus. Und wenn sich eine verspätet hat, wird sie geradezu närrisch: die Kameraden, die ihre Pflicht erledigt haben, machen sich aus dem Staube; die wenigen aber, die zurückbleiben, legen krampfhaft weiter, wenn auch schon die Indianer zur Eierernte kommen. Man kann diese ›närrischen Schildkröten‹ dann mit den Händen fangen.«
»Haben Sie denn das alles schon einmal mitangesehen, daß Sie so genau darüber unterrichtet sind?«
»Nee! Aber das erzählt Ihnen jeder Indianer und jeder Orinokoreisende. Eine besondere Merkwürdigkeit ist noch, daß sich die ausgeschlüpften jungen Schildkröten — denn die Sonne brütet manches Ei aus, bevor der große Raub beginnt, und viele bleiben auch unentdeckt — in seichten Lachen aufhalten und sich erst, wenn sie größer sind, in den Fluß wagen.«
»Nun! daran sehe ich doch weiter nichts Merkwürdiges,« sagte Ulrich lachend.
»Na! glauben Sie, solche Lachen laufen im Taglohn umher? Sie wollen ausgesucht und gefunden werden, und da ist es wunderbar, wie die kleinen Tiere ohne irgendwelche Führung oft weite Strecken zurücklegen, bis sie an eine solche Pfütze gelangen, aber verfehlen tun sie diese nicht. Natürlich Instinkt, alles Instinkt! Die alten Schildkröten begnügen sich nämlich mit der Eierablage und erkennen keine weiteren Elternpflichten an; da zeigt sich das Krokodil viel gesitteter: es kehrt zur rechten Zeit an den Platz zurück, wo es seine Eier in die Erde legte; dann beginnt es zu brüllen, worauf die Jungen in den Eiern unter der Erde bedeutend piepen; hierauf gräbt die Mutter schleunigst die Eier aus dem Boden und nimmt sich auch späterhin ihres Nachwuchses ernstlich an.«
Unter solchen Gesprächen erreichten die Reiter Conception de Uruana, ebenfalls eine frühere Mission, woselbst sie Mittagsrast hielten.
Schulze hatte sich ins Gebüsch begeben, während die Vorbereitungen zum schlichten Mahle stattfanden; plötzlich aber kam er laut schreiend daher: »Ein Krokodil, ein junges Krokodil!« Gleichzeitig sah man ein schlankes, etwa anderthalb Meter langes Tier mit grünem, bläulich schimmerndem Rücken, das, den Rachen weit aufgesperrt, am Rande des Busches verharrte. Über den Rücken und Schwanz zog sich ein Kamm hin, der den Kundigen sofort erkennen ließ, daß es sich um kein Krokodil, sondern um eine Rieseneidechse, den Leguan oder die Iguana, handelte. Wäre Schulze nicht vom plötzlichen Schrecken verwirrt gewesen und überdies so kurzsichtig, so hätte er als Naturforscher dies zuallererst erkennen müssen; immerhin war seine Flucht wohl angebracht, denn das Tier ist bissig.
Matatoa hatte beim Anblick des Leguans sofort nach seinem Lasso gegriffen und mit einem geschickten Wurf die Schlinge um den Hals der Eidechse geworfen, denn mit dem Lasso wußte er besser umzugehen als mit dem Schießgewehr.
Beide Indianer jauchzten auf, als sie den Fang geglückt sahen; das sich heftig wehrende Tier wurde erschlagen und als besonderer Leckerbissen dem Speisezettel einverleibt.
»So laß ich mir's gefallen!« meinte Schulze schmunzelnd, als er das köstliche Fleisch verzehrte. »Sie werden sehen, meine jungen Herren, ich bilde mich im Urwald noch zum gewandten Jäger aus.« Er mußte eine starke Einbildungskraft besitzen, um seine Flucht vor der Eidechse als eine Jägertat anzusehen. Immerhin sollte sich bald zeigen, daß er sich wirklich Mühe gab, die Jagd zu üben.
Nach gehaltenem Mahle wurden einige Höhlen besucht, die sich in den Granitfelsen bei Uruana finden, und in denen hieroglyphenartige Bildwerke in die Wände gehauen sind, die späteren Forschern vielleicht Aufschlüsse über eine untergegangene Kultur geben mögen.
Nachdem der Rio Capanaparo überschritten war, erhob sich vor den Reisenden ein ansehnlicher Bergzug, der in der Sonnenhitze mühsam zu ersteigen war. Doch auch dieses Hindernis wurde überwunden, und herrlich war der Blick von der Höhe des Passes von Baraguan, wo die Felswände senkrecht in das eingeengte Bett des Orinoko abfallen. Mächtige Granitsäulen strebten wie Ruinen eines Riesentempels gen Himmel, und kaum eine Spur von Pflanzenwuchs war hier zu sehen. Dagegen zeigten sich zahlreiche Leguane, die mit weit aufgesperrtem Rachen bewegungslos die Karawane vorüberziehen sahen. Schulze, dem der Braten von Uruana in angenehmster Erinnerung war, gab einen Schuß auf eines der Tiere ab, fehlte jedoch, und die Indianer rieten, mit der Jagd noch zuzuwarten, da das Fleisch bei der herrschenden Hitze bis zum Abend schon verdorben sein könnte, wenn man jetzt ein erlegtes Tier mitnehmen wollte. Nachdem die Hügelkette überschritten war, gelangte man an die Ufer des Rio Suapure oder Sivapari, der dem Sinaruco gegenüber in den Orinoko mündet.
Schulze wußte aus seinen Büchern, daß die Wälder des Suapure durch ihren Honigreichtum berühmt sind, und tatsächlich fanden sich gewaltige Stöcke der Meliponen an den Baumästen hängend. Matatoa und Unkas verstanden es denn auch, einen reichen Vorrat Honig zu erbeuten, der in leere Konservenbüchsen gefüllt wurde und in der Folgezeit mit dem Kassavebrot, das die Indianer aus den reichlich vorhandenen Maniokwurzeln bereiteten, eine angenehme Abwechslung in den Speisezettel brachte.
Aber Schulze sollte heute abend noch besonderes Jagdglück haben. Als er, seiner Gewohnheit gemäß, noch etwas umherstreifte, während die Indianer das Nachtmahl bereiteten, sah er ein eigentümliches Tier aus dem Flusse auftauchen, das er vermöge seiner zoologischen Kenntnisse für einen Manati oder Lamantin hielt. Und er täuschte sich nicht: es war wirklich eine Seekuh, das grasfressende Wassersäugetier, das in diesen Gegenden vor Zeiten massenhaft auftrat, nun aber als ein leicht jagdbares Wild schon beinahe ausgerottet ist.
Schulze jagte dem Tier sofort eine Kugel durch den Kopf, und er hätte auf seinen Meisterschuß stolz sein dürfen, wenn er sich nicht wohl bewußt gewesen wäre, daß er es nur einem Zufall zu danken hatte, daß er bei seiner mangelhaften Schießkunst das Tier überhaupt getroffen hatte, und noch dazu gleich tödlich!
»Matatoa!« rief der Professor erfreut und doch wieder besorgt, da das Tier sofort untertauchte, das Wasser mit seinem Blute färbend.
Der Gerufene erschien. »Mein Bruder sieht, wie sich das Wasser mit dem Blute der Seekuh färbt, die meine nie fehlende Büchse erlegt hat; doch meine Seele fürchtet, das gute Nachtessen wird mir entrinnen.«
»Der Avia hat Lungen wie Blasebälge, doch sie nützen ihm nichts: er steigt in kurzen Zwischenräumen empor, neue Luft zu schöpfen. Matatoa wird ihn harpunieren.«
Mit diesen Worten eilte der Indianer zum Lagerplatz zurück und erschien gleich darauf wieder mit seinem Wurfspieß, an dessen Schaft er den Lasso befestigt hatte. Soeben tauchte die Seekuh auf, und alsbald bohrte sich auch der Speer in ihren Rücken, und sie wurde verendend ans Ufer gezogen.
Der Lamantin lieferte nicht bloß einen schmackhaften Braten zum Nachtessen, sondern auch Lederstricke von ausnehmender Zähigkeit, die Unkas und Matatoa aus seiner Haut schnitten.
HÄTTEN sich unsere Freunde nicht an die Stiche der Zancudo, der gefürchteten Schnaken der Tropen, gewöhnt, so hätten sie wohl wieder eine schlaflose Nacht zu verzeichnen gehabt; aber sie waren so nachdrücklich »geimpft«, daß sie der Stiche nicht mehr achteten. So konnten sie nach erquickendem Schlafe am 6. November in aller Frühe ihre Reise fortsetzen.
Es ging nun meist über niedere, dichtbewaldete Hügel hinweg und durch liebliche Täler hindurch. Hier und da zeigten sich Spuren verlassener Anpflanzungen, die aber so verwildert waren, daß sie sich kaum vom Urwald unterschieden. Nur die Nutzpflanzen, die an solchen Stellen in Menge beieinander standen, waren ein sicheres Zeichen, daß hier zur Zeit der Blüte der Missionen Gärten angelegt worden waren. Da war denn in erster Linie der Yukkastrauch oder Maniok. Bei jedem längeren Aufenthalt an solchen Stellen rösteten die Indianer einige Wurzeln dieses Strauches, wodurch diese ihre stark giftigen Säfte verloren. Sie lieferten das Mehl zu dem äußerst nahrhaften und wohlschmeckenden Kassavebrot. Da dieses Brot sich monatelang hält und von den Insekten, namentlich den Ameisen, merkwürdigerweise verschmäht wird, kann man sich kein vorteilhafteres Nahrungsmittel für eine weite Reise denken. Allmählich waren die Maultiere denn auch mit so reichen Brotvorräten beladen, daß eine Hungersnot nicht zu befürchten war, wenn auch wochenlang keine eßbare Frucht und kein jagdbares Wild mehr hätte gefunden werden können.
Auch die Banane oder Pisangstaude fand sich als verwildertes Kulturgewächs in Menge vor; obgleich sie kein Baum, sondern ein Kraut ist und daher weder Stamm noch Äste, sondern bloß einen Stengel und Blätter besitzt, wird sie doch über sechs Meter hoch, und zwar innerhalb eines Jahres, da die Pflanze nach der Fruchtreife abstirbt und wieder aus der Wurzel nachtreibt. Die Früchte, die in traubenförmigen Büscheln von der Pisangstaude herabhängen, sind von köstlichem Wohlgeschmack und wurden von der ganzen Gesellschaft mit Vorliebe gegessen; sie ersetzen Brot und Obst zugleich. Die Spanier nennen die großblätterigen Bananen »Platanos« und »Platanillos«.
Ferner waren da Kaffee- und Kakaobäume, Zuckerrohr und Chirimoya, die beliebteste Frucht der Tropen, auch Orangen und andre Früchte — so daß eine solche verwilderte Pflanzung auf Tage hinaus Vorräte für die ausgesuchtesten Mahlzeiten lieferte. Besonders entzückt waren die Indianer über die Entdeckung einiger Kokabüsche, von deren Blättern sie große Mengen sammelten: Schmerzen und Ermattung werden durch das Kauen dieser nervenbetäubenden Pflanze gehoben. Die Weißen jedoch verschmähten für gewöhnlich dieses Betäubungsmittel, das auch giftige Eigenschaften hat, und dessen Wirkungen einem Rausche gleichen, dem der leidige Katzenjammer folgt.
An diesem Tage sollten unsere Freunde einige nicht ungefährliche Abenteuer bestehen: es schien, als ob gerade diese Gegenden, die der Urwald wieder der Kultur abgerungen hatte, ganz besonders von verschiedenem Getier heimgesucht würden, das sich entweder an den Pflanzen erlabte, die der Mensch zu seinem eigenen Nutzen und gewiß nicht für das Wild gepflanzt hatte, oder sich in einer Art triebmäßiger Rache die unbegrenzte Herrschaft über ein Gebiet wieder anmaßen wollte, aus dem es früher verdrängt worden war.
Die erste Begegnung, die die Reisenden am Morgen des 5. Novembers hatten, war die mit einem Rudel Pekari. Mit großer Schnelligkeit stürmten diese kleinen Wildschweine daher.
»Aha! da wollen wir hineinpfeffern!« rief Schulze erfreut; denn seit seinem gestrigen Sieg über die Seekuh war die Jagdleidenschaft in ihm erwacht, und bereits legte er die »nie fehlende Büchse« an, wie er sie Matatoa gegenüber so stolz genannt hatte. Nach seinen früheren Leistungen hätte er sie eher die »nie treffende Büchse« heißen dürfen, was ebenso poetisch, wenn auch weniger selbstbewußt klingt. Nun, hier wäre ihm ein Treffer sicher gewesen, denn Rücken an Rücken drängten sich die Pekari zu seinen Füßen.
»Halt!« schrie aber Unkas. »Vater der vier Augen, gebiete deinem ungestümen Mute; wenn du die wilden Pekari erzürnst, so rennen sie uns samt unseren Tieren über den Haufen, und dann mag die Sonne uns zum letzten Male geschienen haben. Siehe! jetzt weichen sie uns aus und teilen sich vor uns wie die Flut vor dem Felsen; laß die große Masse vorüberziehen, so können wir sorglos die Nachzügler erlegen.«
Schulze ließ sich glücklicherweise warnen und setzte, allerdings nicht ohne Bedauern, die »nie fehlende Büchse« ab; eine Ahnung sagte ihm, daß er beim Schießen auf ein vereinzeltes Tier geringere Aussichten habe, als wenn er in die dichte Masse gepfeffert hätte. Aber mit einer Herde von Hunderten dieser kräftigen Eber war nicht zu spaßen; er sah es ein, unnötig reizen durfte er sie nicht. Als der Haupttrupp glücklich vorüber war, nahm er zwei Nachzügler aufs Korn; allein seine Ahnung hatte ihn nicht betrogen: er fehlte beide.
»Das kommt nur daher,« entschuldigte er sich, »daß ich auf beide zugleich gezielt habe; darum mußte die Kugel nach dem Gesetz des Parallelogramms der Kräfte zwischen beiden hindurchfahren.«
Ulrich und Friedrich schossen nicht, da sie kein Wildbret nötig hatten und nicht aus bloßer Mordlust das ein oder andere Tier erlegen mochten. So kamen die Pekari unversehrt aus der größten Gefahr ihres Lebens.
Aber alsbald winkte dem kühnen Jäger eine neue Beute: »Tatu!« rief Matatoa aus und deutete auf ein etwa ein Meter langes gepanzertes Tier, das eine sanftabfallende Anhöhe herunterkroch, beim Anblick der Reiter aber einhielt und sie mit seinen kleinen Augen mißtrauisch ansah.
»Aha! Ein Gürteltier oder Armadill,« erläuterte Schulze verständnisvoll; und als müsse jedes lebende Geschöpf im Urwalde fortan die unwiderrufliche Beute seiner nie fehlenden Büchse sein, schoß er ohne weiteres auf das wehrlose Tier. Allein das gestrige Jagdglück lächelte ihm heute nicht mehr; er fehlte — zwar kaum um Armeslänge, aber gefehlt hatte er eben doch. Im Nu kugelte sich das Armadill zusammen wie eine Riesenkellerassel und rollte den Hügel hinab gerade vor die Füße des verblüfften Schützen, oder vielmehr seines Maultiers. Dieses blieb jäh stehen.
»So ist's recht!« sagte Schulze, nachdem er sich von seinem Erstaunen erholt hatte; erst jetzt fiel ihm ein, welche Torheit es für einen Jäger seiner Güte gewesen war, mitten im Trab vom Reittier herunter ein Wild treffen zu wollen.
»Jetzt hat aber deine Stunde geschlagen!« rief er siegesgewiß. »Wer sich mutwillig in Gefahr begibt, kommt darin um!«
Inzwischen hatte sich das Gürteltier wieder aufgerollt und wühlte mit erstaunlicher Geschwindigkeit mit seinen mächtigen Klauen ein Loch in den Boden. Schulze sah mit weit aufgerissenen Augen, wie das Tier vor seinen Augen allmählich in der Erde verschwand, und der enttäuschte Nimrod kam vor lauter Verwunderung gar nicht zum Schuß.
»Das ist Hexerei!« rief er empört, während Ulrich und Friedrich über seine fassungslose Miene in ein helles Gelächter ausbrachen und selbst die nie lachenden Indianer etwas von dem feierlichen Ernste ihrer Gesichtszüge verloren.
»Mein Vater kennt die Kunst des Tatu noch nicht,« meinte Unkas. »Es kriecht in die Erde wie in eine offene Höhle.«
Dies war nun freilich ein harmloses Abenteuer; eine der größten Gefahren der Tropen sollte Schulze erst kennen lernen, als die Reisegesellschaft sich zur Mittagsrast am Fuße eines kahlen, vom Walde eingeschlossenen Felsens lagerte.
Die Mahlzeit war beendet, und alle ruhten langhingestreckt am Boden, während die Maultiere in der Nähe grasten, als der Professor plötzlich einen durchdringenden Schrei ausstieß und seine linke Hand jammernd hoch empor hielt, sie heftig hin und her schwenkend. Alles Schütteln befreite ihn jedoch nicht von dem ungeheuren, fünfzehn Zentimeter langen Skorpion, der mit seinem Stachel den Handrücken bearbeitete wie mit der Nadel einer Nähmaschine. Blitzschnell folgte Stich auf Stich, und Schulze wagte nicht, mit der anderen Hand zuzugreifen, kam auch in seinem Schrecken nicht auf den schlauen Gedanken, durch starkes Ausdrücken der Hand gegen den Boden das giftige Tier zu zermalmen.
Friedrich sprang sofort auf, und ohne der Gefahr zu achten, selber gestochen zu werden, ergriff er fest Schulzes Handgelenk und schlug mit der anderen Hand aus aller Kraft auf den Skorpion, den er völlig zerquetschte. Der Professor zeterte zum Erbarmen, und das war kein Wunder, denn nicht leicht ist etwas so schmerzhaft wie der Stich eines Skorpions. Die Hand schwoll bereits hoch auf, und der gequälte Naturforscher wollte sie eben von dem Brei, in den Friedrichs kräftiger Schlag den Skorpion verwandelt hatte, säubern, als Matatoa und Unkas zugleich ihm zuriefen, dies ja nicht zu tun, wenn ihm sein Leben lieb sei, da eben dieser zerquetschte Körper das einzig sichere Heilmittel für die sonst lebensgefährlichen Wunden sei.
»Das weiß ich nun besser,« sagte Schulze unter fortwährendem Stöhnen. »Lebensgefährlich sind die Stiche nicht, das ist Mumpitz und Aberglaube; aber scheußlich schmerzen — das tun sie!« Für alle Fälle ließ er jedoch die sonderbare Heilsalbe unberührt liegen und band sie mit einem Streifen Verbandzeug fest.
Eine nähere Untersuchung des Platzes ergab, daß es unter dem Laub und den Rindestücken rings umher von Skorpionen und Tausendfüßlern wimmelte, und auch einige gefährliche Giftspinnen zeigten sich. Die Ruhe wurde daher jäh abgebrochen und der unheimliche Ort so rasch wie möglich verlassen.
Aber damit hatte dieser außerordentliche Tag seine Zufälle noch nicht erschöpft. Eine Strecke weit waren die Ufer des Orinoko wieder ebener, so daß sich unmittelbar an ihnen hin reiten ließ. Friedrich ritt voran, als plötzlich Salvado, der Brüllaffe, der vor ihm auf dem Kopf des Maultiers saß, seinen Warnungsruf erschallen ließ, der diesmal so entsetzt klang, daß allen ein Gefühl eisigen Schreckens durch die Glieder fuhr.
Friedrich blickte auf und sah, wie sich über seinem Haupte der widerliche Kopf einer Riesenschlange wiegte; der Leib war unter Blättern und Blüten der Lianen verborgen, aber ein Blick auf den dicken Hals des Ungetüms ließ erkennen, daß es sich um ein Reptil handelte, das imstande war, das Maultier samt dem Reiter zu Brei zu zermalmen. Was konnte bei solchen Aussichten der Trost nützen, daß der Biß der Riesenschlange nicht giftig ist?
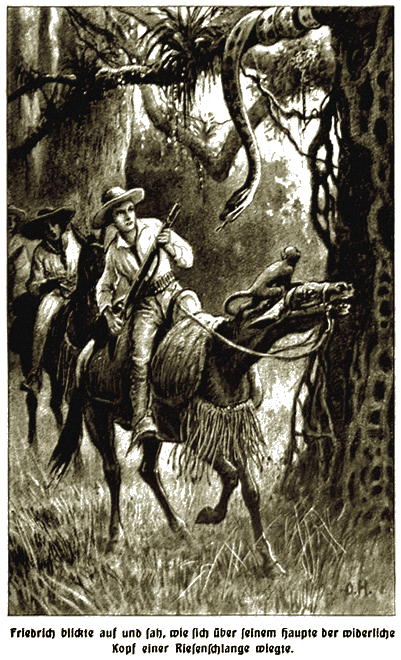
Friedrich riß zwar augenblicklich das Gewehr von der Schulter; aber es war schon zu spät. Wie der Blitz schoß die Boa herab und wand ihre Ringe um das ängstlich aufbrüllende Maultier und den Jüngling, der keinen Arm mehr bewegen konnte.
Der Jüngling dachte nicht anders, als seine letzte Stunde habe geschlagen; denn er hatte viel von der Gefährlichkeit der Anakonda oder Wasserschlange gehört, und er fühlte ja bereits die Gewalt ihrer Muskelkraft, wie sie die Ringe enger zog, so daß ihm der Atem benommen wurde; im nächsten Augenblick mußten ihm sämtliche Rippen in dieser Umklammerung zerdrückt werden.
Ulrich war in Verzweiflung, er konnte nicht schießen; denn nicht allein ritt Unkas zwischen ihm und Friedrich, sondern der Kopf der Schlange, auf den er allein hätte zielen dürfen, verschwand für ihn hinter dem Kopf des bedrohten Bruders. Unkas aber hatte die Sachlage erfaßt, und obgleich er wenig ausrichten konnte, tat er doch sein möglichstes: er riß den Lasso vom Sattel und warf ihn so geschickt über Friedrichs Schulter weg nach der Schlange, daß die Schlinge über ihren Kopf hinabglitt. Dies war ein Meisterstück; denn auch von Unkas' Standpunkt aus war der Kopf der Anakonda kaum sichtbar. Leider war keine Hoffnung vorhanden, daß der Jüngling durch dieses Unternehmen gerettet werden könnte; der glatte, bewegliche Hals der Schlange bot nicht den Widerstand, der nötig gewesen wäre, um die Schlinge zuzuziehen. Doch auch das Undenkbare mußte in dieser schrecklichen Lage versucht werden; sobald daher Unkas sah, daß sein Wurf so weit geglückt war, riß er sein Maultier herum und jagte seitwärts in den Wald.
Gleichzeitig war Ulrich zu Boden gesprungen, um, wenn irgend möglich, dem Bruder noch rechtzeitig Hilfe zu leisten.
Es kam leider, wie vorauszusehen war: statt daß die Schlinge sich um den Hals der Anakonda zusammengezogen hätte, glitt der Kopf des Reptils aus dem Lasso heraus, sobald Unkas diesen im Davonreiten mit jähem Ruck anziehen wollte. Durch den Ruck jedoch war der Kopf der Boa, ehe er der Schlinge entglitt, zur Seite gerissen worden, und dieser Augenblick genügte Ulrich, um seine Kugel hart an Friedrichs Wange vorbei dem Untier in den Kopf zu jagen.
Die Anakonda hatte genug! Noch einige Zuckungen, und ihr Riesenkörper fiel kraftlos herab, die mörderischen Ringe lösten sich auf, und Friedrich, der schon geglaubt hatte, zu spüren, wie seine Rippen knackten, konnte wieder frei aufatmen; aber nur einen Augenblick — dann fiel er schlaff und bleich vom Maultier herab, während auch dieses erschöpft zu Boden sank.
Es war nicht sowohl der ausgestandene Todesschrecken als vielmehr die enge Einschnürung, die Friedrich die Besinnung raubte. Es ist eine oft beobachtete Erscheinung, daß eine Ohnmacht auch dann noch nachträglich eintritt, wenn die Umstände schon beseitigt sind, die sie verursachten. Während sich Ulrich und Schulze eifrigst um den Besinnungslosen bemühten, seine Kleider öffneten und sein Gesicht wuschen, zogen die Indianer mit aller Seelenruhe der erlegten Wasserschlange die wertvolle Haut ab; darauf verstanden sie sich meisterlich.
Inzwischen kam Friedrich wieder zu sich, und nun zeigten Unkas und Matatoa herzutretend eine solche Freude, daß man wohl sah, sie besaßen wirklich ein menschliches Fühlen und hatten nur darüber ihren praktischen Sinn nicht verloren; was hätten sie auch helfen können, solange der Jüngling ohnmächtig war? Untätiges Herumstehen aber und fruchtloses Jammern hätten sie als weibisch verachtet.
Ganz besonders jedoch beglückwünschten sie Ulrich zu seiner Leistung; sie taten es zwar nicht mit überschwenglichen Worten: allein man hörte es ihnen wohl an und merkte es auch an ihren bewundernden Blicken, daß Ulrichs Kühnheit und die Sicherheit seines Schusses ihnen ebensoviel bewundernde Achtung abnötigte wie Friedrichs heldenhaftes Benehmen angesichts des Todes: war doch kein Laut der Todesangst über des Knaben Lippen gekommen! Von ihrem Herrn, dem Vater der vier Augen, waren sie solche Unerschrockenheit nicht gewöhnt, und wenn sie es auch selber an Kühnheit und Selbstbeherrschung lange nicht ihren freien Ahnen gleichtaten, so fühlten sie sich im stillen doch gerne in dieser Beziehung den Weißen überlegen.
Nun aber hatten sie zwei weiße Knaben kennen gelernt, die sich in diesen Tugenden mit jedem roten Manne, auch mit ihren alten Sagenhelden wohl messen durften.
Obgleich sich Friedrich rasch erholt hatte, wurde der Aufbruch doch verzögert; denn alle waren der Ruhe bedürftig nach den Aufregungen des letzten Kampfes. Schulze hatte die Schmerzen an seiner Hand über dem Schrecken vergessen; nun machten sie sich wieder geltend; doch hätte er sich geschämt, nach den Proben von Standhaftigkeit, deren Zeuge er soeben gewesen war, noch einen Klagelaut von sich zu geben.
»So wird man zum Manne unter Männern,« dachte der Gelehrte bei sich, ohne sich zu verhehlen, daß er die Mannhaftigkeit von Jünglingen erst lernen mußte, die, kaum dem Knabenalter entwachsen, durch ihr Benehmen sich als Männer kundgaben und sich ihm selber überlegen zeigten, der doch an Jahren ihnen weit voraus war.
Daß auch sein Wissen, auf das er sich gerne etwas zugute tat, durchaus nicht so hoch über den Kenntnissen der jungen Helden stand, wie er anfangs gemeint hatte, daß er vor allem an Vielseitigkeit der Bildung ihnen entfernt nicht gewachsen war, das hatte er schon früher eingesehen. Anfangs war ihm das wohl eine bittere Erkenntnis gewesen; denn seine Gelehrsamkeit war sein ganzer Stolz; aber er mußte anerkennen, daß seine jungen Freunde in harmloser Bescheidenheit nicht daran dachten, irgendwie auf ihn herabzusehen, daß sie vielmehr sein reiferes Alter ehrten und unbefangen bei ihm Belehrung suchten, sich aufrichtig freuend, wenn er ihnen über irgend einen Gegenstand etwas Neues sagen konnte. Und so gering ihm selber alles vorkam, was er sie etwa noch lehren konnte, während er ganz im stillen so vieles von ihnen lernte, so sah er doch wohl, wie die beiden Brüder eine kindliche Hochachtung vor seiner Fachgelehrsamkeit hegten.
So mußte er sie denn von ganzem Herzen liebgewinnen, und das Verhältnis der drei weißen Reisegefährten war in der kurzen Zeit ihres Zusammenseins ein wahrhaft herzliches und seelenerquickendes geworden.
DAS Bett des Orinoko wurde immer breiter, und große Inseln teilten den Strom in mehrere Arme; der Charakter des Urwalds veränderte sich nun insofern, als seit langer Zeit zum ersten Male die Palme wieder auftrat, die von unseren Freunden als langvermißte Bekannte freudig begrüßt wurde.
Der Weg führte durch die verlassene Jesuitenmission Pararuma, an der Insel Javanavo vorbei und über die Mündung des Canno Aujacoa. Hier erblickten die Reisenden den Mogote de Cocuyza, wohl die merkwürdigste Felsbildung, die sich überhaupt denken läßt; wie bei dem Tepupano de los Tamanacos bei Encaramada kann man sich des Gedankens nicht erwehren, man habe hier das gewaltige von Menschenhänden aufgetürmte Denkmal eines untergegangenen Riesengeschlechtes vor sich. Hoch über die höchsten Wipfel der Urwaldriesen steigt ein vereinzelter, dreieckig gestalteter Granitfelsen mitten aus einem Palmenwalde empor, seine über sechzig Meter hohen Wände sind schroff und kahl. So bildet er eine gleichmäßig geformte Riesensäule. Und oben auf dem Fries dieser natürlichen Säule liegt eine große, flache Felsplatte wagrecht auf. Was aber das merkwürdigste ist und dem unvergleichlich malerischen Anblick etwas ganz Märchenhaftes verleiht, ist der Umstand, daß auf jener Felsplatte wiederum Bäume stehen: in einer Höhe von sechzig Metern wächst ein Wald hoch über dem Urwald, frei, wie auf einem Präsentierteller! Diese wunderbare Steinsäule mitsamt ihrem merkwürdigen Walde hob sich scharf gegen den klaren Abendhimmel ab.
Schulze war außer sich vor Erstaunen, und während die andern, von dem Anblick überwältigt, schwiegen, mußte er, wie immer, seinen Gedanken und Gefühlen Worte verleihen: »Wenn einer das malen wollte, ja wenn er es photographierte — niemand würde es glauben! Das ist die Unwahrscheinlichkeit, ja, die Unmöglichkeit selber; das soll nun die Natur so zusammengekleistert haben? Ne! Wenn ich nicht meine sechs gesunden Sinne und meine vier Augen bei mir hätte, ich würde es jetzt noch nicht glauben. Aber nun glaube ich einfach alles: ich glaube an den Kristallberg, an den Magnetberg, an die goldene Stadt Manoa und meinetwegen auch an das Vorhandensein des Fabeltiers, dessen Nichtvorhandensein ich nachzuweisen gedenke.«
Ulrich lachte. »Ihre vier Augen sind Ihnen ja nicht abzustreiten, Herr Professor; aber sechs Sinne? Stimmt das auch?«
»Warum nicht? Sie meinen wohl, weil die meisten Menschen nur vier Sinne haben?«
»Vier?« fragte nun Friedrich verwundert.
»Na ja, junger Freund, es ist doch nicht zu leugnen — man braucht nur an die Mode zu denken — daß es den meisten Menschen völlig am Geschmacke fehlt, leider! Ich aber rühme mich meiner sechs Sinne, denn als Gelehrter habe ich deren naturgemäß mindestens sechs; und der sechste, für einen Professor der unentbehrlichste, ist der Scharfsinn: Sie meinen doch nicht etwa Blödsinn?! Natürlich, wenn Sie mich so nach meinem Gerede beurteilen — aber ich sage Ihnen, wenn ich erst ans wissenschaftliche Auseinandersetzen und Beweisen gehe, da dampft mir der Scharfsinn aus allen Poren.«
»Und der gute Humor bewahrt seine Schärfe vor dem Schartigwerden, das ist noch das Beste dabei! Hören Sie, Herr Professor, jeden Tag werde ich dankbarer, daß wir einen ebenso gelehrten wie muntern Reisegefährten in Ihnen gefunden haben. Mir graut ordentlich beim Gedanken, wir hätten die weite Reise ohne Sie machen müssen! Da uns der Himmel solch ein Glück zuteil werden ließ, bin ich auch mehr denn je voller freudiger Zuversicht, daß er auch das Endziel unserer Fahrt krönen will und uns unseren Vater gesund und fröhlich wiederfinden lassen wird.«
Schulze erwiderte ganz beschämt: »Lassen Sie man, junger Freund! Ich sage Ihnen, der Vorteil bei diesem gemeinsamen Reisen ist völlig auf meiner Seite. Ganz abgesehen von dem Vergnügen, das mir Ihre Gesellschaft tagtäglich gewährt, und von dem Gefühl der Sicherheit, das ich so mutigen und schießkundigen Jägern in diesen Wildnissen verdanke, lerne ich auch von Ihnen allerlei Nützliches. Es ist ja gewiß etwas Schönes um die Wissenschaft; doch mit ihr allein kommt man hierzulande nicht weit. Mit all meinen zoologischen Kenntnissen kann ich mir weder einen Braten erobern noch ein Raubtier vom Halse schaffen. Na, da ist mir's doch lieber, ich habe zwei solche Helden und praktische Lehrmeister zur Seite, als wenn ein ganzes Dutzend weltberühmter Kollegen mit Köpfen voll herrlicher Weisheiten mir das ehrenvolle Geleite gäbe.«
Es begann nun rasch zu dunkeln. Das Bett des Orinoko verengte sich wieder; auf dem linken Ufer drängte sich ein flachgipfeliger Berg wie ein Vorgebirge in den Strom, die Fortaleza de San Francisco Xavier oder die »Jesuitenschanze«, ein Berg, der auf alten spanischen Karten auch den Namen »Trinchero del despotismo monacal« führt, das heißt »Schanze der mönchischen Willkür«. Warum er diesen bezeichnenden Namen erhielt, werden wir bald erfahren.
Auf diesem Berge, der die Umgegend beherrschte und eine weite Aussicht gewährte, standen zwei hagere, dunkelfarbige Männer und spähten scharf aus nach den Reitern, die ihrerseits von den Beobachtern nichts sehen konnten; denn diese waren fast bis auf die Augen durch die Mauerruinen der alten Missionsfestung gedeckt.
»Es war doch ein guter Gedanke von mir, den Berg zu ersteigen,« hub der eine an. »Ich dachte mir's wohl, daß die Halunken uns auf den Fersen seien: aber sie sind entdeckt und ahnen unsere Nähe nicht; das bedeutet schon halb unseren Erfolg und ihr Verderben! Was meinst du, Alvarez?«
»Mag sein, Diego, aber auch bloß halb; wir haben sie noch nicht, und sie sind nun zu fünft, wie ich sehe.«
»Pah! Wenn wir die Guahibo auf sie hetzen ...«
»Wird schwer halten! Du weißt, die Roten setzen ihr Leben so ungern aufs Spiel wie wir, und wenn sie einmal merken, wie sicher die Kugeln dieser Kunstschützen treffen, werden sie den Kampf bald aufgeben: wir müssen eine List ersinnen.«
»Also! Sinne nur zu; das ist dein Fall!« lachte Diego. Und nachdem die Späher beobachtet hatten, wo die Reiter ihr Lager aufschlugen, eilten sie den Hügel hinab und fuhren auf einer bereitstehenden Pirogue über den Fluß, an dessen jenseitigem Ufer sie landeten, das heißt eben an demjenigen, wo unsere Freunde lagerten.
Am Waldsaume hatte eine Indianerbande vom Stamme der Guahibo ihr Lager aufgeschlagen. Die Weiber waren emsig mit allerlei Zubereitungen beschäftigt, während die Männer um die eben entzündeten Feuer herum hockten, trinkend und rauchend, aber selten ein Wort sprechend.
An einem dieser Feuer saß lebhaft redend und gestikulierend ein Mestize; der Häuptling jedoch, den er mit seinem Wortschwall überflutete, gab ihm nur spärliche Antwort.
Da kamen Alvarez und Diego im Lager an und berichteten dem Häuptling ihre Beobachtungen. »Die Weißen,« sagte Alvarez, »kennen wir gut: sie sind ausgezogen, um geeignete Stätten zur Niederlassung für europäische Auswanderer zu suchen und zugleich nach einer goldenen Stadt des Omaguastammes zu forschen, von der sie fabeln, daß sie im Lande der Napoindianer zu finden sei.«
Diese Worte brachten Leben in den Häuptling; er sprang auf und rief: »Die Omagua sind freie Krieger! Gottlob, daß die Missionen nicht mehr da sind! Die Napo und Guahibo werden nicht dulden, daß die Weißen wiederum ihre Steinzelte in den freien Jagdgründen der Sonnenkinder aufrichten; wo sind die Kundschafter? Meriyoko wird ihnen die Lust austreiben, in den Wäldern und Llanos der Omagua und Guahibo zu lagern.«
»Die Guahibo müssen die Spione mit List überwältigen; denn sie haben Feuerrohre, die nie fehlen.«
Sonnenauge, das bedeutet nämlich der Name des Häuptlings Meripoko, ließ sich gern dazu überreden, die vermeintlichen Feinde zu überlisten; denn die Indianer Südamerikas zeichnen sich, wie wir bereits wissen, im allgemeinen nicht durch kriegerischen Mut aus, obgleich es auch einzelne Stämme gegeben hat, die Wunder der Tapferkeit verrichteten, wie zum Beispiel die Tayronen: das waren aber Ausnahmen.
Friedrich und Schulze waren ausgezogen, um an den Ufern des Paruasi dem Wild aufzulauern, als plötzlich aus dem Gebüsch zwei Indianer auf sie zu traten.
Diese unerwartete Erscheinung erschreckte sie nicht wenig; namentlich Schulze versah sich des Schlimmsten und legte schon auf einen der Ankömmlinge an; aber Friedrich rief ihm zu, keine Torheit zu begehen, da die Wilden unbewaffnet seien und durch Reden und Gebärden ihre freundschaftlichen Absichten kundtäten. Sie sprachen ein gebrochenes, aber immerhin verständliches Spanisch, und bald waren sie in lebhaftester Unterhaltung mit den weißen Jägern. Namentlich bezeugten sie die größte Neugier, die Einrichtung der Magazingewehre näher kennen zu lernen. Friedrich erklärte ihnen alles mit Freuden, und jeder der Indianer nahm eines der Gewehre zur Hand und betrachtete es mit solch ungekünstelter Neugier, daß selbst Schulze, völlig beruhigt, über die kindliche Harmlosigkeit dieser Naturkinder lächelte.
Aber, was war das? Plötzlich machten diese harmlosen Naturkinder kehrt und waren mitsamt den Gewehren im dämmernden Walde verschwunden. Nach dem ersten Augenblicke der Verblüffung setzten die beraubten Jäger den Flüchtlingen nach. Allein im Dickicht standen mehrere Guahibo verborgen, diese umzingelten im Nu unsere Freunde und hatten sie trotz der heftigsten Gegenwehr bald gefesselt.
Inzwischen hatten zwei andere den Versuch gemacht, Ulrich in der gleichen Weise zu überlisten. Da waren sie aber an den Unrechten gekommen, der Jüngling gab sein Gewehr nicht aus der Hand und schärfte Unkas und Matatoa größte Wachsamkeit ein.
Die Guahibo entschlossen sich daher zu einem Massenangriff, und da es ihnen leicht war, die Gegner von allen Seiten zu umzingeln, so gelang ihnen auch deren Überwältigung, freilich nicht, ohne daß mehrere der Angreifer durch Ulrichs Kugeln schwer verwundet worden wären.
Hätte Ulrich an Unkas und Matatoa ebenbürtige Helfer gehabt, so wären die Guahibo gewiß unverrichteter Sache gewichen; so aber, auf ebenem Grunde, ohne gute Deckung, im unsicheren Dämmerlicht und von allen Seiten umzingelt, konnte selbst ein Schütze wie Ulrich nicht lange Widerstand leisten; er wurde mitsamt den roten Dienern gefesselt und in das Guahibolager geschleppt, in dem sich Friedrich und Schulze bereits in gleich betrübtem Zustande befanden.
Das war ein trauriges Wiedersehen, da beiden Teilen die Hoffnung auf Befreiung durch die Gefährten geraubt wurde, als sie sahen, daß es den anderen nicht besser gegangen war als ihnen selbst.
Die Indianer beratschlagten nun, was mit den Gefangenen anzufangen sei. Meriyoko erklärte, die Entscheidung habe Otomak, der Oberhäuptling, zu treffen; er werde ja bald von seinem Jagdzug zurückkehren.
Die Mestizen wollten davon nichts wissen, denn sie kannten Otomaks bedächtiges Wesen nur zu gut; er würde den Gefangenen kein Leid zufügen, ehe er nicht vollkommen von ihrer Schuld überzeugt war; überdies mißtraute dieser den Mestizen in einem solchen Maße, daß sie bereits entschlossen waren, ihren Aufenthalt im Indianerlager kurz abzubrechen.
Meriyoko hingegen war den drei Schurken sehr gewogen; denn die schlauen Gesellen hatten des Unterhäuptlings Schwächen erkannt und ihn durch plumpe Schmeicheleien ganz für sich gewonnen.
Auch jetzt redeten sie ihm ein, er sei weiser und entschlossener, mutiger und tatkräftiger als Otomak, in dessen Abwesenheit er überhaupt als alleiniger Oberhäuptling zu handeln habe: »Mein Bruder,« sagte Lopez, »wird den Guahibo und allen Sonnenkindern zeigen, daß er ihr wahrer Schutz und ihre Rettung ist, so wird sein Ansehen und seine Macht unter ihnen wachsen wie der zunehmende Mond; denn Meriyoko ist mehr als zehn Otomake.«
Solche Schmeichelreden bestimmten den schwachen Unterhäuptling, rasch zu handeln, einige Pfeilschüsse sollten dem Leben der unglücklichen Gefangenen ein schnelles Ende bereiten.
Don José aber war von solch grausamer Rachgier erfüllt, daß er seinen Feinden keinen leichten Tod gönnte; langsam sollten sie hingemordet werden, und er wollte sich an ihren Qualen weiden und in giftiger Verhöhnung seiner Opfer schwelgen. Was Schulze und die beiden Indianer betraf, so hieß es für den Mestizen: »Mitgefangen, mitgehangen!« Die grausamen Triebe des Spaniers, die sich in der spanischen Inquisition so deutlich zeigten und heute noch bei den blutigen Stierkämpfen zutage treten, waren in diesem herzlosen Mestizen ganz besonders lebendig; keine größere Wollust kannte er als den Anblick unmenschlicher Qualen, die solche Leute erdulden mußten, die er nicht leiden konnte.
Bisher hatte er noch keine Gelegenheit gefunden, dieser Lust so recht zu frönen; diesmal aber sollte sie ihm nicht entgehen. Seine Gefährten stimmten hierin ganz mit ihm überein.
»Ich will euch lehren, wie man solche Schurken straft,« sagte Alvarez zu Meriyoko. »Eure roten Brüder gegen Mitternacht sind darin viel geübter als ihr; lasset nur mich machen.«
»Die Gefangenen gehören meinem Bruder,« erwiderte Meriyoko, neugierig auf des Mestizen Verfahren, »er hat sie entdeckt und die List erdacht, durch die wir sie überwältigten; er befehle, was mit ihnen geschehen soll.«
»So entkleidet die Elenden und hängt sie mit den Händen in einer Reihe an diesen Baumast, daß sie frei schweben und in der Luft zappeln und tanzen können, während ihre Arme sich hübsch ausdehnen!«
Der Befehl wurde ausgeführt, und bald schwebten die Leiber der Unglücklichen in der Luft, mit dem ganzen Gewicht an den Handgelenken hängend. Schon dies allein wurde binnen weniger Minuten zur unerträglichen Qual, da die Gelenke und Muskeln in schrecklicher Weise auseinandergezerrt wurden.
Nun aber gebot der teuflische Mestize, Laub und dürre Zweige unter den Füßen seiner Opfer anzuhäufen und in Brand zu stecken: »Solch ein Schauspiel werdet ihr noch nie genossen haben, rote Brüder,« rief Alvarez. »Da sollt ihr einen Tanz sehen! Gebt acht, wie sie die Füße hinaufziehen und zappeln, wenn es unter ihnen heiß wird!«
In der Tat war es eine furchtbare Qual, als die Flammen gegen die Fußsohlen der Unglücklichen emporzüngelten, und Schulze versuchte auch durch krampfhafte Bewegungen seine Beine zeitweise aus dem Bereiche der Glut zu bringen. Ulrich und Friedrich hingegen gönnten ihren Henkern ein solches Schauspiel so wenig wie Unkas und Matatoa; denn einmal waren sie stolz genug, um eine solch übermenschliche Standhaftigkeit zu zeigen, sodann sagten sie sich, daß sie mit allem Gezappel ihre Qualen nur verlängern konnten, ohne dem Tode des langsamen Verbrennens zu entgehen.
Die Mestizen, besonders Alvarez, suchten durch allerlei höhnische Reden die Ärmsten zu reizen; es gelang ihnen aber nicht; nur kalte Verachtung war in den regungslosen Gesichtern der jungen Deutschen zu lesen, und die Guahibo begannen hohe Bewunderung für diese Helden zu empfinden.
Schon waren die Füße der Gemarterten mit Brandblasen bedeckt, als plötzlich eine scharfe Stimme erscholl: »Seit wann üben die Krieger Otomaks die barbarischen Gebräuche der spanischen Eroberer vor dreihundert Jahren? Wer hat diese Schändlichkeit angeordnet?«
Aufs heftigste erschrocken wandte sich Sonnenauge um; er beeilte sich, den erzürnten Oberhäuptling zu versichern, daß dies alles auf Anordnung der Mestizen geschehe.
»Seit wann haben Fremdlinge im Lager Otomaks zu gebieten? Löschet das Feuer, ihr Krieger, und jaget die frechen Mestizen mit der Seekuhpeitsche hinaus! Und mit Meriyoko wird Otomak später die Sprache der Gerechtigkeit reden.«
Die Mestizen warteten nicht auf die Seekuhpeitsche, im Nu hatten sie ihre Maultiere erreicht, die außerhalb des Lagers weideten, und da niemand sie verfolgte, konnten sie die Reittiere satteln und die Lasttiere mit dem Gepäck beladen, um dann in höchster Eile ihre Flucht durch den Urwald zu bewerkstelligen.
Unsere Freunde wurden unterdessen aus ihrer qualvollen Lage befreit, ihre Füße mit zerquetschten Heilkräutern verbunden und ihre Kleider und Waffen ihnen wieder zugestellt. Ihr mutiges Verhalten hatte bereits des Indianerhäuptlings Herz für sie eingenommen; dennoch ließ sich ein leises Mißtrauen in den Blicken entdecken, die er ihnen von Zeit zu Zeit zuwarf, während er sie an ein Feuer inmitten des Lagers bringen ließ.
Hier streckten sich die Erschöpften, denen jeder Schritt unsägliche Qualen bereitete, auf dem Moosteppich nieder; Otomak aber entfernte sich, um an Meriyoko eine gebührende Strafe vollziehen zu lassen. Inzwischen konnten die Ruhenden das Treiben im Lager beobachten.
Zum ersten Male sahen unsere Freunde ein Lager freier Indianer; es bot aber nicht gerade einen begeisternden Anblick. Stumpfsinnig saßen die Männer um ihre Feuer und stierten schweigsam in das Getränke, das sie sich brauten; andere waren damit beschäftigt, ihr furchtbares Pfeilgift, das Curare, herzustellen, wobei sie die größte Vorsicht gebrauchen mußten, um sich nicht selbst durch eine geringe Verletzung den Tod zuzuziehen.
Die Weiber bereiteten abseits den roten Farbstoff, Onoto, indem sie das Wasser peitschten, worein sie den Samen der Bixa orellana geworfen hatten.
An der Bemalung des Leibes konnte man hier reich und arm, vornehm und gering unterscheiden. Da die Farben größtenteils nicht dauerhaft sind, sondern in Regen und Schweiß rasch verwischen, muß die umständliche Bemalung immer wieder erneuert werden. Die rote Farbe ist die geschätzteste und kostspieligste. So erkannte man sofort die Wohlhabendsten daran, daß ihr ganzer Körper rot bemalt war; andere wiesen nur mehr oder weniger zahlreiche rote Striche auf und begnügten sich im übrigen mit gelber Bemalung. Die Ärmsten färbten nur einen Teil des Körpers oder mußten sich gar mit ihrer natürlichen roten Hautfarbe zufrieden geben.
Auch die kunstvolle Art der Muster, mit denen der Leib bedeckt war, wies auf Unterschiede des Ranges oder des Vermögens hin; der Häuptling war leicht daran kenntlich, daß er besonders kunstvolle Zeichnungen an Gesicht, Brust, Rücken, Armen und Beinen auswies; in die roten Arabesken und Gitter schlangen sich bei ihm schwarze Linien, die mit dem ätzenden Farbstoff des Caruto hervorgebracht waren, der viel dauerhafter ist als alle anderen Farben.
Überdies trug er einen bunten Hauptschmuck und ebensolchen Lendenschurz, aus den prächtigsten Federn der Arara und Kolibri zusammengestellt. Diese besondere Zierde, die übrigens bei den Indianern sehr selten zu finden ist, verlieh ihm ein äußerst malerisches und ehrfurchtgebietendes Aussehen. Er war überhaupt ein schöner, hochgewachsener Mann, dessen lebhafte Augen und kluge Gesichtszüge wohltuend gegen die dummen Gesichter um ihn her abstachen.
Nicht lange konnten die Ankömmlinge ihre stummen Betrachtungen anstellen; denn Otomak kehrte nach kurzer Zeit zurück und ließ sich würdevoll an ihrer Seite nieder. Bald darauf führten einige Indianer die Maultiere mit dem Gepäck der Weißen herbei.
Eine Zeitlang verharrte Otomak schweigend und entlockte seiner Pfeife kräftige Wolken; er schien in tiefes Nachsinnen versunken. In der Tat besann er sich, wie er es am besten angreifen sollte, den Gästen eine nähere Erklärung über den Zweck ihrer Reise zu entlocken. Es lag ihm viel daran, hierüber Gewißheit zu erlangen; denn die Guahibo wollten um jeden Preis verhindern, daß sich die Weißen wieder in ihren freien Jagdgründen niederließen, und jeder weiße Reisende erweckte zunächst in ihnen den Verdacht, er wolle nach günstigen Plätzen für neue Niederlassungen suchen.
Eine unmittelbare Frage aber hätte sich Otomak nie erlaubt, denn der Indianer hält Neugier für eine weibische Untugend und vermeidet es ängstlich, in deren Verdacht zu kommen! Darum schlägt er lieber die größten Umwege ein, um durch anscheinend gleichgültige Bemerkungen nach und nach zu erfahren, was er zu wissen wünscht.
So begann denn auch Otomak endlich mit geheuchelter Harmlosigkeit: »Es ist lange her, daß die Guahibo weiße Gesichter in ihren Wäldern gesehen haben; seit die roten Söhne der Wildnis wie vor Zeiten wieder allein ihre Jagdgründe beherrschen, nahen sich keine fremden Jäger ihren Lagerfeuern.«
»Ja, diese Gegenden werden so gut wie gar nicht mehr bereist,« stimmte Ulrich bei.
Schulze, der sich am besten auf die »bilderreiche Sprache« der Indianer zu verstehen glaubte, konnte nun auch nicht länger schweigen. »Mein Auge sieht viele edle Krieger um die Lagerfeuer; die Guahibo bedecken die Erde wie die Grashalme der Llanos.«
»Otomak hat viele tapfere Krieger, und der Tod wohnt in der Spitze ihrer scharfen Pfeile; aber nur wenige sind mit ihm hierhergezogen, und die Lager der Guahibo sind noch zahlreich zwischen dem Meta und dem Sinaruco.«
»Otomak ist ein gewaltiger Häuptling der Guahibo, und seine Macht erfüllt uns mit Bewunderung,« erwiderte Schulze im Brustton der Überzeugung.
Der Häuptling lächelte kaum merklich. »Die Guahibo sind zahlreich wie die Arahu im Orinoko; Otomak gebietet nur über eine geringe Zahl; aber in der Stunde der Gefahr stehen die Häuptlinge zusammen, und dann erfüllen ihre roten Krieger den Urwald wie die roten Ameisen, und nichts vermag ihnen zu widerstehen. Vorzeiten standen viele von ihnen im Dienste der Weißen; denn der Geist der Zwietracht hatte ihre Kraft gebrochen; aber die weißen Männer sind wieder in ihre Lager zurückgekehrt, und die roten Söhne der Wildnis freuen sich ihrer Freiheit und werden sie nicht mehr preisgeben!«
»Will man euch eure Freiheit wieder rauben?« fragte Friedrich.
»Wenn die Weißen kommen, die alten Stätten ihrer Niederlassungen zu schauen, ist es nicht ihre Absicht, auszukundschaften, wo sich neuer Raum finde für ihre Hütten?«
»Ich glaube nicht,« sagte Ulrich, »daß diese Urwälder so bald wieder besiedelt werden; seit Jahrzehnten denkt ja kein Weißer mehr daran, hier neue Niederlassungen zu gründen, wurden doch viele der alten verlassen; auf unserer Reise sahen wir viele Trümmer, die Zeugen waren von der Verödung blühender Stätten.«
»Suchen nicht meine weißen Freunde Raum unter den Guahibo? Unermeßlich sind unsere Jagdgründe, und sie werden finden, was sie begehren; aber die Guahibo werden die Herren ihres Landes bleiben, und die Weißen sollen ihnen als Gäste und Freunde willkommen sein; doch ihre Gesetze und Ordnungen sollen nur für sie selber gelten, der rote Krieger will nach den Satzungen seiner Väter leben.«
»Daran tut ihr recht!« bemerkte nun Ulrich. »Wir aber wollen uns nicht hier niederlassen: wir reisen nach dem Amazonas, um unseren Vater zu suchen, und dieser hier will nur Tiere und Pflanzen studieren.«
Otomaks Gesicht hellte sich sichtlich auf. »Otomak weiß, daß die Weißen solche Dinge gerne schauen und ihre Namen und Bilder in Bücher schreiben; und das ist sicher große Weisheit, obgleich sie keinen Wert hat; aber auch unsere Kinder spielen gerne mit den Eiern der Arahuschildkröte und freuen sich ihrer Gewandtheit im Ballspiel; jedem sein Vergnügen, wenn es dem anderen nicht Schaden bringt — das ist Otomaks Meinung.«
»Du scheinst nicht allen Weißen zu trauen?« gab Ulrich forschend zurück.
»Wenn die Nacht nicht so dunkel wäre,« sagte der Häuptling düster, »so würdet ihr dort drüben einen Berg schauen, den eure Brüder heute noch El Castillo nennen; er hat Mißtrauen in die Seele des roten Mannes gesät.«
»Wir sahen den Berg, als die Dämmerung nahte,« nahm Schulze wieder das Wort.
»Wohl, von diesem Berge kann euch Otomak blutige Dinge erzählen; doch zuvor nehmet das Mahl ein, das meine Krieger euch bereitet haben.«
Die hungrigen Gäste griffen denn herzhaft zu und ließen sich die ohne Schüsseln und Teller aufgetragenen Gerichte trefflich munden. Die Mahlzeit bestand vornehmlich aus Krokodilbraten und Jarumakuchen.
Wenn freilich unsere Freunde bei der Zubereitung dieser leckeren Kuchen zugegen gewesen wären, so wäre es mehr als zweifelhaft, ob sie trotz ihres großen Hungers so lebhaft zugegriffen hätten; denn der Jaruma besteht aus dem geriebenen Marke der Morichepalme, das mit dem Fette dicker Käferlarven reichlich untermengt worden ist.
Prosit Mahlzeit! Aber — was man nicht weiß, macht einem nicht heiß; und so wurden die Kuchen von den harmlosen Weißen ebenso behaglich verzehrt wie von den weniger bedenklichen Söhnen der Wildnis.
NACH beendigtem Festmahl setzte der Häuptling seine Pfeife in Brand und ließ jedem seiner Gäste eine solche reichen. Als der friedliche Qualm ringsum aufwirbelte, begann Otomak folgendermaßen:
»Die Palmen waren noch jung, die über unseren Lagerfeuern ihre Wipfel schütteln, wenn der Hauch der Nacht durch sie hingeht, als der weiße Mann mit den Feuerrohren die Wälder unserer Vorfahren betrat. Er suchte Gold, und aus Goldgier hat er die Länder der Inka und Azteken mit Blut überströmt, aber die unermeßlichen Schätze sind zum größten Teil seiner Habsucht entgangen.
»Als die Eroberer vergeblich die Wildnis durchzogen hatten, um die Sonnenstadt zu finden, die abseits liegt vom Laufe der großen Ströme, dem sie beständig folgten, gaben sie ihre Hoffnungen auf und ließen sich nieder an den Meeresküsten und an den Ufern der großen Wasserläufe. Auch hier am Orinoko setzten sie sich fest und gründeten Missionen, um den Roten ihre Religion beizubringen; und ihre Religion ist gut, weil sie sagt: ›Liebet eure Feinde und tut wohl denen, die euch hassen‹, sie lehrt den Frieden und die Geduld und verbietet Gewalttaten und Blutvergießen. Aber sie handelten selber nicht nach den schönen Geboten ihres Glaubens; denn sie haßten ihre Freunde und verfolgten diejenigen, die ihnen wohltaten! Unsere Väter waren geneigt, die gute Religion der Weißen anzunehmen; aber die Missionare waren ungeduldig, die Seelen zu retten, und vergaßen darüber die Gesetze ihres Gottes: mit Gewalt wollten sie die Söhne der Wälder zu Christen machen, und dann nahmen sie ihnen ihre Freiheit und hielten sie in ihren Niederlassungen zurück.
»Sehet, auf jenem Hügel hatten sie Mauern errichtet und Feuerschlangen aufgepflanzt, um die Väter zu verhindern, ihre Söhne und Töchter, die Brüder, ihre Brüder und Schwestern zurückzuholen in die Freiheit der Wälder; die Weißen zogen mit ihren Feuerrohren aus und zündeten unsere Dörfer an; sie schossen alle nieder, die sich wehrten; die Greise, die Weiber und die Kinder aber schleppten sie in ihre Missionen, um sie zu Christen zu machen.
»Ach! mit Liebe und Güte hätten sie es viel eher erreicht! Aber sie waren voll glühenden Eifers für ihren Gott, der doch ein Gott des Friedens ist. Otomak ist auch in dieser Mission gewesen und im Glauben der Weißen unterrichtet und erzogen worden. Er war ein Knabe von sechs Jahren, als sie seinen Vater durch den Kopf schossen und seine verzweifelnde Mutter in den Flammen ihrer Hütte erstickten. Otomak hat es oft gehört aus dem Munde des Mönches: ›Nur das Knallen des Pulvers kann die Indios dazu bewegen, auf die Stimme des Evangeliums zu hören.‹ Otomak hat die sanften Lehren des Evangeliums vernommen, aber die Peitsche aus Seekuhleder zerfleischte seinen Rücken, wenn er versuchte, aus der Mission zu entfliehen in die Freiheit der Wälder. Er vernahm wohl die schönen Worte, aber er sah auch die blutigen Werke, und das hinderte ihn, den Weißen zu trauen.
»Sie sagten, sie wollten nur unsere Seele retten; aber ihre Gefangenen, Weiber und Greise, Mädchen und Knaben, mußten harte Arbeit verrichten und das Feld bebauen, nicht für sich, sondern für den Unterhalt ihrer weißen Herren, und immer sauste ihnen die furchtbare Peitsche um Brust und Rücken, ihre blutigen Striemen ziehend.
»Alle Farben vermögen an Otomaks Leib nicht die Narben zu bedecken der vielen Wunden, die er als Knabe auf der Mission erhalten hat. Aber die Missionen sind fast alle wieder verschwunden, und die Gefangenen kehrten zurück in die Lager ihrer Stämme, und auch Otomak ist zurückgekehrt und hat seinen alten Namen wieder angenommen; denn in der Mission hatten sie ihn Juanito getauft.
»Er war ein Jüngling, als er die Freiheit wieder gewann; nun ist er ein Greis. Noch immer lebt der Glaube an den guten Geist in seiner Seele, der den Menschen ein Vater ist; aber einen Schwur hat er getan, und den wird er halten, und diesen Schwur haben alle Häuptlinge geschworen, und jeder junge Krieger muß ihn ablegen, ehe er eine Waffe tragen darf. Und dieser Schwur lautet: Wenn wieder weiße Männer dem roten Sohne der Freiheit Gewalt antun wollen, dann werden die Stämme vom Magdalena bis zum Marannon zusammenstehen, und ihre Pfeile werden fliegen wie die Zancudo, daß keiner der blassen Feinde aus ihren Wäldern zurückkehrt.
»Wir wollen Frieden halten mit den weißen Brüdern, aber unsere Herren sollen sie nicht wieder werden.«
»Der große Häuptling hat recht!« sagte Schulze, als Otomak geendigt hatte.
»Wahrhaftig,« bestätigte Friedrich, »die Freiheit eines tapferen Volkes muß man achten; aber ich glaube, die Zeiten sind vorüber, wo unseren roten Brüdern blutige Unterdrückung drohte; die Menschenrechte werden in unseren Tagen auch von den Weißen heiliger geachtet als vor Zeiten.«
»Und wenn sie euch wieder an die Freiheit wollten,« fügte Ulrich hinzu, »so wird euer einmütiger Widerstand ein Fels sein, an dem die Wogen zerschellen!«
»Ja!« sagte Otomak begeistert. »Wie die schwarzen Felsen in den Stromschnellen die Wellen des Orinoko teilen und ihnen trotzen seit Jahrhunderten! — Meine Brüder sind die Freunde meiner Seele, ich höre, daß sie denken wie Otomak. Auch in den Missionen gab es Männer, die also sprachen, aber die Macht war nicht in ihren Händen.«
Nach einer Pause hub der Häuptling wieder an: »Ja, unsere weißen Brüder konnten die roten Söhne des großen Geistes glücklich machen mit der sanften Lehre ihres Gottes; aber statt der Liebe wohnte in ihren Seelen Durst nach Gold und Macht und Ehren, und so brachten sie Tränen und Jammer und Blut über das Land. Darum prüfen die Roten das Bleichgesicht, ehe sie ihm trauen. Gestern kamen drei Schurken in das Lager der Guahibo, die Mestizen, von denen meine weißen Freunde so grausam gemartert wurden. Otomak traute ihnen nicht, wenn sich auch indianisches Blut in ihren Adern mit weißem mischt, sie haben böse Blicke und glaubten schlau zu sein und von Otomak Geheimnisse erforschen zu können; aber der alte Häuptling sah ihre lauernden Gedanken und hat ihnen nichts offenbart.
»Darum konnte er auch euch nicht trauen, ehe er nicht eure Gedanken gesehen hat; nun aber ist er euer Freund. Hätten nur solche Weiße, wie ihr seid, unsere Jagdgefilde betreten, die Weißen und die Roten hätten gute Brüder werden können, die einander glücklich gemacht hätten; jetzt müssen sie ihre eigenen Wege gehen, jeder den seinen.«
Otomaks weiße Gäste mußten sich bei diesen Worten ihrer Rasse schämen, die so namenloses Elend über die glücklichen und harmlosen Kinder der Wildnis gebracht und selbst unter dem Deckmantel des Christentums in blutiger Weise gegen sie gewütet hatte. Wann würden einmal in diese Wälder echte, treue Boten des Evangeliums dringen, von denen es heißen könnte: Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen?
Da es inzwischen spät geworden war, suchten unsere Freunde ihr Lager auf und vergaßen im tiefen Schlummer der Erschöpfung die Schrecken dieses Abends und die Schmerzen, die ihnen noch immer durch die Brandwunden und verzerrten Muskeln verursacht wurden.
OTOMAK ließ seine Gäste am anderen Morgen nur schweren Herzens scheiden; gar zu gerne hätte er ihnen ein Geschenk gemacht; doch außer einigen Lebensmitteln wußte er nicht, was er ihnen geben könnte.
Da fiel sein Auge auf den kleinen Brüllaffen Salvado. »Wie kommen meine Brüder zu dem Tier?« fragte er verwundert. »Die Araguato sind nicht leicht lebendig zu fangen.«
Friedrich erzählte das Abenteuer in den Llanos, dem sie den Besitz des munteren Geschöpfes verdankten.
»Und die weißen Jäger haben eine Freude an dem Äffchen?«
»Wir möchten es um keinen Preis mehr hergeben!«
»So mögen meine Brüder noch eine Weile verziehen.«
Otomak entfernte sich, kam aber bald wieder mit zwei zahmen Äffchen, die den Araguato an Schönheit bedeutend übertrafen und ganz eigenartig aussahen.
»Das hier ist ein Macahavu,« sagte der Häuptling, auf das eine Äffchen weisend, das einen glänzenden, schönen schwarzen Pelz besaß. Über das Gesicht ging ein weißer, ins Bläuliche spielender Fleck, der nicht anders als eine Larve aussah — eine venezianische Seidenhalbmaske, die Augen, Nase und Mund bedeckte. Die Ohren mit umgebogenem Rand waren kahl und klein.
»Viudita!« rief Matatoa beim Anblick dieses merkwürdigen Geschöpfes aus.
»Simia lugens!« sagte seinerseits Schulze lakonisch.
Dieser lateinische Name in Verbindung mit dem spanischen fiel Friedrich auf. »Viudita,« sagte er, »viudita — lugens? Warum nennt ihr das hübsche Tier eine trauernde Witwe?«
»Da seht doch,« erwiderte Matatoa, »über das Gesicht trägt der Macahavu einen Schleier, vorn am Halse ein weißes Halsband, und die Vorderhände sind am Rücken weiß, während sie an der Innenfläche glänzend schwarz sind wie die Hinterhände auf beiden Seiten. Also! Schleier, weiße Halsbinde, weiße Handschuhe — genau wie eine trauernde Witwe!«
Das sanfte, schüchterne Aussehen des Tieres, das übrigens sehr lebhaft sein kann und den Vögeln mit katzenartiger Wut nachstellt, gewann ihm alsbald die Herzen der Deutschen.
Nun wies Otomak auf den zweiten Affen: »Bititeni!« sagte er.
»Titi,« echote Unkas.
»Simia sciurea,« erläuterte der Mann der Wissenschaft.
Dieses Äffchen mit dem weißen Gesicht und einem blauschwarzen Fleck über Mund und Nase war äußerst zierlich gebaut und hatte einen prächtigen goldgelben Pelz. Es gefiel noch mehr als der Macahavu; denn sein Gesicht glich auffallend dem Antlitz eines Kindes mit dem Ausdruck der Unschuld und einem schalkhaften Lächeln.
Otomak sah mit Vergnügen, welche Freude besonders Ulrich und Friedrich an den reizenden Tieren hatten. »Mögen meine Brüder sie annehmen als ein Andenken an Otomak, dessen Seele sie auf ihrer Reise begleitet. Der Macahavu meidet sonst die Gesellschaft anderer Affen und flieht namentlich vor dem Bititeni; dieser ist aber so zahm, daß er ganz vergnügt mit dem Kameraden, mit dem er gleichzeitig aufgezogen wurde, umhertrollt, und ihr werdet sehen, er wird sich auch mit eurem Araguato gut vertragen.«
Mit dieser Voraussage hatte Otomak vollkommen recht; denn noch im Laufe des Tages schlossen die drei so verschiedenen Affen die innigste Freundschaft.
Nun verabschiedeten sich die Reisenden mit lebhaftem Dank und Versicherungen eines guten Andenkens von Otomak und den übrigen Guahibo, die ihnen noch halfen den Suapure übersetzen.
Die Brandwunden an ihren Füßen schmerzten sie, dank den ausgezeichneten Heilkräutern, kaum mehr; dennoch waren sie froh, daß sie nicht zu Fuß gehen mußten, sondern gute Reittiere besaßen.
Unkas erzählte unterwegs, wie sich die Indianer in den Besitz der jungen Affen setzen, die sie zum Verkauf zähmen. Es geschieht dies auf grausame Weise. Die Saïmiri, wie die Titi vom Orinoko auch genannt werden, sind äußerst empfindlich gegen Nässe und Kälte. Sobald es regnet, verschränken sie Arme und Beine und legen den langen Schwanz um den Hals, wobei sie sich eng aneinanderpressen, um sich gegenseitig zu erwärmen. Die Indianer schießen nun ihre giftigen Pfeile in einen solchen Knäuel; alsbald fallen die verwundeten Tiere herab, wobei sich die Jungen fest an die Mutter klammern. Da die Kleinen auch von der sterbenden und toten Mutter nicht weichen, sind sie leicht zu fangen.
Aus ziemlicher Höhe sah man nun in das Bett des Orinoko hinab, das mit glatten, schwarzen, meist rundlichen Granitblöcken erfüllt war. Brausend zischte der Strom hinauf und vorbei an diesen größeren und kleineren Hindernissen, die wie geglättete Lava oder schwarzer Marmor aussahen. Der weiße Gischt bildete einen malerischen Gegensatz zu den kohlschwarzen Klippen. Man nennt diese Stromschnellen, die Tausende von kleinen Wasserfällen bilden, »Los Remolinos«.
Noch wilder und großartiger sah der Raudal de Marimara aus: hier laufen die Blöcke wie die Pfeiler einer Riesenbrücke fast über die ganze Breite des Stromes weg, und eine Granitsäule von hundert Metern im Umfang ragt vierundzwanzig Meter hoch empor; dies ist die Piedra de Marimara, unter der das Wasser wie siedend heraufschießt.
Infolge dieser Einengungen tritt der Fluß oft tief ins Land hinein über die Ufer und bildet weite Buchten in den Felsen.
Neben der Großartigkeit dieser Landschaftsbilder, die durch das donnernde Getöse des Stromes noch erhöht wurde, waren es die neuen Reisegefährten, die hübschen Affen, die unseren Freunden unaufhörlich Unterhaltung boten. Die »Witwe in Trauer«, der Friedrich wegen ihrer venezianischen Maske den prunkvollen Namen »Dogaressa« beilegte, konnte stundenlang regungslos dasitzen, als ob sie schliefe; ihre lebhaften Augen verrieten jedoch, mit welcher Aufmerksamkeit sie alle Vorgänge um sich her verfolgte. Einigemal, wenn sie einen kleinen Vogel erblickte, erhaschte sie blitzschnell einen überhängenden Zweig und kletterte mit unglaublicher Behendigkeit empor. Meist wurde dann auch der arme Sänger ihre Beute, die sie kalten Herzens erwürgte. Diese Mordtaten trugen aber der Dogaressa stets eine tüchtige Tracht Prügel von Ulrichs erbarmungsloser Hand ein, so daß das gescheite Tier bald von seiner üblen Gewohnheit abließ.
Der Titi, den Friedrich wegen seiner Ähnlichkeit mit einem Kinde »Bambino« nannte, zeigte ein äußerst zartes Gemüt; wie ein Kind konnte er in einem Augenblick von der größten Lustigkeit zur tiefsten Niedergeschlagenheit übergehen, und umgekehrt. Und was das rührendste war, sobald ihn etwas in Angst oder Betrübnis versetzte, füllten sich seine großen Augen mit echten Tränen!
Er erwies sich bald als das klügste der drei Tiere. Insekten, besonders Spinnen, waren seine Lieblingsspeise, und dank seiner Findigkeit im Aufspüren solchen Ungeziefers in all seinen Schlupfwinkeln wurden die Reisenden nie mehr von Skorpionen oder Tausendfüßlern überrascht.
Heute legten sie nur eine kurze Strecke Weges zurück, da sie erst spät am Tage das Indianerlager verlassen hatten. Es dämmerte schon, als sie den Hafen von Carichana erreichten, eine wildromantische Gegend; das hohe Felsenufer warf seine Schatten über den Orinoko, dessen Gewässer tiefschwarz erschienen.
Carichana selber, wiederum eine verlassene Mission, war, der Überschwemmungen wegen, ziemlich weit vom Ufer weg angelegt worden. Das Tal von Carichana ist von ausnehmender Naturschönheit. Schon einigemal waren die Reisenden durch grasbewachsene Ebenen geritten, die sich streifenförmig zwischen die Bergketten einschieben, die von Encaramada bis Maypures senkrecht gegen den Strom auslaufen. Immer waren ihnen diese urwaldumsäumten Wiesentäler nach der Großartigkeit des Urwalds oder der Felsenlandschaften besonders lieblich erschienen.
Die Ebene von Carichana aber wies eine Eigentümlichkeit auf, die sonst nur in der Mongolei zu finden ist: in der weiten Wiesenfläche zeigten sich gewaltige Felsplatten oder -bänke, die oft an die dreihundert Meter im Umkreis messen mochten und sich nur wenig über die umgebende Grasflur erhoben. In der Dämmerung konnte man diese kahlen Tafeln für Seen halten.
Ulrich und Friedrich machten sich das Vergnügen, auf einer dieser schönen Reitbahnen umherzutraben. Die Gefährten folgten ihnen.
»Da würde ich ein Idealdorf hinbauen!« rief Friedrich lustig aus. »Alle Häuser aus Felsen gegründet und die Straßen von Natur gepflastert, wie asphaltiert, so glatt, und ohne Unterhaltungskosten auf Jahrhunderte hinaus stets im besten Stand!«
Wirklich anheimelnd erschien diese liebliche Gegend. In weiter Ferne waren die dämmernden Wiesen vom Urwald umsäumt, und der Horizont war auf allen Seiten von Gebirgszügen umgrenzt, die, teils bewaldet, einen düsteren Anblick boten, teils kahle Felsengipfel aufwiesen, die noch im Goldglanz der untergegangenen Sonne rosig erglühten.
Nirgends hatten unsere Freunde bis jetzt einen Fleck Erde gefunden, der sie so zum Verweilen und zum Gründen einer Niederlassung gelockt hätte wie dieser; doch die zunehmende Dunkelheit mahnte sie, ans Nachtlager zu denken. Sie begnügten sich mit kalter Küche zum Abendessen, da sie kein Holz zur Feuerung fanden. Gefahren drohten ihnen hier auch kaum, weshalb sie sich ohne den Schutz eines Feuers am Boden die Schlafstätten bereiteten.
DIE Indianer waren wie gewöhnlich morgens zuerst auf den Beinen und fingen die Maultiere wieder ein, die sich nachts ziemlich weit vom Lager entfernten, wenn sie nicht, wie es im Walde stets aus Vorsorge geschah, in der Nähe der Feuer festgebunden waren. Dann weckten die Burschen ihre weißen Herren und machten sie auf ein neues Schauspiel aufmerksam: ganz in der Nähe weidete ein Rudel stattlicher Pampahirsche, deren Geweih nicht mehr als drei Zinken aufwies, und nicht weit davon ästen einige Sumpfhirsche, die, einen Meter hoch und zwei Meter lang, die größten aller südamerikanischen Hirsche sind. Es waren meist Sechs- und Achtender.
Der Morgen graute noch kaum; sonst hätten sich diese Tiere, die ein Nachtleben führen, nicht mehr blicken lassen.
Schulze wollte sofort auf die Hirschjagd, aber Friedrich bat, die hübschen, harmlosen Tiere nicht unnötig zu »erschrecken«, und der Gelehrte ergab sich drein, denn er hatte wenig Hoffnung, sich den scheuen Tieren unbemerkt so weit nähern zu können, als es ihm notwendig erschien, um einen Schuß aus seiner »nie fehlenden« Büchse zu wagen.
Nach einem kurzen Morgenimbiß ging es wieder dem Walde zu. Dieser zeigte sich viel weniger dicht als alle bisher durchquerten Waldungen: sonst war es fast nur in der Nähe der Flußufer möglich, im Urwald rasch vorwärts zu kommen. Hier aber hinderte kein undurchdringliches Dickicht den Weitermarsch, auch wenn man sich weiter vom Ufer entfernte.
Bei Sonnenaufgang hatte die kleine Karawane bereits eine ziemliche Strecke zurückgelegt und lagerte sich auf einem kahlen Felsen am Ufer des Stromes.
»Horch!« rief plötzlich Friedrich. »Das klingt ja wie die Töne einer entfernten Orgel aus dem Innern der Erde herauf!«
Ulrich lachte. »Wer die Glocken von Atlantis vom Meeresgrunde herauf vernimmt, der mag auch von unterirdischen Orgeln träumen!«
»Nein, nein! diesmal ist es keine Phantasie; sei einmal ganz still! Da! — hörst du's?«
In der Tat vernahm nun auch Ulrich die Orgelklänge, die ganz deutlich wurden, wenn man das Ohr unmittelbar an den Felsboden legte.
»Was ist denn das?!« wandte sich Schulze fragend an die Indianer.
»Das sind Musikfelsen, Hexenwerk!« erwiderte Matatoa.
»Da sieht man wieder euch ungebildete Natursöhne!« schalt der Professor ärgerlich. »Wenn ihr etwas nicht begreift, seid ihr gleich damit fertig: da heißt es einfach ›Hexenwerk, Teufelsspuk!‹ und damit gebt ihr euch zufrieden. Es fehlt euch durchaus an wissenschaftlichem Sinn und Interesse. Ich will euch die Sache wissenschaftlich erklären, wie ich sie mir im Augenblick zurechtlege. Ihr versteht es freilich doch nicht, aber meine jungen Freunde werden es sofort begreifen. Wir haben es hier offenbar mit einer Naturmerkwürdigkeit zu tun wie bei der ägyptischen Memnonsäule: Seht, diese Felsplatte ist voll tiefer schmaler Öffnungen; durch den außerordentlichen Temperaturunterschied, der erzeugt wird, wenn sich der Felsen unter den Strahlen der aufgehenden Sonne erwärmt, entsteht ein gewaltiger Luftzug in diesen Löchern, und die dehnbaren Glimmerplättchen, die in den Felsspalten von der ausströmenden Luft in zitternde Bewegung versetzt werden, geben zitternde Klänge von sich, während die Löcher selber je nach ihrer Tiefe und Weite die verschiedensten orgelartigen Töne hervorbringen; das ist also eine eigentliche Naturorgel, die bei Sonnenaufgang ihren Morgenchoral hören läßt.«
Noch lange lauschten sie den geheimnisvollen Klängen, bis diese mit der zunehmenden Erwärmung des Felsens allmählich erstarben.
Obgleich sich Schulze, dessen Hand so ziemlich geheilt war, ermattet und fiebrig fühlte, drängte er nun doch zum Aufbruch, damit sie nicht in die Mittagshitze hineinkämen.
Es ging nun vielfach zwischen gewaltigen, schwarzen Granitblöcken von allen möglichen Formen hindurch. Die bleiglänzenden Klippen, die sich an dieser Stelle auch im Strombette häuften, ragten hoch aus dem Erdboden empor. Sie waren meist völlig glatt geschliffen; offenbar hatte die Strömung des Orinoko, die früher einen mehrfach breiteren Raum eingenommen haben mußte als zurzeit, diese leuchtende Glätte, vielleicht vor Jahrhunderten, hervorgezaubert. Heute noch vollzog sie mitten in ihrem Lauf eine ähnliche Arbeit an den schwarzen Riesenfelsen, an denen sie laut tosend vorbeischoß.
»Es läßt sich denken,« bemerkte Schulze, in die kochenden Strudel und brausenden Wasserfälle hinabblickend, »wie außerordentlich schwierig es ist, zu Schiff diese Stromschnellen zu überwinden; ich zweifle nicht daran, daß wir hier am Ufer in einer Stunde einen Weg zurücklegen, zu dem eine gutbemannte Pirogue fünf bis zehn Stunden brauchte! Wir befinden uns hier am Raudal de Cariben, den Stromschnellen von Cariben, die ganz besonders hinderlich für die Flußfahrt sind.«
»Ah!« rief Friedrich aus. »Dort seht hin! Sollte man nicht meinen, da stünde eine ganze Reihe zerfallener Burgen und Schlösser, die mit ihren Ruinen, Mauern und Türmen die Zinnen schroffer Felswände krönen?«
Ja, das war ein romantischer Anblick: sowohl an den Ufern als im Flusse selber erhoben sich in der Ferne mächtige Massen aufeinandergetürmter Granitblöcke, teils wie zyklopische Mauern, teils wie Dolomiten, auf denen zackige Ruinenformen sich gegen den leuchtenden Himmel abhoben.
Beim Näherkommen gewannen die gewaltigen Gebilde noch an Zauber und Mannigfaltigkeit; da sah man Säulen mit schön abgerundeten Felskugeln auf der Spitze; daneben erschienen zierliche gotische Fensterbogen, dann wieder kuppelförmige kahle Steine mit glattgeschliffenen Wänden.
Im Süden ragten hoch aus dem Wald empor drei völlig vereinzelte gewaltige Felsriesen: alles machte den Eindruck, als sei hier eine herkulische Kraft tätig gewesen, die sich im Schaffen der mannigfaltigsten Kunstwerke gefallen habe, und doch waren es zufällige Gebilde einer jungfräulichen Natur!
Diese Felsbildungen sind das Wahrzeichen des Zusammenflusses zweier mächtiger Ströme; denn bald befanden sich unsere Freunde an der Stätte der früheren Jesuitenmission Santa Teresa, gegenüber der Mündung des Rio Meta, des bedeutendsten Nebenflusses des Orinoko.
Angesichts der überwältigenden Großartigkeit dieser Landschaft lagerten sich die entzückten Reisenden zur Mittagsrast.
»Dies ist die Piedra de Paciencia, der Felsen der Geduld!« erklärte Schulze, auf einen mächtigen Felsblock mitten im Strome zeigend. »Man nennt ihn so, weil die Piroguen, die den Orinoko hinauffahren, oft zwei Tage und noch mehr brauchen, um aus den Strudeln zu kommen, die diesen Stein umkreisen.«
Der Wald am jenseitigen Ufer gewann ein freundlich lachendes Aussehen durch die vielen goldgelben Blüten, die sich aus dem dunkeln Grün der Baumkronen vordrängten; der Fluß selber zeigte sich voller Leben: besonders unterhaltend war es, den silberglänzenden langschnäbeligen Delphinen zuzusehen, die fortwährend sprungweise aus den Fluten auftauchten. Zuerst erblickte man den Kopf, dann den bläulichen Rücken, oft auch den im Sonnenglanz schillernden hellen Bauch, und zuletzt erhob sich der schöngeformte Schwanz hoch in die Luft, während schon der Kopf wieder im Wasser verschwunden war.
»Das sind liebenswürdige Geschöpfe,« meinte Ulrich. »Sie führen offenbar ihre anmutigen Kunststücke eigens zu unserer Unterhaltung vor!«
»Gewiß! Die reinste Künstlervorstellung!« bestätigte Schulze.
Am Ufer marschierten gemessenen Schrittes die bunten Reiher und die »Garzones Soldatos« umher, und hier und da sah man den Rücken eines Krokodils, das bewegungslos wie ein Baumstamm auf dem Wasser dahintrieb.
»Nichts ist merkwürdiger,« bemerkte Schulze, »als die wilde Einsamkeit dieser Gegend. Wir befinden uns an einer Stelle, die an handelspolitischer Bedeutung vielleicht die großartigste der ganzen Welt ist: die Quellen des Meta liegen südlich von Santa Fe de Bogota ganz in der Nähe der Quellen des Magdalenenstromes, und der Fluß ist beinahe bis dorthin schiffbar: auch die Quellen des Guaviare, des südlichsten großen Zuflusses des Orinoko, liegen ganz nahe, und wenn wir bedenken, daß andererseits der Cassiquiare den Orinoko durch den Rio Negro mit dem Amazonas verbindet, mit der bedeutendsten Wasserstraße unseres Planeten, so sehen wir hier einen Punkt, der ein Gebiet erschließt, das an Ausdehnung weit unseren europäischen Weltteil übertrifft. Und welche Fülle der wichtigsten Handelswaren könnten diese gewaltigen Landstrecken liefern: das Andengebirge, die weiten Llanos des Meta und Guaviare, der Urwald — alles wird durch diese Wasserwege zugänglich gemacht; da bedarf es keiner Kanäle und Eisenbahnen, die Natur selbst hat das Land für die großartigste Kultur, für den unbeschränktesten Handel vorbereitet.
»Und nun? Nicht einmal ein Dörflein steht an dieser einzigartigen Stelle, ja, den Mündungen des Orinoko und des Amazonenstromes selber fehlt es an bedeutenden Handelstädten! Sollte man es glauben, daß diese von der Natur wie keine anderen bevorzugten Gebiete vor mehreren Jahrhunderten entdeckt wurden und noch beinahe so brach liegen wie nach den ersten Jahrzehnten ihrer Entdeckung?«
»Ja, das ist wirklich unglaublich,« stimmte Ulrich bei, »namentlich wenn man bedenkt, wie in den Vereinigten Staaten die Großstädte wie Pilze aus dem Boden schossen, wo sich nur irgendeine besonders günstige geographische Lage vorfand.«
»Und dabei,« fügte Friedrich hinzu, »mußte die Besiedlung in Nordamerika mit ungleich größeren Schwierigkeiten kämpfen, als sie ihr hier drohen: wie sanft sind doch die Indianer des Südens im Vergleich zu den grausam-listigen Skalpjägern, mit denen es die Bahnbrecher der Kultur in den Urwäldern und Prärien der Neuen Welt im Norden zu tun hatten.«
»Sie werden sehen,« nahm Schulze wieder das Wort, »die Zeit wird nicht mehr fern sein, wo die auswanderungslustige Menschheit sich diesem wahrhaften Dorado zuwendet; vielleicht breitet sich schon in wenigen Jahrzehnten dort drüben am Meta- und Orinokoufer eine Millionenstadt aus, und die glücklichen Ansiedler werden zu Reichtümern gelangen, wie sie Nordamerika niemals in solcher Fülle und in so kurzer Zeit seinen Pflanzern bot.«
»Und was für großartige Entdeckungen und Funde stehen der Menschheit noch bevor,« bemerkte Friedrich begeistert, »wenn durch die immer weiter in die Urwälder vordringenden Ansiedlungen all die geheimnisvollen Wildnisse erforscht werden, die keines Weißen Fuß bis jetzt betreten hat!«
»Wie viele plagen sich in der Heimat ab, ein glückloses Leben hindurch, die hier alles in Hülle und Fülle haben könnten, wenn sie nur auf dies Paradies aufmerksam gemacht würden oder so viel Mut und Verstand besäßen, einmal den Anfang mit der Bewirtschaftung dieser üppigen und reizvollen Landstriche zu machen!« sagte Schulze nachdenklich.
»Weißt du was, Ulrich?« rief Friedrich, ganz Feuer und Flamme. »Wir führen es aus! Wir kehren nach Deutschland zurück und erlassen einen Aufruf an alle die Armen und Elenden, die es mit uns wagen wollen; dann kaufen wir hier die weite Einöde und gründen Städte und Dörfer nach Herzenslust. Den neuen Ansiedlungen geben wir eine treffliche Verfassung, so daß in kurzer Zeit hier ein kleines Paradies auf Erden entstehen soll!«
»Wenn nur das böse Fieber nicht wäre!« klagte der Professor, der sich immer unwohler fühlte.
Ein Ruf Unkas' riß die Deutschen aus ihren Betrachtungen: in der Nähe ergoß sich ein Flüßchen in den Orinoko; seine flachen Ufer waren ziemlich sumpfig und von einigen Pfützen oder Lagunen gesäumt. In einer dieser Wasserlachen wälzte sich ein plumpes Tier, das einem jungen Nilpferd glich, jedoch mit dem Kopf eines Schweines und einem in einen Rüssel auslaufenden Oberkiefer.
»Das ist ein Tapir!« rief Schulze lebhaft und griff als unverbesserlicher Jäger schon wieder zum Gewehr.
Der Tapir aber schien aufmerksam geworden zu sein; er verließ seinen Tümpel und trottete dem Strome zu. Es machte einen so komischen Eindruck, wie er den wunderlich geformten Kopf beinahe zwischen die Vorderbeine klemmte, daß Ulrich und Friedrich unwillkürlich lachen mußten und der Professor in ihre Heiterkeit einstimmte, obgleich es ihn verdroß, daß ihm die Jagdbeute wieder entging.
Der Tapir aber plumpste in das hochaufspritzende Wasser und ließ sich nicht mehr blicken.
Nun ging die Reise weiter; der Orinoko zeigte eine Zeitlang eine breitere, klippenfreie Wassermasse; dann verengte er sich wieder am Raudal de Tabaje, durch den er sich mit lautem Getöse in mächtigen Fällen hindurchzwängte.
Hier war wiederum eine verlassene Mission, San Borja: diese war zweimal gegründet worden, zuerst von den Jesuiten, dann von den Franziskanern. Aber sie hatte beide Male nur kurzen Bestand. Die freiheitliebenden Guahibo fürchteten zu sehr die Sklaverei und entliefen wieder in ihre Wälder; denn die Guahibo lassen sich am schwersten seßhaft machen und das Joch der Knechtsarbeit auflegen: sie nähren sich lieber von faulen Fischen, Tausendfüßlern und Würmern, als daß sie sich entschlössen, das Land zu bebauen. Daher geht das Sprichwort unter den Indianern: »Ein Guahibo ißt alles auf der Erde und unter der Erde.« Ja, noch mehr, sie essen sogar die Erde selbst, nämlich eine besondere Lehmart, die sie für einen Leckerbissen halten.
Da Schulze bald über heftiges Fieber und große Mattigkeit klagte, wurde noch vor Sonnenuntergang ein Platz zum Übernachten ausgesucht.
DIE lästigen Zancudo waren in dieser Gegend so zahlreich, daß außer den Indianern keiner der Ruhenden zu einem rechten Schlafe kam; zwar waren sie gegen die Folgen der Stiche unempfindlich geworden, doch die Stiche selber blieben äußerst schmerzhaft; am unangenehmsten aber war das singende Summen der blutdürstigen Insekten, das aufregend wirkte; dazu kam als neue Plage, daß die frechen Tierchen in Nase und Ohren krochen und durch das lästige Kitzeln an diesen empfindlichen Stellen stets wieder ein jähes Aufschrecken aus dem Halbschlummer bewirkten.
So waren alle froh, als es endlich tagte: denn die Zancudo verschwinden, sobald es hell wird.
Als nach dem Morgenimbiß die Weiterreise angetreten wurde, zeigte es sich, daß sich Schulze, von Fieberfrost geschüttelt, kaum noch im Sattel zu halten vermochte. Er bestand aber auf dem Aufbruch; denn er wußte aus seinen Büchern, daß sie sich hierin einer besonders gesundheitsgefährlichen Gegend befanden, und hoffte, wenn sie rasch aus ihr hinauskämen, werde sein Leiden schon von selber besser werden.
Merkwürdigerweise nahm die drückende Hitze ab, je weiter die Reise nach Süden ging; die Landschaft wurde immer großartiger und malerischer.
Zwischen dem Rio Paragueni und dem Anavoni beobachteten unsere Freunde ein ganz eigenartiges Schauspiel. Es standen da in der Ebene einige mächtige Termitenhügel. An einem derselben stand ein sonderbares Tier beschäftigt, in dem sie leicht den Yurumy oder Mähnenameisenbären errieten. Das langhaarige Geschöpf maß etwa ein halbes Meter in der Höhe und anderthalb Meter in der Länge, ohne den Schwanz, der noch fast ein Meter lang war. Sein borstiges Haar war eigentümlich gefärbt; es besaß eine schwarzbraune und weißliche Schattierung und raschelte wie dürres Stroh; auf dem Rücken und an den Beinen, namentlich aber auch am Schwanz war es besonders lang, so daß es wie eine Mähne herabfiel. Den Schweif trug das Tier wie einen Palmwedel hoch über den Rücken gebogen. Die röhrenförmige Schnauze glich einem Rüssel und verlieh dem schon sonst ganz eigentümlichen Säugetier ein völlig seltsames Aussehen. An den Füßen hatte es mächtige nach innen gebogene Grabklauen, und auf diesen lief es, und nicht etwa auf der breiten Fußsohle.
Der Ameisenbär richtete sich an dem Termitenhügel auf und rüttelte an dem steinharten Bau; dann begann er ihn mit seinen Krallen aufzureißen, was ihm trotz der Festigkeit der Masse leicht gelang. Sobald einige Gänge bloßgelegt waren und die weißen Ameisen in Mengen sichtbar wurden, streckte er seine Zunge mitten hinein. Diese Zunge glich einem langen Wurme und sah widerlich genug aus; da sie mit einem klebrigen Speichel bedeckt ist, blieben die Ameisen an ihr hängen, und er zog eine ganze Ladung in die spitzige Schnauze ein, um sofort wieder eine neue zu holen; das ging wie bei einer Maschine.
Mit seinen wuchtigen Tatzen wehrt sich der muskelstarke Yurumy mit Erfolg gegen den Jaguar, und wenn er gereizt wird, geht er auch aufrecht auf den Menschen los und sucht ihn wie der echte Bär in seiner eisernen Umarmung zu erwürgen.
Zu anderer Zeit hätte Schulze das merkwürdige Tier mit größter Aufmerksamkeit beobachtet, wohl auch eine Kugel darauf abgegeben: aber das Fieber machte ihn so schwindelig, daß er ganz teilnahmlos schien.
Als nach Durchquerung des Anavoni der Urwald wieder erreicht wurde, erklärte der kranke Naturforscher, nicht mehr weiter zu können, und man sah es ihm an, daß er der Rast bedurfte, denn sein Kopf glühte förmlich vor Fieber, während der Frost seinen Leib schüttelte.
Am Fuße eines zerklüfteten Felsens, der sich aus dem Urwald erhob, bereiteten Ulrich und Friedrich dem Kranken ein weiches Lager aus dürren Blättern und Gras; dann holten sie aus einem nahen Bache Wasser herbei, sowohl um den Durst des Fiebernden zu stillen, als auch um durch nasse Umschläge seine Stirn zu kühlen. Hierauf beratschlagten sie, was weiter zu tun sei.
»Matatoa wird den Fieberbaum suchen,« sagte der Indianer, »dann wird der Sennor bald gesund sein.«
»Wenn der Chinabaum hier zu finden ist,« rief Ulrich hoffnungsfroh, »dann allerdings haben wir ein treffliches Heilmittel für den armen Kranken!«
Schon war Matatoa auf der Suche, und Unkas erklärte, seinerseits auch in anderer Richtung nach dem unschätzbaren Gewächse forschen zu wollen, das in dieser Gegend noch nicht so häufig anzutreffen sei. Ulrich begleitete ihn, da er doch nichts weiter für Schulze tun konnte, bei dem Friedrich zur Pflege zurückblieb.
Beinahe eine Stunde war Ulrich mit Unkas im dichten Urwald die Kreuz und Quer gewandert, ohne daß sie eine Cinchone entdeckt hätten. Unkas war vorsichtig genug, sich stets die Richtung zu merken, in der sie gingen, um später wieder zum Fluß zurückzufinden. Übrigens brauchten sie bei einiger Aufmerksamkeit ein gefährliches Verirren nicht zu befürchten, da sie im Norden den Anavoni und im Westen den Orinoko wußten und nach dem Stande der Sonne, der sich freilich im Walde nur schwer erkennen ließ, die Lage der Himmelsgegenden annähernd zu beurteilen vermochten.
Plötzlich stieß Unkas einen Freudenruf aus: er stand vor einem Baume still, den man vor lauter Schlingpflanzen, die ihn umwucherten, kaum erkennen konnte. Der Baum war etwa fünfundzwanzig Meter hoch, und seine grüne Krone bestand aus glänzenden lanzettförmigen Blättern, durch deren tiefdunkles Grün rosarote Blütenrispen wie bengalische Flammen hindurchglühten. Daneben aber glänzte eine bunte Pracht von Blüten der verschiedenen Lianen, die am Baume emporgeklettert waren: da waren rosenförmige Purpurblüten, prächtige herabhängende rote Klematisglocken, dichte gelbe Blütenbüschel der Verbesina arborea und große, weitgeöffnete gelbe, weiße und brennendrote Kelche verschiedener Passifloren; dazwischen die zarten Ranken der Kapuzinerkresse mit ihren orangefarbenen gespornten Blüten. Das alles blühte und leuchtete durcheinander und strömte einen fast betäubenden Duft von entzückendem Wohlgeruche aus.
Ulrich sagte sich, daß er in diesem Riesenblumenstrauß niemals hätte erkennen können, was zum eigentlichen Baume gehörte und was zu seinen Parasiten; aber Unkas klärte ihn auf.
»Unkas weiß, daß der Fieberbaum besonders viele Pflanzen beherbergt; er kleidet sich in fremden Schmuck, und doch ist sein eigener der schönste; Unkas riecht auch den Wohlgeruch seiner Blüten aus allen anderen Düften heraus, denn er ist der stärkste und süßeste; aber der Stamm soll uns Gewißheit geben, daß wir den echten Fieberbaum gefunden haben.«
Damit streifte Unkas die zahlreichen Ranken zur Seite, die den umfangreichen Stamm völlig verhüllten; aber auch dann mußte er erst einen dichten Moospelz abkratzen, ehe die silberne Rinde des Chinabaumes zum Vorschein kam.
»Das ist die Rinde!« sagte er bestimmt. »Es ist der echte!« Dann schälte er ein großes Stück Rinde ab, kaute etwas davon, nickte beifällig mit dem Kopf, als er den eigenartigen Geschmack der Fieberrinde erkannte, und schlug sofort den Rückweg ein, den er denn auch mit merkwürdiger Sicherheit fand.
Matatoa war auch eben erst von seiner Streife zurückgekehrt und hielt Unkas ein großes Stück Rinde entgegen. Unkas betrachtete diese kopfschüttelnd, kaute dann daran und rief triumphierend aus:
»Matatoa ist ein Rind, Matatoa ist ein Esel, Matatoa ist ein Schwachhirn: er kann den falschen Chinabaum nicht vom echten unterscheiden! Seine Rinde ist gut zum Verbrennen, aber nicht gegen das Fieber.«
»Unkas ist ein freches Zancudo, er macht viel Lärm und sticht mit der Zunge, aber er versteht nicht mehr als eine Seekuh!« erwiderte der beleidigte Matatoa.
Ulrich und Friedrich mußten staunen und lachen, als sie den Sprachschatz an spanischen Kosenamen aus der Tierwelt vernahmen, über den die Indianer verfügten: das war gewiß ein eigenartiger, aber unstreitbarer Beweis ihrer höheren Bildung!
Unkas kannte die besonderen Merkmale des Fieberbaumes so gut, daß er dem kleinlaut werdenden Matatoa klar nachweisen konnte, daß er sich durch eine äußere Ähnlichkeit hatte täuschen lassen und seine Rinde einem Baum verdankte, der wohl einer der siebzig Arten von Chinabäumen angehörte, aber eben einer der vielen, die keine Heilkraft besitzen.
Die Nacht brach schon herein; Friedrich hatte während der Abwesenheit der andern viel dürres Holz herbeigetragen und aufgeschichtet, so daß die Feuer sofort entzündet werden konnten.
Während Ulrich und Matatoa das Abendessen bereiteten, sah Friedrich Unkas zu, der eine Abkochung aus Chinarinde braute. Sobald diese fertiggestellt und etwas abgekühlt war, wurde dem lechzenden Schulze davon eine Schale voll eingeflößt.
Nach beendetem Mahle saßen unsere Freunde noch eine Weile plaudernd und rauchend mit den Indianern zusammen, während der Kranke im Halbschlafe stöhnte. Unkas erzählte viel von wunderbaren Wirkungen der Fieberrinde, und wie ein dankbares Indianermädchen einem Spanier in Lima das Geheimnis des Heilkrautes verraten habe: sonst wären die grausamen Eroberer Perus sämtlich den tückischen Fiebern erlegen, wie sie es nicht anders verdienten; denn die Eingeborenen hatten das Mittel sorgfältig vor ihnen geheimgehalten.
Friedrich bettete sich in Schulzes nächster Nähe, um ihm sofort Hilfe leisten zu können, wenn er seiner bedürfe. Zuvor flößte er ihm aber noch etwas Chinatee ein.
Matatoa sollte wachen und später von Unkas abgelöst werden; als aber alles schlief, überließ sich auch der Indianer dem Schlummer; denn er hielt die Vorsicht für höchst überflüssig, da doch die Feuer alle Gefahren abhalten würden.
Mitten in der Nacht wachte Friedrich an eigentümlichen Lauten auf. Die Feuer waren völlig heruntergebrannt, und im düstern Schein der erlöschenden Glut sah er Matatoas hockende Gestalt, das Haupt auf die über den Knien gekreuzten Arme gesunken, offenbar im tiefsten Schlafe. Sonst war ringsum alles in Finsternis gehüllt. Die Töne, von denen Friedrich erwacht war, kamen von Schulzes Lager her; es war ein dumpfes, gequältes Stöhnen, hie und da unterbrochen von einem erstickten Schrei, als würde dem Fiebernden ein Knebel in den Mund gepreßt und er mache verzweifelte und vergebliche Anstrengungen, laut hinauszuschreien.
Friedrich hielt dies anfangs für die Äußerung schwerer Fieberträume; doch vernahm er gleichzeitig in der Stille ringsumher, die kaum durch das ferne Gebrüll wilder Tiere unterbrochen wurde, ein gleichmäßiges dumpfes Geräusch wie den Flügelschlag eines großen Vogels.
Der Jüngling richtete sich leise auf, und wie sich seine Augen mehr und mehr an das Dunkel gewöhnten, glaubte er einen riesigen schwarzen Vogel sich über des Professors Haupt wiegen zu sehen, die weit ausgespannten Flügel langsam auf und ab bewegend.
Rasch sprang Friedrich auf und tastete nach Reisig und Holz, das er in die Glut warf. Nach kurzem Knistern schlug die Lohe hoch auf und ergriff die prasselnden Zweige. Nun konnte er beobachten, wie eine ungeheure Fledermaus über des bewußtlosen Naturforschers Kopf flatterte; ihre widerliche Schnauze mit dem scharfen Gebiß ruhte wie küssend auf Schulzes Stirn, die großen Flügel wiegten sich fächelnd in der Luft, und der ziemlich lange Schwanz des abscheulichen Vampyrs preßte sich auf seines Opfers halbgeöffneten Mund, aus dem in Pausen das ängstliche Stöhnen drang. Ein Streifen roten Blutes sickerte über Schulzes Schläfe hinab.
Nachdem sich Friedrich von seinem ersten Abscheu erholt hatte, ergriff er einen Prügel, um den Blutsauger, den das Licht des hellaufflackernden Feuers nicht zu beunruhigen schien, zu verscheuchen. Die Fledermaus flatterte zur Seite, als er ihr einen leichten Schlag versetzte; aber das freche Tier ließ sich durchaus nicht vertreiben; es machte Miene, den Schlummernden sofort wieder anzufallen. Friedrich ließ es aber dazu nicht kommen: er benutzte den Augenblick, wo der Vampyr nicht mehr unmittelbar über des Fiebernden Haupt schwebte, um mit dem Knüttel kräftig auszuholen. Er traf denn auch die Fledermaus so wuchtig auf den Schädel, daß sie betäubt und zuckend zu Boden sank, wo er ihr vollends den Garaus machte.
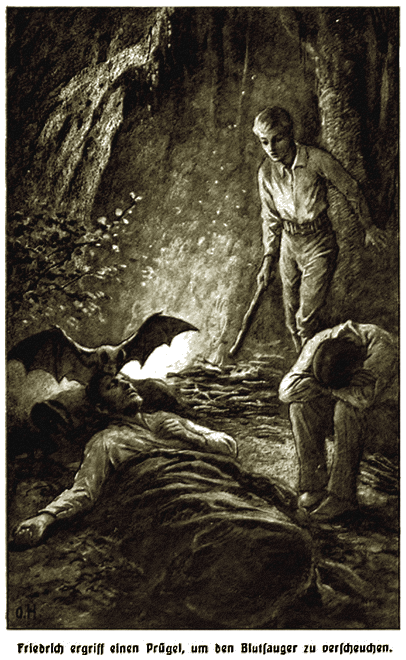
Da Friedrich wohl wußte, daß der Biß des Vampyrs, wenn er vereinzelt bleibt, nicht gefährlich ist, begnügte er sich damit, ein nasses Tuch auf die unbedeutende Stirnwunde zu legen, um das Blut zu stillen. Dann untersuchte er den erlegten Vampyr; er fand dessen lange Zunge mit Saugwarzen bedeckt, die jetzt von Blut gerötet erschienen.
Da der Morgen nicht mehr fern sein konnte, stopfte sich Friedrich eine Pfeife, um den Rest der Nacht wachend am Feuer zuzubringen. Er sah bald, daß diese Vorsicht nicht überflüssig war; denn aus einer Felsspalte flatterten kurz nacheinander nicht weniger als drei Riesenfledermäuse hervor, die Anstalt machten, ihren Blutdurst an den ahnungslosen Schläfern zu stillen.
Hierzu ließ ihnen der aufmerksame Wächter keine Zeit: er hieb mit wuchtigen Schlägen wacker auf die plumpen Geschöpfe ein, bis zwei von ihnen erlegt waren, worauf das dritte sich bewogen fühlte, die Flucht zu ergreifen, nachdem es auch einige Schläge abbekommen hatte.
Im übrigen verlief die Nacht ohne Zwischenfall. Gegen Morgen erwachten zuerst die beiden Indianer und kurz darauf Ulrich. Dieser vernahm mit Erstaunen von den Vorgängen, die sich abgespielt hatten, während er in festem Schlafe lag und nichts davon merkte. Unkas und Matatoa wunderten sich weniger über das Abenteuer selbst als über die Geschicklichkeit, die Friedrich im Erlegen der Vampyre wiederum bewiesen hatte.
ERST nach Sonnenaufgang ermunterte sich auch Schulze. Er fühlte sich ganz wohl und meinte, er sei nun völlig fieberfrei und kerngesund; als er sich jedoch aufrichten wollte, spürte er eine solche Schwäche in den Gliedmaßen, daß er alsbald wieder zurücksank.
Dennoch wollte er durchaus keinen Anlaß zu weiterem Aufenthalt geben und behauptete, er werde schon wieder reiten können, wenn er nur erst im Sattel sitze. »Ein Frühstück muß ich allerdings zuvor haben,« fügte er hinzu, »das wird mir bald auf die Beine helfen, es ist nichts als Magenschwäche!«
»Hören Sie, Herr Professor,« wandte Ulrich ein, »von Weiterreise ist heute einmal gar keine Rede, vor allem müssen Sie wieder ordentlich zu Kräften kommen; übrigens können wir alle einen Rasttag sehr wohl brauchen und haben es durchaus nicht nötig, die Reise zu überhasten.«
»Morgen ist überdies Sonntag,« fügte Friedrich hinzu, »und der Platz hier ist schön genug, um zu einem zweitägigen Aufenthalte einzuladen; wer weiß, ob wir so bald wieder eine so günstige Gelegenheit zum Lagern finden. Diesmal also wollen wir uns eine besondere Wohltat leisten und die Reize der Wildnis einmal so recht gemütlich durchkosten.«
Alle Einwände halfen Schulze nichts; auch mochte er einsehen, daß er doch noch nicht viel würde leisten können, so nahm er denn die Rücksicht seiner jungen Freunde schließlich mit Dank an, und es blieb dabei, daß der 9. und 10. November hier verbracht werden sollten.
Der Genesende verspürte, wie er sagte, einen Wolfshunger. Kein Wunder! Hatte er doch den Tag zuvor fast nichts genossen. Vor dem Frühstück aber mußte er noch eine Schale Chinatee zu sich nehmen.
»Was ist denn das für eine indianische Medizin?« erkundigte er sich mißtrauisch, als ihm der keineswegs angenehme Duft in die Nase stieg.
»Das ist der berühmte Chinaabsud,« erwiderte Friedrich, »dem auch Sie Ihre Befreiung vom Fieber verdanken.«
»So, so! Das Zeug haben Sie mir in meiner Bewußtlosigkeit eingeschüttet? Na, denn man zu! Hilft's nichts, so schadet's nichts!« Und damit goß er heldenmütig das Gebräu hinunter.
Nach dem Frühmahl, dem Schulze tüchtig zusprach, erzählte er von sonderbar quälenden Fieberträumen, die er in der Nacht gehabt habe: »Es war mir, als sei ich zwischen Schlaf und Wachen, da senkte es sich schwarz und schwer auf mich herab wie ein Alp; zugleich aber fühlte ich mich so angenehm gefächelt und gekühlt, daß ich versucht war, mich rückhaltlos dem einschmeichelnden Gefühle hinzugeben. Anderseits befiel mich eine eigentümliche Angst und ein unerklärlicher Abscheu. Ich hatte die Empfindung, als werde mir von einem teuflischen Geschöpf das Blut ausgesogen; ich wollte aufschreien, aber es stopfte mir jemand einen Knebel in den Mund, so daß ich kaum ein dumpfes Stöhnen hervorbrachte; und mitten in dem Grauen empfand ich immer wieder die merkwürdig lähmende und einschläfernde Luft, die mich zu tatkräftiger Abwehr unfähig machte.«
»Ihr Fiebertraum und Alpdruck waren Tatsachen,« sagte Friedrich lachend und holte einen der erlegten Vampyre herbei. »Sehen Sie, hier ist das satanische Geschöpf, das Ihr Blut saugte. Ich wachte von Ihrem Gestöhn auf und erlegte das Tier nebst zwei anderen, die noch nachkamen; unser indianischer Wächter war nämlich sanft entschlummert.«
»Phyllostoma spectrum!« murmelte Schulze, sich vor Abscheu schüttelnd. »Wo hat mich denn das eklige Vieh angezapft?«
»Mitten an der Stirne.«
»Wahrhaftig! Da ist eine kleine Bißwunde,« sagte der Gelehrte, an die Stirne greifend. »Übrigens kann ich mir jetzt erklären, warum mir wieder so pudelwohl ist. Der Aderlaß hat mir gut getan! Dieser Vampyr hätte keinen so grausamen Lohn verdient für seine ärztlichen Bemühungen. Wahrhaftig, unsere europäische Medizin dürfte von solch einem Naturdoktor lernen; sie tut übel daran, in ihrem Wissensstolz die Kunst ihrer Ahnen so vornehm zu verachten. Nicht umsonst standen einst die Aderlässe in so hohem Ansehen, und wenn es natürlich auch eine verhängnisvolle Übertreibung war, sie sozusagen als Allheilmittel zu betrachten, so haben sie doch Tausenden und aber Tausenden Gesundheit und Leben gerettet. Schlaganfälle kamen damals lange nicht so häufig vor wie heutzutage, und bei starkem Fieber, Blutvergiftungen, Bleichsucht und vielen anderen mehr oder minder gefährlichen Übeln könnte man mit einem Aderlaß Wunder verrichten.«
»Das mag ja sein,« erwiderte Ulrich etwas ungläubig. »Aber in Ihrem Falle scheint mir doch der Chinatee das wahre Rettungsmittel gewesen zu sein, und da haben Sie sich eher bei Unkas als bei dieser blutsaugerischen Fledermaus zu bedanken.«
»Vielleicht hat beides zusammengewirkt; jedenfalls habe ich die Empfindung, als sei die Blutabzapfung zwar etwas schwächend, aber doch äußerst wohltuend gewesen. Übrigens, mit der Chinarinde hat die medizinische Wissenschaft auch ihren Unfug getrieben.«
»Wieso?« fragte Friedrich erstaunt.
»Wieso? Weil sie, statt einfach das natürliche, bewährte Mittel, die Rindenabkochung, zu gebrauchen, wie gewöhnlich meinte, durch Ausscheidung des ›wirksamen Prinzips‹ eine Medizin, das Chinin, herstellen zu müssen. Es ist einmal Tatsache, daß derartige pflanzliche Heilmittel in ihrer natürlichen Zusammensetzung nicht bloß wirksamer, sondern zugleich unschädlicher sind als der Extrakt des Stoffes, den man — meist irrtümlich — für den einzig heilkräftigen hält. Solche ausgeschiedene Einzelstoffe besitzen oft stark schädigende, giftige Eigenschaften, die nicht durch einfache Verdünnung gehoben werden können, sondern nur durch die chemischen Verbindungen, in denen sie in der Natur auftreten. Nun setzt die Wissenschaft, in ihrer Sucht, alles künstlich darzustellen, an Stelle eines erprobt wirksamen und gefahrlosen Hausmittels eine Medizin, die selten so sicher hilft und dabei derart schädigende Nebenwirkungen verursacht, daß sie mehr gefahr- als nutzbringend erscheint.
»So wurde neuerdings erwiesen, daß das gefürchtete Schwarzwasserfieber, dem in Kamerun so viele Menschenleben zum Opfer fallen, lediglich vom übermäßigen Gebrauch des Chinin herrührt. Wahrscheinlich hätte man im gänzlich ›unwissenschaftlichen‹ Chinarindentee auch für Kamerun ein Fiebermittel, das die furchtbaren Folgen der wissenschaftlich dargestellten Arzenei nicht nach sich zöge.
»Aber so ist die Wissenschaft! Seit Jahrhunderten weiß man, daß Obstkuren, namentlich Kirschenkuren, das unfehlbarste Mittel gegen die Gicht sind. Welcher Arzt aber verordnet dieses Mittel? Erst jetzt, da man das ›wirksame Prinzip‹ gegen die Gicht aus den verschiedenen in der Kirsche enthaltenen Stoffen entdeckt zu haben glaubt, wird daraus eine Medizin hergestellt, und nun erst glaubt auch der Arzt, dieses Heilmittel verordnen zu dürfen, weil eine wissenschaftliche Begründung seiner Heilwirkung gegeben wurde. Aber ob diese Medizin so sicher und gefahrlos wirkt wie die Kirschenkur? Ganz eins, sie ist doch ein wissenschaftliches Erzeugnis und kein einfaches Heilmittel! Zum Kuckuck mit diesem Wahn! Wenn etwas hilft, was frage ich nach der wissenschaftlichen Begründung? Heilige Einfalt! Wozu, frage ich, wozu sollen wir denn die Mittel nicht in der Gestalt gebrauchen, in der die Natur sie uns bietet, wenn sie in eben dieser Zusammensetzung sich einmal als heilsam bewähren? Warum wollen wir mit Gewalt gescheiter sein und aus dem Heilmittel ein Gift machen, nur um unsere Wissenschaftlichkeit zu wahren? Eigentlich dürften wir Übergescheiten dann auch kein Brot mehr essen, sondern wir müßten das Mehl in seine Bestandteile auflösen und nur die wirklichen Nährstoffe davon verzehren. Sie werden sehen, es kommt noch so weit, daß die Wissenschaft uns unsere Nahrung in Kolben und Pulvern anpreist. Ein guter Anfang ist damit schon gemacht; bald wird man Stärke, Gummi und Albumine an Stelle des täglichen Brotes setzen; aber der menschliche Organismus ist für die Gaben der Natur und nicht für die Präparate der Chemie eingerichtet. Puh! Ich bin selber ein Mann der Wissenschaft, aber Gott bewahre mich vor solchen Verirrungen eines hypnotisierten Gehirns! Ich bitte Sie um alles, reichen Sie mir noch eine Schnitte Kassavebrot und etwas kalten Braten, damit ich die üblen Vorstellungen loswerde!«
»Oho! Herr Schulze, wie reden Sie nun?« sagte Friedrich, ihm das Gewünschte reichend. »Sie selber sind ja so sehr von Ihrer Wissenschaft eingenommen!«
»Ja, die Naturwissenschaft! Das ist was andres! Die hat immer festen Boden unter den Füßen, aber die Medizin wandelt leider oft auf dem Holzwege!«
Inzwischen begaben sich Unkas und Matatoa zu dem gestern entdeckten Chinabaum, um für alle Zufälle einen ordentlichen Vorrat der kostbaren Rinde mitzunehmen. Ulrich und Friedrich leisteten unterdessen dem Professor Gesellschaft, da sie ihm völlige Ruhe verordnet hatten und ihn vor Langerweile bewahren wollten.
Von solcher konnte übrigens keine Rede sein, denn das bunte, lustige und laute Leben des Urwaldes schien sich an dieser Stelle förmlich zu sammeln. Namentlich waren es zahlreiche Affenherden, die immer wieder, von Baum zu Baum springend, vorüberzogen. Die Wanderlust der Affen ist bekannt, und es ist keine Seltenheit, daß sich in der Nähe von Indianerhütten im Walde ab und zu ganze Banden von Affen zeigen, von denen die Indianer bekennen müssen, daß sie diese Arten noch nie gesehen haben.
Heute schien es, als ob sich sämtliche Affenfamilien des Urwaldes den Herren Europäern nach und nach vorstellen wollten. Da erschien zunächst eine schwarze Brüllaffenart mit rostfarbenen Händen. Da diese düstern Vettern Salvados nicht imstande waren, selber ihren Namen zu nennen, der ihnen überhaupt unbekannt sein dürfte, und den sie wahrscheinlich als einen wenig schmeichelhaften, von den boshaften Menschen ihnen beigelegten Spitznamen gar nicht anerkannt hätten, übernahm der gelehrte Zoologe, als lebendiges Wörterbuch, ihre Vorstellung.
»Das sind die Myceten oder Alouatta Belzebuth, die Teufelsaffen. Wenn wir die in Europa aussetzten, so würde bald mancher abergläubische Bauer darauf schwören, er habe eine Erscheinung des leibhaftigen Satans gehabt.«
Ihnen folgten einige lange, hagere Klammeraffen mit dichtem schwarzem Pelz und fast nackter Brust; ihr fleischfarbenes Gesicht war völlig haarlos, und der Schwanz außerordentlich lang und langbehaart, an der Spitze aber, die zum Anklammern dient, ebenfalls kahl.
»Ateles paniscus,« erklärte Schulze, »auch Coaita genannt: das sind die Gespenster unter den Affen, die ganz naturgemäß das Gefolge Beelzebubs bilden.«
Die dürren Gestalten sahen denn auch gespensterhaft aus. In ihrer Gesellschaft befanden sich einige Marimonda, die der Professor als Ateles Belzebuth bezeichnete, und die sich von ihren ähnlich benannten Vettern durch das violettschwarze Gesicht mit fleischfarbenen Ringen um die Augen, durch die weißbärtigen Backen, sowie durch den hellen Bauch unterschieden.
Kurz nachdem diese »Ausgeburten der Hölle« verschwunden waren, zeigten sich etliche Caparro, mit grauem wolligem Haarkleid und dickem, rundlichem Kopf; sie waren zum Teil so groß wie die Brüllaffen und Kletteraffen, das heißt bis zu sechzig Zentimeter lang. Sie erschienen auffallend kräftig und benutzten auch den Greifschwanz, um sich vorwärts zu schwingen.
»Lagothrix lagotricha« nannte der Naturforscher diese Familie, die sich durch dumpfes Geheul ankündigte.
»All diese Affen, Brüllaffen, Klammeraffen und Wollaffen, sind ein beliebtes Nahrungsmittel bei den Indianern, die sie zu Tausenden verzehren,« fügte er hinzu.
»Abscheulich!« rief Friedrich aus. »Nie könnte ich mich dazu entschließen, solch ein menschenähnliches Geschöpf zu verspeisen; ich käme mir vor wie ein Menschenfresser.«
»Das stimmt!« sagte Schulze. »Die Europäer haben alle einen natürlichen Widerwillen gegen solche Mahlzeiten, namentlich, da die Indianer die Affen nicht zerlegen, sondern an einem Stücke braten und vorlegen, so daß man ordentlich den Eindruck hat, es werde einem ein kleines Kind vorgesetzt. Die Ähnlichkeit wird natürlich dadurch erhöht, daß den armen Tieren das Fell vorher abgezogen wird. Der Hunger hat aber auch hier schon oft aus der Not eine Tugend gemacht, und Prinz Max von Wied zum Beispiel mußte sich monatelang von dem trockenen, zähen Affenfleisch nähren. — Aber sehen Sie, die Hölle hat noch mehr Insassen, die sie uns heute vorführen will. Wahrhaftig! dort kommt ein ganzes Heer von Schweifaffen, Pithecia Satanas.«
Die Satansaffen, die zu Dutzenden auf einmal erschienen, machten übrigens eher einen komischen als einen unheimlichen Eindruck. Es waren drollige Tierchen, auffallend lang behaart, so daß namentlich ihre Glieder viel dicker erschienen, als sie in Wirklichkeit waren. Ein mächtiger Bart hing ihnen von Wangen und Kinn auf die Brust herab; die nackte Gesichtshaut und der ganze Pelz waren schwarz.
Im Laufe dieses und des folgenden Tages sahen unsre Freunde noch eine Herde Weißkopfaffen, die Schulze »Pithecia leucocephala« nannte, mit einem Kranz wolliger weißer oder hellgelber Haare um das Gesicht, sonst schwarz und am Bauche rötlich schimmernd; ferner Kurzschwanzaffen oder Brachyurus melanocephalus, braun mit schwarzem Gesicht und schwärzlichen Händen, großen braunen Augen und fein geformten, menschenähnlichen Ohren.
Auch eine Bande Chrysothrix sciurea von Eichhörnchengröße ließ sich blicken; dies sind die Titi oder Totenköpfchen, deren Verwandtschaft das zahme Titiäffchen sofort erkannte. Es eilte zu ihnen hinauf, sobald es sie erblickt hatte, und verschwand in ihrer Mitte, so daß unsere Freunde schon über seinen Verlust trauerten. Um so größer war ihre Freude, als es kurz darauf wieder freiwillig zurückkehrte.
In der Dämmerung erschienen dann auch solche Affen, die mehr ein Nachtleben führen, wie der Durukuli, nach Schulze »Nyctipithecus trivirgatus«, der sich tagsüber in hohlen Bäumen verbirgt. Sein kugeliger Kopf fällt besonders durch die großen vorquellenden Augen auf; seinen Scheitel schmücken drei breite gleichlaufende Streifen, Gesicht und Hände sind behaart, der Pelz ist grau und weiß gemischt, an Brust und Bauch orangefarben. Ferner sah man die zierlichen Springaffen, Verwandte der Viudita, und viele Arten von Seiden- oder Krallaffen, mit kugeligem Kopf, plattem Gesicht, kleinen Augen und großen mit Haarbüscheln geschmückten Ohren. Ihre Finger sind mit Krallen bewaffnet, und nur die Daumen der Hinterhände sind merkwürdigerweise mit Nägeln versehen wie bei den anderen Affen; der Pelz ist seidenweich, der Schwanz buschig und länger als der ganze gedrungene Leib, aber kein Greifschwanz. Mehrere dieser Affenarten waren unseren Freunden übrigens schon früher begegnet; auch auf ihrer ferneren Reise trafen sie immer wieder auf einige dieser alten Bekannten, und selten nur wurde ihnen der Anblick einer noch unbekannten Art zuteil, wie etwa des Pinche (Midas Oedipus) mit der weißen Kopfmähne und des ergötzlichen, aber sehr reizbaren Löwenäffchens oder Leoncito (Midas leonina).
AM Abend des 9. Novembers begaben sich Ulrich und Friedrich an den Waldsaum in die Nähe des Flusses, um womöglich ein Wild zu erlegen, denn der Genesende sollte seinen Braten zum Nachtessen haben; wußten sie doch, wie viel Wert er sogar in gesunden Tagen auf ein saftiges Stück Fleisch legte.
Mehrere Krokodile, die sie erblickten, verschmähten sie, da ihnen Krokodilbraten ein zweifelhafter Genuß schien; anderes Wild aber wollte sich nicht zeigen. Die Affen, die zu ihren Häupten umhersprangen und lärmten, kamen ja für sie nicht in Betracht.
Da es noch ziemlich hell war, konnten sie übrigens hoffen, daß noch genug jagdbare Tiere zu späterer Stunde erscheinen würden; sie mußten sich nur gedulden, und das waren sie als Jäger gewohnt.
Ihre Geduld wurde jedoch auf keine lange Probe gestellt. Kaum zwanzig Schritt von ihnen schlüpfte bald ein Geschöpf aus der Erde, das einem Meerschweinchen glich, jedoch ein Meter in der Länge maß. Es war dick und mit kurzem seideglänzendem Haar bedeckt; die kahlen Ohren gespitzt, lauschte es eine Zeitlang gespannt; dann richtete es sich auf den langen Hinterläufen wie ein Hase auf und äugte mit den großen braunen Augen scheu im Kreise umher. Als es nichts Verdächtiges wahrnahm, begann es, sich ganz nach Katzenart mit den kurzen Vorderpfoten zu putzen; dann spähte es wieder eine Weile sorgsam umher und stieß endlich einen rollenden Pfiff aus. Gleich darauf erschienen noch zwei Tiere derselben Art am Ausgang der kleinen Höhle, aus der das erste geschlüpft war.
Ulrich und Friedrich gaben nun gleichzeitig Feuer, und als sich hierauf zwei der Tiere überschlugen, streckten sie unverzüglich auch das dritte mit einem zweiten Doppelschuß zu Boden. Die Flinten überwerfend eilten sie dann auf ihre Jagdbeute zu. Ihre Opfer waren ihnen völlig unbekannt, doch vermuteten sie, daß dieselben einen guten Braten abgeben würden.
Ulrich erreichte bald den Platz, wo alle drei schon verendet lagen, während Friedrich sich mit dem Fuße in eine Schlingpflanze verwickelte, und da er mitten im Laufe war, lang hinfiel, so daß sein Gewehr ein paar Schritte weit weggeschleudert wurde.
Behende richtete er sich sofort wieder auf; aber vor ihm erhob sich gleichzeitig der breite Kopf einer etwa drei Meter langen Schlange. Offenbar war Friedrich im Falle auf die Schlange geraten, und diese blies nun in höchster Wut den widerlichen, plattgedrückten Kopf auf, der einer Riesenkröte glich und mit dem dick aufgeblähten Halse zu einer Masse verschmolz.
Der bedrohte Knabe erhob abwehrend den Arm und sprang vollends auf die Füße; aber mit einer blitzschnellen Bewegung fuhr ihm das häßliche Reptil ans Handgelenk, in das es die scharfen Zähne tief einschlug.
Inzwischen hatte Ulrich sich nach dem zurückbleibenden Bruder umgesehen und zu seinem Entsetzen die hochaufgerichtete Schlange bemerkt. Rasch lief er herbei, da er von seinem Standpunkte aus nicht auf das Reptil schießen konnte, ohne gleichzeitig auch Friedrich zu treffen. Aber noch ehe er Hilfe bringen konnte, hing schon das abscheuliche Tier am Arme seines Opfers. Ohne sich zu besinnen, umklammerte Ulrich rasch den dicken Hals der Schlange mit beiden Händen und preßte ihn so fest zusammen, daß die Unholdin den Rachen weit aufriß und Friedrichs Arm fahren ließ.
Zugleich führte sie aber mit dem Leib so gewaltige Bewegungen aus, daß Ulrich bald merkte, er werde sie nicht mehr lange so festhalten können — und was dann?
Doch Friedrich riß, sobald er sich befreit fühlte, sein Jagdmesser aus dem Gürtel und bearbeitete den giftgeschwollenen Kopf der Natter mit wuchtigen Stößen. Die heftigen Windungen und Zuckungen des muskelstarken Leibes wurden immer schwächer, und so gelang es Ulrich, das verblutende Scheusal vollends zu erdrosseln, bis seine gänzliche Erschlaffung anzeigte, daß seine letzte Lebenskraft entflohen war.
»Hoffentlich ist es keine Giftschlange,« sagte Ulrich in großer Besorgnis.
Friedrich schwieg. Er verhehlte sich nicht, daß der Biß unter Umständen lebensgefährlich sein konnte, denn bereits begann sein Arm unter heftigen Schmerzen anzuschwellen.
Rasch beluden sich die Brüder mit ihrer Jagdbeute nebst der toten Schlange und eilten zum Lager zurück, das glücklicherweise nicht weit entfernt war. Dort loderten bereits die Feuer.
Als Matatoa das Wild erblickte, das die jungen Jäger herbeitrugen, stieß er einen Freudenruf aus: »Paka, Paka! Das sind Leckerbissen!« Auch Schulze erkannte das wilde Riesenkaninchen Venezuelas und freute sich bereits auf die köstlichen Mahlzeiten, die es heute und am Sonntag geben würde. Von den Venezolanern wird das Paka »Lapa« genannt.
Diese Feinschmeckerbetrachtungen unterbrach jedoch ein Schrei des Entsetzens, den Unkas ausstieß, als Friedrich nun auch die tote Schlange zu Boden gleiten ließ.
»Culebra sapa, die Krötenschlange!« rief er aus. »Die giftigste aller Schlangen! Sie hat doch keinen der jungen Herren gebissen?!«
Stumm wies Friedrich auf seinen geschwollenen Arm, den er kaum mehr zu bewegen vermochte.
»Schnell, schnell!« rief Unkas, indem er einen Feuerbrand ergriff. »Wenn wir den Guaco morado nicht finden, so ist unser guter Sennor verloren. Das Gift wirkt ungeheuer rasch.«
Und schon war er auf und davon, gefolgt von Ulrich, der, ebenfalls mit einem brennenden Scheit bewaffnet, in seiner Herzensangst ihm nachstürmte, ohne zu bedenken, daß seine Begleitung für Unkas eigentlich nutzlos war, da er keine Ahnung hatte, welcher Art das Heilmittel sei, um das es sich handelte, und wo man es finden könne. Es beseelte ihn eben der einzige Gedanke, daß rasche Hilfe not tue, und daß er nicht untätig verweilen dürfe, wo es des Bruders Leben galt.
Inzwischen griff Schulze zu seiner Reiseapotheke und entnahm ihr ein Fläschchen Salmiakgeist. Er rieb Friedrichs Wunde tüchtig mit der Flüssigkeit ein, füllte sodann einen Becher mit starkem Rum, unter den er auch etwas Salmiak mischte, und reichte ihn dem Jüngling mit den Worten: »Da, trinken Sie rasch und auf einen Zug aus! Es ist das sicherste Mittel gegen den Biß einer Giftschlange. Der Alkohol beugt einer Herzlähmung vor, und Ammoniak ist das wirksamste Gegengift. Wenn Unkas auch den Guaco finden sollte, dessen Heilkraft allerdings unbestritten ist, so dürfte er doch viel zu spät damit kommen, um Ihnen noch helfen zu können.«
Unkas drang unterdessen, von Ulrich gefolgt, immer tiefer in den Wald ein. Er jammerte in einem fort über die Erfolglosigkeit seines Suchens. Plötzlich aber rief er freudig aus: »Cobalongo!« indem er auf einen mächtigen Baum wies, dessen Stamm mindestens fünfzig Meter hoch war und von breiten brettartigen Luftwurzeln getragen wurde, die Wänden glichen. Diese Wurzeln nahmen einen Raum von etwa zwanzig Metern im Umfange ein und vereinigten sich in einer Höhe von fast sieben Metern zu dem etwa acht Meter umfassenden Stamm. Stamm und Wurzeln waren von einer Unzahl Schlingpflanzen umsponnen.
»Wenn wir hier den Bejuco del Guaco nicht finden, dann finden wir ihn überhaupt nicht,« murmelte der Indianer, mit der Fackel am Boden hinleuchtend. »Aber hier, hier! Ich wußte es ja!« Und hastig griff er nach einer auf der Erde hinkriechenden Schlingpflanze und riß eine Menge der breiten eirunden Blätter ab, die oben dunkelgrün, auf der Rückseite schön violett gefärbt waren.
Ulrich beeilte sich, auch einen Vorrat der wertvollen Blätter zu sammeln; dann aber jagten beide wieder zurück, daß Funken von ihren beinahe abgebrannten Fackeln stoben. Unkas' natürlicher Ortssinn ließ sie den kürzesten Weg finden.
Zu ihrer Freude fanden sie bei ihrer Ankunft am Lagerplatz Friedrich ganz munter.
Schulze erklärte ihn für gerettet, Unkas jedoch schüttelte den Kopf. »Er muß dennoch sterben, wenn er den Guaco nicht trinkt,« versicherte er und zerhackte einige Blätter, die er in einer Schale Rum Friedrich zu schlucken gab; hierauf rieb er noch die Wunde mit dem grünen Blattsafte ein.
Der reichliche Alkoholgenuß machte Friedrich schwindeln; kaum konnte er noch einige Bissen des herrlichen Pakabratens genießen, den Matatoa inzwischen zubereitet hatte, dann mußte er in seine Hängematte gehoben werden, die er nicht mehr selber erklettern konnte; dort verfiel er sofort in festen Schlaf.
Die anderen ließen sich das Mahl noch schmecken; dann lagerten sie, aus den Pfeifen qualmend, um das Feuer, und Schulze lobte immer und immer wieder den vorzüglichen Kaninchenbraten, der alle Küchengenüsse übertreffe, für die er bisher geschwärmt habe.
Unkas erzählte hierauf von dem wunderbaren Schlangenvogel, der, so groß wie eine Taube und von der Gestalt eines Sperbers mit gabelförmigem Schwanz, die gefährlichsten Giftschlangen angreife und sich durch Fressen der Blätter der Guacomorado-Liane gegen deren Bisse feie. Sein Schrei lautet deutlich »Guaco, Guaco!« und hat ihm selber, sowie der seltenen Schlingpflanze, deren unschätzbare Eigenschaften durch ihn den Menschen bekannt wurden, den Namen gegeben.
Am Sonntagmorgen erwachte Friedrich gekräftigt und munter; er spürte nicht die geringsten nachteiligen Folgen von dem Schlangenbisse, und die Zahnspuren begannen bereits zu vernarben.
Strittig blieb es, ob der Salmiakgeist mit dem Alkohol, wie der Professor behauptete, oder der Guaco, den Unkas für das einzige Heilmittel hielt, diese vorzügliche Wirkung hervorgebracht hatte. Friedrich meinte: »Doppelt g'näht hebt gut!« und erklärte, seine Rettung Schulze und Unkas gleicherweise zu verdanken.
Matatoa zog der Schlange die Haut ab, die Friedrich zum Andenken an die überstandene Todesgefahr mitnehmen wollte. Unkas trocknete die übrigen Guacoblätter an der Sonne, damit, wenn je ein ähnlicher Unfall wieder vorkäme, sofort der unfehlbar heilkräftige Tee daraus bereitet werden könne. Denn als Tee wird der Guaco gewöhnlich verabreicht, und nur in besonders dringenden Fällen begnügt man sich damit, die Blätter im Alkohol zu genießen.
Der Sonntag wurde in Stille und Ruhe gefeiert, und die Paka lieferten wiederum die Würze der Mahlzeiten.
Sowohl Schulze wie Friedrich fühlten sich so lebenskräftig, daß der Aufbruch für die ersten Morgenstunden des Montags in Aussicht genommen werden konnte. Alle waren gründlich ausgeruht und freuten sich, mit frischen Kräften die Reise wieder anzutreten.
Keiner von ihnen ahnte, daß der unfreiwillige Aufenthalt sie vor einem unliebsamen, vielleicht gefährlichen Zusammentreffen mit den drei Mestizen bewahrt hatte. Diese waren unseren Freunden nur noch um ein geringes voran und wußten ebensowenig, wie nahe ihnen die verhaßten deutschen Jünglinge waren.
AM Nachmittag des 11. Novembers erreichten unsere Reisenden die erste der beiden berühmtesten Stromschnellen des Orinoko, von denen die Indianer Südamerikas bis in die entlegensten Winkel des Festlandes Wunder zu berichten wissen.
Auch Unkas und Matatoa sprachen schon lange von nichts anderm als von den großen Raudales de Atures und de Maypures oder von Mapara und Quittuna, wie die Eingeborenen sie nennen. Sie waren begierig auf das Schauspiel, das ihrer wartete, und ein wahres Fieber ergriff sie, als sie das Brausen der Fälle von ferne vernahmen.
»Da sagt man immer, die Naturvölker hätten keinen Sinn für Naturschönheiten,« bemerkte Friedrich. »Nun, hier haben wir den Beweis des Gegenteils. Jedenfalls sind besonders großartige Naturbilder auch ihnen ein Gegenstand der Bewunderung.«
»Na!« wandte Schulze ein, »zur wissenschaftlichen Begründung Ihrer Behauptung dürfen sie Unkas und Matatoa nicht wohl in Betracht ziehen; die Kerle sind inmitten der Zivilisation aufgewachsen.«
»Gewiß! Aber überall, auch bei den wildesten Völkerschaften Südamerikas, hört man seit undenklichen Zeiten die Wunder der Fälle Mapara und Quittuna preisen.«
Alle waren begierig, diese Wunder zu schauen, deren Nähe sich durch ein immer stärker anschwellendes Brausen ankündigte, das bald zum Wüten und Donnern wurde — und nun standen die Gefährten an den Stromschnellen von Atures, überwältigt von dem großartigsten Schauspiel, das sie je gesehen hatten!
Eine Kette von Granitfelsen, die von Osten her gegen den Strom drängt, scheint hier den Orinoko überschritten zu haben; die Wasser aber durchbrachen das Hindernis und stürzen nun in gewaltigen Fällen über staffelförmig aufgeschichtete Blöcke herab, zwängen sich zwischen schroffen Klippen hindurch und ergießen sich in mächtigen Wasserstürzen nach unten.
Hochauf spritzte der Schaum, und die schrägen Strahlen der untergehenden Sonne durchflimmerten mit ihrem rosigen Goldglanze die zerstäubenden Wassermassen.
Unsre Freunde standen so, daß sie die ganze Reihe der breiten und schmalen Sturzbäche von einem Ufer bis zum anderen in einer Linie übersahen, und es machte ihnen den Eindruck, als schwebe der gewaltige Strom über seinem eignen Bette, sich unaufhörlich wieder in sich selbst hinabstürzend. Und zwischen den schwarzen Felsen, mitten im schäumenden Gewässer, erhoben sich lichtgrüne Inseln mit gefiederten Palmbäumen, und eben dieser Gegensatz von erhabener Wildheit und anmutiger Lieblichkeit gewährte einen Anblick, wie er sich herrlicher nicht denken ließ.
Lange Zeit standen alle stumm bewundernd vor dem unvergleichlichen Schauspiel, das ihnen der Salto de los Atures gewährte, die Indianer anscheinend in gleicher Verzückung wie die Weißen. Dann versank die Sonne im Westen, und sie rissen sich los, um das frühere Dorf Atures aufzusuchen, das in einiger Entfernung vom Ufer im Osten lag.
Man konnte deutlich sehen, daß der mit Felsblöcken bestreute ebene Grasboden, der das Dorf umgab, einst zum Flußbette gehört haben mußte. Erst hinter dem Dorfe erhoben sich die Felswände, die vor Zeiten das Ufer gebildet hatten.
San Juan Nepomuco de los Atures, die südlichste der Jesuitenmissionen am Orinoko, hatte das Schicksal so vieler ihrer Schwestern geteilt: sie stand verödet und verlassen; die Häuser waren meist zerfallen, doch hatten einige davon noch ziemlich gut erhaltene Dächer, und unsere Freunde freuten sich, wieder einmal in einer menschlichen Wohnung übernachten zu können, mochte sie noch so kahl und baufällig sein.
Gleich eines der ersten Häuser wurde zum Nachtquartier ausersehen, da es zu den besterhaltenen gehörte; aber Matatoa, der voranging, sprang sofort wieder entsetzt von der Schwelle zurück, und gleich darauf erschien brüllend ein mächtiger Jaguar unter der Haustüre, ein Tier von der Größe eines kleinen indischen Tigers.
Alle waren über diesen unerwarteten Anblick verblüfft. Ulrich allein hatte so viel Geistesgegenwart, sofort die Flinte anzulegen und das Tigertier, das bereits zum Sprunge ansetzte, niederzuschießen. Durch den Kopf getroffen, stürzte es zu Boden; aber schon war ein zweiter Jaguar auf der Schwelle erschienen, und ehe ein Schuß auf ihn abgegeben werden konnte, stürzte er sich auf Unkas; dieser jedoch sah sich vor, wich blitzschnell aus und stieß dem Tier, das dicht neben ihm den Grund erreichte, sein Jagdmesser zwischen die Rippen, worauf eine Kugel aus Friedrichs Büchse dem schwerverwundeten Raubtier vollends den Garaus machte.
Nun krochen zwei ganz junge Tigerkatzen heraus, die sich winselnd und schmeichelnd an die tote Mutter schmiegten, ohne eine Scheu vor den Menschen zu zeigen.
Als unsere Freunde sich einem anderen Hause zuwendeten, sahen sie auch dort unter dem Eingang zwei Jaguare erscheinen, die offenbar durch das Knallen der Schüsse aus ihrer Ruhe aufgeschreckt worden waren: es sah aus, als träte der Hausherr in Begleitung seiner Gattin vor die Haustüre, um nachzusehen, was los sei; bald drängte sich auch die kleine Familie neugierig hinter den Alten vor.
»Die Mission ist von Tigern bewohnt,« sagte Matatoa. »Nun! früher war es auch nicht viel besser, wie die Guahibo erzählen; immerhin mag Matatoa nicht hier bleiben und die Sennores wohl auch nicht.«
»Gewiß nicht!« sagte Ulrich. »Wenn noch mehr solche Einquartierung vorhanden sein sollte, wäre es zweifelhaft, ob wir das Nest säubern könnten, auch könnten wir eine unruhige Nacht erleben, und es ist immer noch die Frage, wer zuletzt Sieger bliebe.«
Schulze stand noch starr vor Schrecken, dann aber raffte er sich plötzlich auf und rief: »Nur fort! weit fort, ehe es ganz dunkel wird, unter solchen Umständen verzichtet man gern auf ein schützendes Dach!« Sein Rat wurde denn auch gleich befolgt, und die wilden Tiere ließen Menschen wie Maultiere ziehen, sie mochten dem Frieden auch nicht recht trauen.
Als ein geeigneter Lagerplatz gefunden war, äußerte der Professor: »Ich habe wohl gelesen, daß die Umgegend der Atures-Fälle von Tigern wimmle, und daß die Tiere sich mit Vorliebe in verlassenen Hütten häuslich niederlassen. Aber Jaguare als Dorfbewohner — nein! das hätte ich doch nicht für möglich gehalten!«
»Woher hat eigentlich die Mission ihren Namen?« forschte Ulrich, als sie eine Stunde später beim Nachtimbiß um ein Feuer saßen.
Schulze gab aus dem Schatze seines Wissens bereitwilligst Auskunft: »Sie trägt, wie übrigens alle Missionen der Gegend, neben ihrem Heiligennamen den Namen des Indianerstammes, nach dem die Gegend benannt war. Das Volk der Aturen gehört aber zu denjenigen, die auf rätselhafte Weise vom Erdboden verschwunden sind: man weiß nicht, ist es ausgestorben, ist es in eine unbekannte Gegend ausgewandert, oder ist es durch Vermischung spurlos in einem anderen Stamme aufgegangen.«
Am anderen Morgen ward die Reise fortgesetzt. Noch einmal wurden die Katarakte in der Morgendämmerung bewundert, wobei die schwarzen vom Wasser mit Eisen- und Manganoxyd überkrusteten Felsen sich noch düsterer von den weißschäumenden Fluten abhoben als im Abendsonnenglanz. Dann ging es rüstig weiter.
Die Gegend der Raudales de Atures und Maypures ist die ungesundeste und fiebergefährlichste im Orinokogebiet. Das Fieber ist aber gewöhnlich intermittent, das heißt, es tritt mit zeitweisen Unterbrechungen auf und ist nicht unmittelbar gefährlich. Ulrich und Friedrich fühlten an diesem Tage leichte Anfälle dieses sogenannten »dreitägigen« Fiebers; doch half ein Tee von Chinarinde ihrer kräftigen Natur bald über die Schwäche hinweg. Besonders bedenklich soll es sein, auf den »Laxas negras«, das heißt dem schwarzüberzogenen, übrigens abfärbenden, Granitgestein zu schlafen. Davor hüteten sich denn auch die Reisenden.
Mächtig erhob sich im Westen über dem linken Ufer des Orinoko der fünfhundertachtzig Meter hohe Bergkegel des Pic Uniana auf einer steil abfallenden Felsmauer, ein majestätischer Anblick, zumal der gewaltige Fels frei aus der Ebene aufstieg.
Die Landschaft bot eine außerordentliche Fülle von Abwechslung: Felsgruppen und -türme, von grünen Wiesen umgeben, die, mit zarten Kräutern und niederem Gras bewachsen, an europäische Matten erinnerten; ebene, völlig kahle Granitplatten dazwischen, dann wieder enge, sonnenlose Schluchten voll rankender Schlingpflanzen und leuchtender Blumen, steinige Öden, aus denen sich grüne blütenreiche Oasen erhoben — es war, als ob menschliche Kunst eine Parkanlage habe schaffen wollen, die die verschiedensten Naturschönheiten in sich vereinige.
Die Ferne war im Süden von hohen, schön geformten Bergen begrenzt, die meist dicht bewaldet waren; aus den Waldungen schossen gruppenweise schlanke bis zu vierzig Meter hohe Palmen auf, deren gekräuselte Wipfel sich scharf gegen den Himmel abhoben: es sah aus, als seien zwei Wälder übereinandergetürmt, oder der Wald sei in zwei Stockwerken aufgebaut.
Im Osten dagegen waren die Bergkämme mit gezackten Felsen besetzt, die wie Pfeiler über das Gebüsch emporragten.
Die Reiher, die Soldado und Flamingo, die auf den Felsbänken am Flußufer standen, machten den Eindruck militärischer Wachtposten und ließen sich aus der Ferne nur dann als Vögel erkennen, wenn sie aufflogen.
Auf dem ganzen Wege war das betäubende, donnernde Getöse der Fälle bald stärker, bald schwächer vernehmbar.
Zur Linken erhob sich ein steiler, glatter Granitberg; dort befand sich, wie Schulze versicherte, die berühmte Höhle von Ataruipe, die Grabstätte der Aturen, in der in Palmblätterkörbe gebettet sechshundert Skelette, teils mit wohlriechenden Harzen überzogen, teils mit Onoto gefärbt, ruhen; auch viele Graburnen mit kunstvollen Henkeln in Gestalt von Krokodilen und Schlangen seien dort zu finden.
Nachmittags vernahm man wieder ein lauteres Brausen und zunehmendes Getöse, das die Nähe der Katarakte von Maypures anzeigte. Als der Fuß des hohen Gebirges Cunavami erreicht worden war, erschienen die Fälle in ihrer großartigen Pracht.
Wie bei Atures zeigte sich eine ganze Reihe staffelförmiger Fälle hintereinander, deren jeder aus einer Unzahl kleinerer oder größerer Wasserstürze gebildet war, die in einer Linie von einem Ufer zum anderen liefen. Zwischen diesen Einzelfällen befanden sich wiederum reizende Palmeninseln und wilde Felsendämme. Der unterste Katarakt war der gewaltigste: hier stürzte das Wasser aus einer Höhe von drei Metern über den Granitdamm herab. Mitten aus den strudelnden Wassermassen ragten, gleich alten Burgen, die Felseninseln Quivitari und Camanitamini empor. Drüben auf dem westlichen Ufer lagen malerisch im Grünen gebettet die Überreste der Mission San José de Maypures.
Die Schwärze der Felsen, das Grün der weit über zwanzig Meter hohen Palmen, das Blau des Himmels und darunter der silberweiße Gischt; die Totenstille der Natur ringsum und das wütende Zischen und Donnern der Wassermassen — das alles machte einen unauslöschlichen Eindruck auf die Gemüter der ergriffenen Zuschauer. Nicht zum wenigsten schienen die beiden Indianer überwältigt zu sein, so daß sie sich hernach ganz abgestumpft zeigten und bei den großartigsten Naturbildern, auf die sie späterhin aufmerksam gemacht wurden, für gewöhnlich die Achseln zuckten und sagten: »Ach was! das will nichts heißen wir haben die Raudales Mapara und Quittuna gesehen!«
Besonders auffallend waren zwei Felsen, der Mondfelsen Keri, der aus einem vertrockneten Arm des Orinoko am westlichen Ufer aufragt und hoch oben einen weithin glänzenden silberweißen Fleck zeigt: das Bild des Mondes, und östlich von diesem, mitten in den Fällen, der Sonnenhügel Quivitari mit dem scheibenförmigen Bilde der Sonne.
Nach einstündigem Aufenthalt an dieser unvergleichlichen Stelle brachen unsere Freunde wieder auf. Ziemlich schwierig war der Paß zwischen dem Orinoko und der Bergkette des Cunavami, die sich hier mit ihrem letzten Ausläufer, dem Pie von Calitamini, bis hart an den Strom drängt.
»Dies ist ein geographisches Ereignis!« sagte Schulze feierlich. »Humboldt sagt, kein Mensch sei je diesem Berge nahe gekommen, um dessen Fuß wir uns jetzt herumdrücken, und seit Humboldt hat sich hierin nichts geändert. Wir dürfen stolz sein auf diese Tat!«
Zwei Stunden später durchquerten sie den Rio Sipapo und beschlossen, an seinem linken Ufer ihr Nachtlager aufzuschlagen. Der geheimnisvolle Pic Calitamini, ein abgestutzter Kegel, erstrahlte, von der untergehenden Sonne beleuchtet, in seinem eigentümlichen rötlichen Feuer, hier und da von silberweißen Blitzen unterbrochen, wie er dies, nach Humboldts Bemerkung, alle Tage tut; die sichere Ursache dieser einzigartigen Erscheinung konnten auch unsere Freunde nicht ergründen.
Der Imbiß, der vor der Nachtruhe eingenommen wurde, bestand diesmal nur aus Palmfrüchten, Kassavebrot und Honig; an Fleisch mangelte es, da kein Wild erlegt worden war — zum großen Bedauern des tierkundigen Feinschmeckers. Ein großer Frosch, den Friedrich aufstöberte, schien ihm für einen Braten wenig geeignet, wogegen er sein wissenschaftliches Interesse mächtig erregte; das Amphibium war prächtig gefärbt, Rücken und Kopf von sammetartigem Purpur, der Bauch gelb, und vom Maul bis zu den Hinterbeinen zog sich ein einziger schmaler weißer Streifen.
Angesichts der Seltenheit dieses Tieres beschloß Schulze, auf die Schenkel des Tieres zu verzichten und es vollständig seiner Naturaliensammlung einzuverleiben.
DER Weg ging nun stets am Fuße von Gebirgen hin, die teilweise so nahe an den Fluß herantraten, daß sie überstiegen werden mußten. Unsere Freunde bedauerten, nicht auf das andere Ufer übersetzen zu können, das viel ebener war und ein rascheres Fortkommen ermöglicht hätte.
Die Indianer erboten sich zwar, eine Pirogue herzustellen, aber das hätte doch noch länger aufgehalten, als die nicht unüberwindlichen Schwierigkeiten, die das rechte Orinokoufer bot.
Im Norden verdämmerte die gewaltige Felsenmauer der Cunavamikette mit ihrem wildgezackten Kamme; auf dem westlichen Ufer ergoß sich der Rio Vichada in den Orinoko. Dort lachte eine reizvolle Landschaft herüber; Wälder und Matten in frischem Grün, wunderlich geformte Felsblöcke wie Pfeiler, Säulen und Türmchen oder auch wie Häuser, Burgen und Kirchen standen vereinzelt auf moosigem Grund und waren oft von Palmen gekrönt, und seit Wochen zum erstenmal tauchten auch wieder die eigenartigen Säulenkaktus auf in ihren mannigfaltigen Formen als riesige Telegraphenstangen oder Armleuchter und erstarrte Riesenschlangen mit stacheligem Leib. Auffallend und bedrückend war die fast völlige Windstille, die in diesen Gegenden herrschte: nirgends vernahm man mehr das so angenehme Säuseln der Laubwipfel, dessen Laut allein schon bei der großen Hitze erquickend wirkt; und diese Zone der Windstille sollte sich bis zum Stromgebiet des Amazonas ausdehnen!
Das Wasser der Flüsse, die sich fortab in den Orinoko ergossen, erschien tiefdunkel, kaffeebraun, fast schwarz, und doch war es rein und wohlschmeckend. Wenn ein leichtes Lüftchen den Spiegel kräuselte, was bei der andauernden Windstille freilich nur selten geschah, färbten sich die Flüsse wunderbar schön wiesengrün.
Als sich die Kette des Cunavami zum letztenmal gegen den Himmel abzeichnete, erzählte Matatoa, daß dort in den Wäldern des Rio Sipapo, den die Indianer Tipapu nennen, das Volk der Raya wohne, das kopflos sei und den Mund in der Mitte des Bauches trage.
Diese Fabel gab Schulze Anlaß zu einigen Bemerkungen über den Landstrich, der vor ihnen lag. »Wir ziehen nun«, sagte er, »durch das Land der Fabeln; außer den Flußufern ist hier alles völlig unerforscht, ja, die meisten Nebenflüsse des Orinoko und Rio Negro sind nicht weiter als an ihrer Mündung bekannt.
»Unter den Indianern selber bis fern in die Llanos und an die Meeresküste gehen die wunderlichsten Sagen über die unbekannten Völker um, die diese nie betretenen Landstriche und namentlich die geheimnisvollen Urwälder bewohnen; schon die Natur der Gegend hat ihre unergründlichen Rätsel: aus ihr fließen die weißen und die schwarzen Wasser, und kein Mensch kennt ihren Lauf oder gar ihre Quellen; woher kommen die grundverschiedenen Färbungen, die oft so nahe beieinander liegen, daß ein weißer Fluß sich in einen schwarzen ergießt und ein schwarzer in einen weißen? Warum haben die schwarzen Flüsse weiße Ufer, die weißen hingegen schwarze? Im weißen Orinoko finden sich die kohlschwarzen Felsen, im schwarzen Rio Negro ragen schneeweiße Blöcke empor! Kein Wunder, daß dieses Gebiet der rätselhaften Wasser auch von der Phantasie mit märchenhaften Wesen bevölkert wird — weil noch kein Mensch es durchforscht hat!
»Völlig unerklärlich ist dabei nur der eine Umstand, daß die Indianer genau die gleichen Fabeln über diese Phantasievölker berichten, wie die Alten sie von den Garamanten, den Arimaspen und Hyperboräern erzählten oder die Orientalen in ihren Märchen von Tausendundeine Nacht und unsere Vorfahren in ihren Heldensagen und namentlich in den Fahrten des Herzogs Ernst.
»In den Gegenden, zwischen denen wir hindurchziehen werden, leider ohne selber hineinzudringen, sollen also die Menschen mit den Hundsköpfen leben, die Zyklopen mit einem einzigen Auge inmitten der Stirne, die großen behaarten Waldmenschen, die Salvajen, die die Weiber rauben, und die von den Tamanaca »Achi«, von den Maypuren aber »Vasitri« oder große Teufel genannt werden. Die Zehen dieser Leute sollen so stehen, daß ihre Spuren den Anschein erwecken, als seien sie rückwärts gegangen. Natürlich handelt es sich entweder um Bären oder gorillaähnliche Affen.
»Hierzu kommt noch die Sage von den kriegerischen Weibern, die dem Amazonenstrom den Namen gaben, und die von den Eingeborenen »Cougnantainsecouima« oder »Aikeambenano«, d. h. »Weiber ohne Männer« und »Weiber, die allein leben«, genannt werden. Von ihnen sollen die wunderbaren grünen Steine herkommen, die man da und dort in den Händen der Leute findet, ohne daß sich bis jetzt ihre Fundorte ermitteln ließen.
»Endlich darf ich all diesen Märchen noch das Fabeltier beifügen, dessen Nichtvorhandensein ich nachweisen werde.«
Es entspann sich über diese Gegenstände ein lebhafter Streit, da Friedrich die Ansicht vertrat, derartige weitverbreitete Sagen, die sich durch Jahrhunderte hindurch völlig unverändert erhalten, müßten stets irgend einen tatsächlichen Hintergrund haben und dürsten nicht ohne weiteres als reine Phantasiegespinste angesehen werden. Von einem solchen Zugeständnis wollte jedoch der Mann der Wissenschaft durchaus nichts wissen.
Inzwischen traten die Berge im Osten weiter zurück, und dichter Urwald nahm die Abenteurer, wie wir sie bei ihrem Ritt durch abenteuerliche Länder wohl nennen dürfen, wieder auf.
Am westlichen Ufer zeigte sich die Mündung des Rio Mataveni; kurze Zeit darauf sah man eine merkwürdig geformte Insel sich aus dem Strome erheben: es war ein viereckiger Granitfelsen, den man für den Mäuseturm bei Bingen hätte halten können, und der von den Spaniern »El Castillito« genannt wird.
Die Nacht wurde am Fuße eines Felsens zugebracht, aus dessen Spalten unzählige Fledermäuse hervorflatterten, so daß anderthalbstündige Nachtwachen verteilt werden mußten. Jeder der Wächter befand sich während seiner Wachezeit in beständigem Kampf mit den Vampiren, und am anderen Morgen bedeckten Dutzende dieser widerlichen Geschöpfe den Lagerplatz.
Die Reise ging dann weiter durch Wiesen und Wälder und zwischen Felsblöcken hindurch; einen neuen, überraschenden Anblick gewährte unseren Freunden eine schwimmende Wiese auf dem Orinoko: es waren dies entwurzelte Bäume und Schlinggewächse, die sich zu einem natürlichen Floße verwickelten und mit Wasserpflanzen bedeckt waren. Diese Chinampa können der Schiffahrt gefährlicher werden als die Stromschnellen.
Man sagt, daß die Karaiben sowohl wie die spanischen Schmuggler derartige Treibstämme künstlich zusammenfügen und mit Kräutern und Baumzweigen bedecken. Ihre in diesem natürlich erscheinenden Pflanzengewirre festgebundenen Kanue, die sorgfältig unter dem Grün verborgen sind, können auf diese Weise unauffällig den Strom hinabtreiben, denn wer wollte eine solche schwimmende Wiese untersuchen, und vor allem, wer dürfte es wagen, da jede nahende Pirogue von der Wucht der treibenden Riesenstämme zertrümmert würde.
AM Nachmittag des 14. Novembers langten die Reisenden in San Fernando de Atabapo an, wo der Orinoko in nahezu rechtem Winkel stromaufwärts nach Osten abbiegt, um vor Esmeralda den Cassiquiare in südwestlicher Richtung dem Rio Negro zuzusenden.
Hier mußten sie den Lauf des gewaltigen Stromes verlassen, wenn sie nicht einen großen Umweg machen wollten: ihr Weg führte südwärts den Atabapo entlang zum Rio Negro. Die vielen Windungen des Atabapo konnten sie hierbei, da sie nicht zu Wasser reisten, vermeiden und so den Weg bedeutend abkürzen.
In San Fernando, das am Zusammenfluß dreier großer Flüsse, des Orinoko, des Guaviare und des Atabapo liegt, hielten sie sich den Rest des Tages auf, sowohl um neue Kräfte zu sammeln, als auch um ihre Vorräte an Lebensmitteln und Munition für die nun folgende beschwerliche Reise durch wenig bewohnte Landstriche zu erneuern.
Die Mission von Atabapo machte einen sehr freundlichen Eindruck; an den Häusern rankten häufig Schlingpflanzen hinauf, und viele der Gebäude waren von prächtigen Gärten umgeben, deren Hauptzierde die Pihiguaho- oder Pirijaopalme bildete. Der mit Stacheln bedeckte Stamm dieser Palme erreichte eine Höhe von über zwanzig Metern, und die Krone mit ihren sehr schmalen, gefiederten und an den Spitzen wellenförmig gekräuselten Blättern hob sich anmutig vom Himmel ab. Die merkwürdigen Früchte dieses wertvollen Baumes bestanden aus zwei bis drei Trauben, deren jede fünfzig bis achtzig apfelgelbe große Früchte trug. Diese röten sich in der Reife und enthalten einen mehligen, eigelben, sehr nahrhaften Stoff, der die Hauptnahrung der Bewohner dieses Landes bildet. Die Frucht wird meist gesotten oder in Asche gebraten wie die Banane und die Kartoffel.
Von diesen Früchten, die ihnen ganz neu waren, aber herrlich mundeten, hatten unsere Freunde ihren Maultieren einen großen Vorrat aufgeladen, als sie in der Frühe des 16. Novembers die Stadt verließen und den Rio Atabapo entlang südwärts zogen.
Der Fluß gehört zu den »schwarzen« Gewässern, er hat eine bräunliche Farbe, ist aber so klar, daß man bis auf den Grund sehen und die Fische darin zählen kann. Die üppige saftiggrüne Pflanzenwelt des Ufers spiegelte sich in dem schönen Wasser so deutlich, daß die Farben im Spiegelbild an Leuchtkraft der Natur gleichkamen. Das Wasser war nicht bloß reiner, sondern auch ziemlich kühler als das Wasser des Orinoko und seiner bisherigen Zuflüsse, daher es ein angenehmes, erfrischendes Getränk bot. Der Palmenreichtum bildete den größten Reiz des Landschaftsbildes.
Ein eigentliches Ufer sah man bei diesem Flusse gar nicht; denn seine Wellen umspülten zu beiden Seiten die Stämme und Wurzeln von Palmen und kleinen Bäumen, so daß es aussah, als sei der Fluß über die Ufer ausgetreten. Von Krokodilen sah man keine Spur, keine Seekühe, keine Wasserschweine belebten die Fluten, in denen sich nur die Süßwasserdelphine in größeren Herden tummelten.
Im Walde vernahm man nicht mehr das Lärmen der Brüllaffen, die Zamuro waren hier fremd. Hier und da ließ sich ein Jaguar von außerordentlicher Größe blicken, aber er zeigte sich stets scheu und wagte sich auch bei Nacht nicht in die Nähe der Menschen, selbst wenn kein Feuer ihn schreckte.
Die größte Gefahr dieser Wälder bildeten die riesenhaften Wassernattern, deren zahlreiches Auftreten das Baden im Flusse verbot; dagegen empfanden es die Reisenden als außerordentliche Wohltat, daß die Moskito und Zancudo hier nicht mehr mit ihren schmerzhaften Stichen Menschen und Reittiere plagten.
Der Waldboden war häufig sumpfig, so daß die Maultiere stellenweise tief einsanken und nur schwer vorwärts kamen; hier und da ragten vereinzelte Felsen wie feste Schlösser aus dem Walde empor; am Fuße eines solchen zwanzig Meter hohen Felsens, der Piedra del Tigre, wurde die Nacht zugebracht.
Andern Tags ging es wieder weiter durch den Urwaldstrich, der, sich zwischen Savannen hinziehend, den Atabapo säumt. Nur in der Nähe des Flusses bestand die Waldung aus dünnstämmigen Bäumen, die von ferne wie junge Kirschenbäume aussahen und eine ganz angenehme Abwechslung dem Auge boten, das bisher die Riesenverhältnisse der Urwälder am Orinoko gewohnt war: man glaubte sich hier oft nach Europa versetzt.
Wo aber der Grund trockener war, zeigten sich auch wieder die Riesen der Tropen; so fanden unsere Freunde einen etwa fünfzig Meter hohen Käsebaum, der sechs Meter Durchmesser hatte.
Mitten im Walde lagen die spärlichen Trümmer der seit hundert Jahren verlassenen Mission Mendaxari.
Es war schon Nacht, als sich endlich die Mission San Baltasar zeigte, mit ihrem vollen Namen »la divina Pastora de Baltasar de Atabapo«.
In diesem von schönen Gärten und gutgepflegten Pflanzungen umgebenen Dorfe, in dem man den europäischen Feigen- und Zitronenbaum findet, blieben die Reisenden über den 17. November, der ein Sonntag war.
KURZ vor dem Einfluß des Rio Temi in den Atabapo sieht man am westlichen Ufer des Flusses eine Granitkuppe, die die Spanier Piedra de la Madre oder den Felsen der Guahiboindianerin heißen, wörtlich: »Stein der Mutter.«
Am Abend des 16. Novembers lagerten am Fuße dieses Felsens drei Männer in spanischer Tracht und zwei Indianer, die sie offenbar als Diener begleiteten.
Die Indianer hockten schweigend an einem Feuer, über dem sie ein Stück Wild am Spieße brieten; ihre Herren ruhten in bequemen Stellungen an einem zweiten Feuer und schienen sich ihren Gedanken hinzugeben.

»Was hat es eigentlich für eine Bewandtnis mit diesem Felsen, Alvarez?« Mit dieser Frage unterbrach einer der drei das Schweigen, ein schlanker Mann mit hagerem lederfarbenem Gesicht und spitzem Schnurr- und Kinnbart.
»Das ist eine lustige Geschichte,« erwiderte der Angeredete mit widerlichem Lachen, indem er sich über das glatte rotbraune Gesicht strich. »Der Padre von San Baltasar hat sie mir schon früher des langen und breiten erzählt, als er mich bei meiner ersten Reise in diesen Wäldern bis nach Maroa begleitete. Der gute Padre! Er schien die Sache so rührend zu finden!«
»Eine rührende Geschichte?« rief der dritte des Kleeblatts boshaft auflachend aus. »Das ist ja reizend! Nur heraus damit. Es fängt schon lange an recht langweilig zu werden — immer nur El Dorado und wieder El Dorado! Aber die Reise! Mich reut bereits, euch in diese Wildnisse gefolgt zu sein.«
»Ach was, Diego! Wenn du einmal die Goldstadt erblickst, wirst du anders sprechen, da denkst du der Strapazen nicht mehr!«
»Ja! wenn — wenn! Nun, ich will nicht wieder anfangen, aber laß einmal deine Geschichte hören: also, warum nennen sie diesen Felsen ›Piedra de la Madre‹?«
»Nun denn! Ihr wißt, daß die Spanier an allen Flußläufen eine Unzahl Missionen errichtet haben, um die armen Seelen der roten Heiden zu retten und den Glanz der Kirche zu mehren. Na, durch solche guten Werke erlangt man Ablaß für Sünden und Verbrechen, und das hatten sie so nötig wie wir.
»Aber die Indianer kamen nicht, und wer kam, entlief, sobald er den Segen der Mission auf seinem blutrünstigen Rücken zu peinlich empfand. Ha, ha! Sie wußten nicht, daß es für sie eine große Ehre war, von edlen Spaniern mit der Seekuhpeitsche bekehrt zu werden. Für die Weißen arbeiten mochten sie auch nicht, da sie ihre wilde Freiheit der Sklaverei vorzogen, als ob sie zu etwas Besserem geschaffen wären!«
»Dumm und faul, wie heute!« murmelte Diego. »Nicht wahr, Lopez?«
»Ich habe weniger indianisches Blut in den Adern als du!« erwiderte Lopez finster, da er aus der Frage des Gefährten einen leisen Spott herauszuhören glaubte: die beiden stritten sich immer, wer von ihnen ein echterer Spanier sei, obgleich sie wiederum die Vollblutspanier haßten und verachteten.
»Streitet nicht wieder!« nahm Alvarez das Wort. »Darin sind wir jedenfalls einig, daß dem Indianer die Peitsche gehört, und daß es eine Schande ist, wenn man ganze Völker von ihnen noch in Unabhängigkeit herumstreifen läßt. — Aber zu meiner Geschichte: also! der Missionar von San Fernando sah, daß es mit dem Seelenfang nicht vorwärts gehen wollte, so griff er denn zu dem ebenso einfachen wie beliebten Mittel der Menschenjagd.«
»Dieses Mittel ist aber sowohl durch die Religion wie durch die spanischen Gesetze verboten,« schaltete Diego ein.
»Pah! Was der Kirche nützte, tat sie stets, unbekümmert um religiöse Engherzigkeit und unpraktische Staatsgesetze. Der Missionar zog mit bewaffneter Macht an den Guaviare, ließ einige Dörfer niederbrennen und jeden, der Widerstand leistete, niedermachen, denn es war ihm hauptsächlich um die Kinder zu tun; die Erwachsenen sind starrköpfig und schwer zu bekehren und bilden oft eine Gefahr für die Missionen. Es ist daher besser, sie gleich zur Hölle zu senden, der sie doch verfallen sind, ehe sie weiteren Schaden anrichten.«
Ein widerliches Gelächter bekundete den Beifall, den die Zuhörer dieser Bemerkung spendeten.
Alvarez fuhr fort: »Nun fand man in einer Hütte ein Guahiboweib mit drei Kindern, von denen zwei noch nicht erwachsen waren. Sie waren damit beschäftigt, Maniokmehl zu bereiten, während der Vater auf den Fischfang ausgegangen war. Mutter und Kinder wurden gefesselt und in der Pirogue nach San Fernando gebracht.
»Niemand dachte daran, daß sich die Guahiba zu Lande durch den pfadlosen Urwald je wieder in ihre abgelegene Heimat zurückfinden könne, wagt sich doch nicht einmal der Indianer in eine ihm unbekannte Wildnis. Überdies sind da die Schlangen und der Jaguar, die ein Indianerweib so gut wie eine zarte Donna von Caracas fürchtet.
»Allein die Mutter versuchte mehrmals, mit ihren Kindern zu entfliehen; weit kam sie nicht. Es war eine lustige Hetzjagd, das schwache Wild mit den zitternden Kleinen wieder einzufangen, und dann wurde jedesmal ihr vom Gestrüpp zerrissener Leib mit der Peitsche noch etwas gründlicher zerfleischt und so rot gefärbt, wie es sich mit dem Onoto nicht machen läßt.«
»Ja! Und die schönen Zeichnungen, die der Riemen hinterläßt!« spottete Lopez. »Es ist eine Freude: kein Regenguß wäscht sie so bald ab!«
»Bei dem Teufelsweib half aber das alles nicht,« fuhr Don José de Alvarez unentwegt fort. »Als der Padre sah, daß seine väterliche Güte hier nichts ausrichtete, beschloß er, sie von ihren Kindern zu trennen, da sie deren Seelenheil hinderte. Als man sie jedoch den Atabapo hinaufführte, um sie in den Missionen des Rio Negro zu begraben, gelang es ihr, ihre Fesseln zu lösen und ans Ufer zu schwimmen. An eben der Stelle, wo wir jetzt lagern, kletterte sie empor, aber die Jäger waren schneller als das Wild; sie legten sie auf den Felsen und ließen die Peitsche so lustig auf ihr herumtanzen, daß der von ihrem Blute überströmte Fels eine Taufe empfing, von der er seither seinen Namen hat. Nach dieser kleinen Operation schien es nicht mehr nötig, das Weib zu binden: man hätte glauben sollen, es könne keinen Schritt mehr machen. Aber die Sorge um eine verlorene Seele macht vorsichtig, und so wurde die Guahiba besser gefesselt als zuvor und in die Mission Javita gebracht. Dort sperrte man sie ein.
»Was tat das verrückte Weib? Es zernagte seine Bande und entwich aus der Hütte, in der man es nur nachlässig bewachte, da man es halb tot wähnte, und durch eine Wildnis, die noch keines Menschen Fuß betreten hatte, fand es sich nach tagelangem Wandern, von Ameisen sich nährend, zurück nach San Fernando. Aber die Guahiba war toll, wenn sie glaubte, sie werde ihre Kinder wiedersehen. Über solchem Eigensinn und Trotz verlor der Missionar alle Geduld und ließ sie so weit fortbringen und so gut verwahren, daß ihre Rückkehr nicht mehr zu fürchten war. Sie nahm aber keine Speise mehr zu sich und starb: so konnten ihrer Kinder Seelen gerettet werden.«
Diego und Lopez schwiegen. Es mochte sie doch etwas an dieser großen Mutterliebe und der schändlichen Grausamkeit, mit der sie erstickt werden sollte, bewegt haben, denn die Lust zu spötteln war ihnen vergangen.
Zwei Tage darauf langten auch unsere Freunde am Fels der Guahiba an, sie hielten sich aber auf dem anderen Ufer des Atabapo und ahnten nicht, daß ihnen feindlich gesinnte Menschen so kurz zuvor an dieser Stelle gerastet hatten.
AM 18. November erreichten die Reisenden San Antonio de Javita am Temi, einem Nebenflusse des Atabapo. Hier heilte ein Indianer ihre Hände, die ein mikroskopisches Insekt, der Arador, das heißt »Ackerer«, nach allen Richtungen mit schmerzhaften weißlichen Furchen durchpflügt hatte. Der bläuliche, schaumige kalte Aufguß, den der Indianer aus der Rinde des Uzaostrauches bereitete, nahm sofort alle Schmerzen, und unsere Freunde versahen sich mit einigen Uzaozweigen, um dem peinlichen Übel auch fernerhin begegnen zu können. Den ganzen Tag waren sie im heftig strömenden Regen dahingeritten, und auch am folgenden Tage, an dem sie noch vormittags den Rio Guainia oder Rio Negro bei Maroa erreichten, regnete es in einem fort. Man versicherte sie, hier regne es beinahe das ganze Jahr und oft monatelang ohne Unterbrechung.
Als Abwechslung war ihnen der Regen anfangs willkommen gewesen, sie bekamen ihn aber doch bald satt.
Die Mission Maroa bestand aus einem sauberen und wohlhabenden Dorfe, meist von christlichen Indianern bewohnt. Das Wasser des Rio Negro war in der Durchsicht klar, in der Aufsicht aber kaffeebraun.
In Maroa lernten die Deutschen das Mani kennen, eine Harzmischung, mit der man die Piroguen teert, ebenso verschiedene Kautschukarten, von denen ihnen besonders eine weiße Milch gefiel, mittels der Geräte wasserdicht und glänzend weiß gefirnißt werden. Auch die Seide- und Wachspalmen sahen sie hier angepflanzt, Bäume, die Erzeugnisse liefern, die man lange Zeit für ausschließlich tierische Stoffe hielt.
Als sie im Rio Negro eine schöne Pirogue schaukeln sahen, fragte Schulze, wohin diese bestimmt sei; und als es hieß, sie werde mit Waren den Amazonas hinabfahren, sagte er zu den Reisegefährten: »Ich möchte den Vorschlag machen, wir fahren mit diesem Schiffe bis San Joaquim. Da der Rio Negro beinahe in gerader Linie bis dorthin fließt, kann der Landweg kaum um wenige Kilometer kürzer sein. Wer weiß aber, welche Hindernisse er bietet? Stromaufwärts kamen wir freilich mit den Maultieren rascher voran, als es auf dem Flusse möglich gewesen wäre; nun aber geht es talab, und wir werden mindestens drei bis vier Tagereisen ersparen, wenn wir das Schiff benutzen; da es die Fahrt sowieso macht, werden wir auch um ein Billiges befördert werden.«
Letztere Vermutung erwies sich als richtig, und da Ulrich und Friedrich den Vorschlag sehr vernünftig fanden, war der Vertrag mit dem Besitzer der großen Pirogue bald abgeschlossen, und so kam es, daß die ganze Gesellschaft mit Sack und Pack nebst Maultieren und Affen in der Morgenfrühe des 20. Novembers den Rio Negro zu Schiff hinabfuhr.
Die Fahrt dauerte bei starker Strömung vier Tage. Das Wetter hatte sich prächtig aufgeklärt. Am ersten Tage fuhr das Boot am Einfluß des Aquio und Tomo, beide auf dem rechten Ufer des Guainia, vorbei. Am Tomo wohnen die Cheruvichahenaindianer; auch eine kleine Mission »Tomo« befindet sich an seiner Mündung. Dann öffnete sich links der Itinivini, ein Arm des Cassiquiare, der auch Rio Me genannt wird und unter dem Namen Conorichite in den Rio Negro mündet.
»Hier,« rief Schulze beim Anblick dieser Wasserstraße aus, »hier haben wir ein wahres geographisches Wunder, das so manchem Gelehrten zum Fallstrick geworden ist. Es ist einmal so, der Verstandesmensch, namentlich wenn sein Verstand nicht allzuweit her ist, glaubt alles leugnen zu müssen, was im Verzeichnis seines Wissens nicht vorkommt. Daß nun zwei so mächtige Ströme wie der Amazonas und der Orinoko durch einen natürlichen Kanal miteinander in Verbindung stünden, das war so ohne jedes Beispiel in der Geographie der Alten Welt, daß man es für eine reine Unmöglichkeit hielt und selbst dann, als es gut bezeugt war, noch als Unsinn bestreiten zu müssen glaubte. Humboldts berühmte Reise verdanken wir eigentlich nur diesen Zweifeln gelehrter Pedanten, die nun einmal nicht zugeben mögen, es sei etwas möglich, das sonst nie vorkommt. Wie die Angabe der Nilquellen bei den großen afrikanischen Seen, die wir noch in mittelalterlichen Kartenwerken vorfinden, verschwand, weil die höhere Weisheit unserer Gelehrten sie für Schwindel hielt, so wurde auch die Verbindung zwischen Orinoko und Amazonas, die nach Acunnas Berichten in die alten Karten aufgenommen worden war, später wieder ausgemerzt. Pater Roman traf 1744, den Orinoko hinauffahrend, mit einer Pirogue portugiesischer Sklavenhändler zusammen, die vom Rio Negro kam. Seitdem war die Gabelteilung nicht bloß erwiesen, sondern wurde auch vielfach benutzt. Sollte man es glauben? Trotz dieser Tatsachen wurde die Sache nach wie vor wissenschaftlich bezweifelt, und der berühmte Geograph Buache nannte sie ›eine geographische Ungeheuerlichkeit, die Olmedillas Karte ohne allen Grund in der Welt verbreitet habe‹. Er behauptete, eine große Bergkette, deren Richtung noch zu ermitteln sei, bilde die Wasserscheide zwischen dem Amazonenstrom und dem Orinoko.«
»Ich begreife gar nicht,« schaltete Friedrich ein, »weshalb diese Stromverbindung so wunderbar sein sollte! Allerdings wunderte ich mich immer, daß in der Vorhalle des Stuttgarter Bahnhofes auf einer der riesigen Eisenbahnkarten an den Wänden eine Verbindung zwischen Orinoko und dem Amazonenstrom nicht eingetragen ist, obgleich Humboldt diese im Cassiquiare nachwies, lange ehe der Stuttgarter Bahnhof erbaut wurde.«
»So gibt es eben Köpfe,« lachte der Professor, »alles, was ihnen neu ist, will ihnen nicht ein, und dann behaupten sie frischweg: Das gibt es nicht! Acunna hat recht, wenn er sagt: ›Das Neue und seine Anzweiflung sind eine Zwillingsgeburt bei allen großartigen Erscheinungen.‹«
»Das sieht man auch an dem so viel bezweifelten Fabeltier,« bemerkte Ulrich schalkhaft.
»Ja, das ist wieder etwas ganz anderes!« erwiderte Schulze mit dem Brustton der Überzeugung. »Die Naturwissenschaft, insbesondere die Zoologie, hat eine so sichere Unterlage, daß von ihr aus ganz unfehlbare Schlüsse gezogen werden können. Da stehen wir doch anders da als jene zweifelsüchtigen Geographen, denen Humboldt ordentlich die Meinung gesagt hat: ›Es ist nicht das erstemal,‹ schreibt er, ›daß etwas für fabelhaft gegolten hat, was doch vollkommen richtig war, daß man die Kritik zu weit trieb, und daß diese Verbindung von Leuten für chimärisch erklärt wurde, die am besten davon hätten wissen sollen.‹«
Unterhalb des natürlichen Kanals, über den dieses Gespräch geführt wurde, sahen die Reisenden die Mission San Miguel de Davipe; hierauf ging es an der malerisch inmitten des Stromes gelegenen Insel Dapa vorbei. Dann wurde es bald Nacht, und die Pirogue trieb bei Fackelbeleuchtung langsam weiter.
In der Morgendämmerung des 21. Novembers erreichte sie die Mündung des Cassiquiare, während rechts die kleine Insel Cumarai auftauchte. In San Carlos de Rio Negro wurde angelegt. An dieser Stelle befinden sich drei langgestreckte, dichtbewachsene Inseln, die eine Zierde des Landschaftsbildes sind.
Schulze interessierte sich vor allem für die majestätischen Juviabäume, die er hier zum ersten Male sah. Diese Bäume tragen dreieckige Mandeln und werden in acht Jahren zehn Meter hoch.
Die Mission San Carlos ist durch ein Fort geschützt.
Von da ging es weiter den Rio Negro hinab; rechts ließ man den Canno Maliapo, links die beiden Canno Dariba und Eny. Dann kam die Insel San José. Unterhalb derselben wurde bei sinkender Nacht gelandet, um diesmal die Nacht am Ufer zu verbringen. Das Lager wurde in einem Haine von verwilderten Orangenbäumen aufgeschlagen, am Fuße eines siebzig Meter hohen Felsens mit einer Höhle, Cocuys Glorieta genannt. Hier hielt vor hundert Jahren der berüchtigte Cocuy seinen Harem, aus dem dieser Kannibale nach und nach seine Weiber verzehrte. Dies nannten die Missionare »eine üble Angewohnheit dieser Völker, die sonst so sanft und gutmütig sind«.
Am 22. November wurde die brasilianische Grenze überquert; man ließ das Fort San José de Maravitanos rechts liegen und wandte sich mit dem Strome in spitzem Winkel geradeswegs nach Westen bis zum Einfluß des Guaixia oder Uexie am rechten Ufer. Hier lagen die Dörfer Joam Baptista de Mabbe und San Marcellino.
Obgleich das Land durchaus nicht fruchtbarer war als am Orinoko, so waren doch hier die altportugiesischen Niederlassungen viel zahlreicher. Auf einer großen Flußinsel bei Mabi wurde wieder genächtigt.
Am 23. November endlich fuhr die Pirogue vorbei an Nossa Senhora da Guya, an Boavista am Einfluß des Rio Içanna auf dem rechten Ufer; ferner an San Felipe rechts und an Santa Anna links, bis am Nachmittage San Joaquim de Coanne oder de Omagua am Einfluß des Rio Guape oder Waupes erreicht wurde.
Hier verließen unsere Freunde das Schiff und suchten sich eine Lagerstätte, um auch den folgenden Sonntag in San Joaquim zu verbringen.
Am Landungsplatz trat ihnen ein Indianer entgegen, fragend, ob die Herren einen Führer durch die Stadt und Umgegend brauchten. Diese Frage wurde zwar verneint, aber der Rote ließ sich nicht so leicht abweisen. »Felipe kennt die Pfade bis zum Orinoko und bis zum Amazonas; kein anderer wird die Sennores so gut und so billig führen!«
»Nanu, der Mensch könnte uns von Nutzen sein!« meinte Schulze auf deutsch.
»Er macht mir keinen günstigen Eindruck!« erwiderte Ulrich und wandte sich in spanischer Sprache an den Indianer: »Der Weg zum Amazonas am Rio Negro hinab und nach San Paulo am Strome hinauf ist nicht zu verfehlen!«
»O Sennores!« sagte der Indianer grinsend, »ihr werdet vier Monate brauchen zu einer Reise, die ihr in drei Wochen machen könntet, wenn ihr in gerader Linie durch die wildreichen Wälder über den Rio Japura und den Rio Iça wolltet. Doch der Pfad ist wenig bekannt; Felipe wird ihn euch führen.«
Schulze zog seine Karte zu Rat und fand, daß der Reiseweg hierdurch allerdings von 2500 auf 500 Kilometer verringert würde.
Die Aussicht auf eine so bedeutende Abkürzung der Reise brachte unsere Freunde zu dem Entschluß, sich dem Führer anzuvertrauen, zumal sie begierig waren, eine Gegend zu durchwandern, die noch keines Weißen Fuß betreten hatte. Sie sagten daher dem Indianer zu und ließen sich von ihm einen Gasthof weisen. Er versprach, am Montag in aller Frühe dorthin zu kommen.
Sie ahnten nicht, daß der schurkische Indianer von den Mestizen gedungen war; diese waren schon mehrere Tage zuvor in San Joaquim eingetroffen. Felipe, ein schlauer Spitzbube und guter Freund Don Joses, war von ihnen bestochen worden, die Reisenden bei ihrer Ankunft zu stellen und sich ihnen als Führer anzubieten. Er sollte sie in die gefährlichen Wildnisse zwischen dem Rio Negro und Rio Japura führen und sie dort dem Hungertode preisgeben, indem er sich heimlich mit den Maultieren und Mundvorräten entfernte, womöglich auch Unkas und Matatoa überreden, mit ihm durchzugehen.
San Joaquim de Omagua! Dieser Name hatte mit einem Male alle Erinnerungen an die alten Sagen vom Dorado in Friedrichs Phantasie wachgerufen. War nicht das Land der Omagua das fabelhafte Goldland gewesen, das Ursua zu suchen auszog, und an dem er achtlos vorüberfuhr?
Als er mit Ulrich und dem Professor abends auf der Veranda ihrer Wohnung zusammensaß, fing er davon an.
»Mumpitz!« lachte Schulze. »Weiß doch alle Welt, daß jenes El Dorado ein Märchenland ist wie die Seligen Inseln und anderes mehr.«
»Unser spanischer Führer, der uns bis zum Apure geleitete,« sagte Ulrich, »schwur darauf, daß es eine Goldstadt Manoa gäbe. El Dorado sei übrigens kein Land, sondern ein Kazike gewesen, der sich mit Goldstaub am ganzen Leibe vergoldete und daher von den Spaniern als El Dorado, das heißt ›der Vergoldete‹, bezeichnet wurde.«
»Na! wenn Sie mehr von der Geschichte wissen, so legen Sie nur man los, unterhaltend ist so etwas immer, und ich höre gern solchen Geschichten zu, wenn ich auch kein Wort davon glaube.«
»Leider weiß ich gar nichts weiter, als was eben dieser Manuel uns erzählt hat,« erwiderte Ulrich. »Mir waren seine Berichte ganz neu, und seine Erzählung hatte überdies mit dem fabelhaften Goldlande wenig zu tun; sie berichtete nur eingehender über den Aufstand der Marannonen unter Aguirre, von denen der Amazonenstrom seinen zweiten Namen Marannon hat.«
»Manuels Erzählungen waren auch mir größtenteils neu,« begann nun Friedrich wieder, »dagegen erinnere ich mich, öfters von anderen Fahrten zur Aufsuchung des Dorado gelesen zu haben, nämlich von den Goldfahrten der Deutschen.«
»Heda! Sie wollen doch wohl nicht sagen, daß unsere vernünftigen Landsleute wie die Spanier diesem Hirngespinste nachjagten? Wie wären überhaupt die Deutschen dazu gekommen? Das war doch alles vor Jahrhunderten, als Südamerika den Spaniern allein gehörte und eine deutsche Auswanderung nach der Neuen Welt überhaupt noch nicht stattfand.«
»Es liegt freilich weit zurück,« erwiderte Friedrich, »und dennoch haben Deutsche die abenteuerlichsten Fahrten nach dem Goldland der Omagua unternommen. Wenn Sie Lust haben, zu hören, was mir davon erinnerlich ist — — —«
»Na, denn man zu! Ich bin wirklich begierig, ordentlich gespannt. Wie zum Kuckuck sind denn die Deutschen dazu gekommen?«
»Das ging so zu: Die Eroberungen der Spanier gehörten zum Reiche Karls V., der bekanntlich deutscher Kaiser wurde. Dieser verbriefte dem Handelsherrn Welser in Augsburg, dem er viel Geld schuldig war, seine neuen Besitzungen im Norden Südamerikas, nämlich das Gebiet von Venezuela, das im Jahre 1499 von Ojeda entdeckt worden war, und wo Rodrigo de las Bastidas 1525, wenn ich mich recht entsinne, die Niederlassung Santa Marta gegründet hatte.
»Die Welser erhielten das Recht, einen Statthalter mit dem Titel Adelantado für die Provinz zu ernennen, die das Land zwischen Cabo de la Vela und Maracapana, dem heutigen Cumana, ohne bestimmte Grenze gegen Süden, umfassen sollte. Ebenso durften sie alle Widerstand leistenden Indianer zu Sklaven machen und durch ordnungsmäßige Vermittelung der Geistlichen auch Sklaven von den Eingeborenen kaufen. Zu solcher Vermittelung wurden ihnen zwei Mönche beigegeben, die den heuchlerischen Titel ›Beschützer der Indianer‹ erhielten.
»Der erste Statthalter der Welser war Ambros Dalfinger aus Ulm. Dieser begab sich mit vierhundert Mann und fünfzig Reitern nach Coro und gründete dort an Stelle der alten Stadt eine neue auf Felsen und Pfählen im Meer und nannte sie Venezuela, das heißt »Klein Venedig«, daher der spätere Name des ganzen Landes.
»Dalfinger, der schon von dem Goldland mit seinen unermeßlichen Schätzen gehört hatte, verließ bald die wenig einladende Sandküste und drang in das Innere vor. Er hatte etwa zweihundert Mann bei sich, dazu mehrere Hundert Indianersklaven, die gleich Lasttieren mit Gepäck und Lebensmitteln beladen waren und an kein Entlaufen denken konnten, da sie mittels Halsringen allesamt an einer langen Kette befestigt wurden. Brach einer zusammen, so schlug man ihm den Kopf ab, um sich die Mühe zu sparen, den Ring von der Kette zu lösen.
»Der Ruf von Dalfingers Unmenschlichkeit ging ihm voran, so daß die Einwohner des Landes vor ihm flüchteten; aber der Glanz ihres Goldgeschmeides verriet sie. Sie wurden teils niedergemetzelt, teils zu Sklaven gemacht und all ihrer Kostbarkeiten beraubt.
»Am Rio Lebrija, einem Nebenfluß des Magdalena, mußten sich die Abenteurer von Früchten und Insekten nähren, da ihnen die Lebensmittel ausgegangen waren. Von den Moskito gequält und vom Fieber verzehrt, von den giftigen Pfeilen der Indianer umschwirrt, starben viele dahin. Auf den Höhen des Gebirges, wo sie Nahrung und Gesundheit zu finden hofften, trafen sie kalte und kahle Gründe; dort mußten sie mit Schnecken ihr Leben fristen, und manch einer erfror über Nacht. ›Valle de Miseria‹ nannte Dalfinger die Gegend, aus der er fieberkrank mit den Resten seines Unternehmens zurückkehrte.
»Auf weiteren Zügen erbeutete Dalfinger viel Gold, Geschmeide, ja, ganze goldene Rüstungen. Er drang bis ins Tal von Chicanota in der Provinz Merida vor, das seither nach ihm ›Valle de Ambrosio‹ heißt; denn dort starb er, durch einen Pfeilschuß am Halse verwundet.
»Er war tapfer und trotzte allen Beschwerden, aber seine Habgier und Grausamkeit machten den Namen der Spanier, denn aus solchen bestanden seine Truppen, zum Entsetzen und Abscheu der Indianer.
»Georg Hohemut aus Speier, den die Spanier kurz Jorge de Espira nannten, wurde sein Nachfolger als Statthalter von Venezuela. Auch er beschloß, das Goldland zu erobern. Mit dreihundert Mann Fußvolk und hundert Reitern erreichte er 1536 den Orinoko, wo er Philipp von Hutten aus Birkenfeld traf, einen Verwandten der Welser und Vetter des Hans von Hutten, der durch die Hand des Herzogs Ulrich von Württemberg fiel. Dieser Hutten, den die Spanier Felipe de Ultre oder Urre nennen, war lediglich aus Reiselust nach Südamerika gekommen, um die Wunder des Landes Indien zu sehen. Er war ein ritterlicher, biederer und menschenfreundlicher Charakter und als Statthalter von Venezuela später der mildeste Herr, den die Provinz je gehabt hat. Bei ihm befand sich Franz Lebzelter aus Ulm.
»Hohemut drang, allen Hindernissen und Beschwerden zum Trotz, in Gegenden vor, die seit ihm kein Weißer mehr betrat, und immer weiter trieb ihn sein hoher Mut, er überschritt unwegsame Gebirge und durchschwamm reißende Ströme; weder Hunger noch Fieber hielten ihn auf. Die Jaguare der Llanos griffen bei lichtem Tage Pferde und Menschen an; aber die Hoffnung, das Goldland zu finden, trieb ihn bis zu den Waupesindianern und über den Äquator hinaus; allein als er am Rio Caqueta anlangte, wurde er durch den hartnäckigen Widerstand, den er fand, zur Umkehr gezwungen. Die Indianer hatten ihm allzugroße Verluste, namentlich an Offizieren, beigebracht. Das Goldland erreichte er nie; denn bald darauf ward er ermordet.
»Während Hohemut noch unterwegs war, brach sein Corregidor Nikolaus Federmann der Jüngere aus Ulm auf, um dem Statthalter Verstärkungen und Vorräte zu bringen. Von den Spaniern wurde er ›Capitan Barba Roxa‹ genannt, wegen seines langwallenden roten Bartes. Er war ein tapferer Held, von seinen Soldaten geliebt, obgleich er sie strenge davon abhielt, irgendwelche Grausamkeit an den Indianern zu verüben. Doch trieb ihn sein Ehrgeiz, absichtlich ein Zusammentreffen mit Hohemut zu vermeiden, um auf eigene Faust Entdeckungen zu machen.
»Er zog südwärts an den Anden hin und kam durch die Ruinen einer großen Stadt, von der gesagt wurde, sie sei vorzeiten von einer vielköpfigen Schlange zerstört worden, die sämtliche Einwohner aufgefressen habe.«
»Na! da haben wir wieder so ein Fabeltier,« lachte Schulze.
»Drei Jahre war Federmann unterwegs,« fuhr Friedrich fort, »als er endlich noch einen der schwierigsten Übergänge des viertausend Meter hohen Paramo de la Suma Paz überstieg und südlich von Santa Fe de Bogota auf der Hochebene von Neu-Granada anlangte. Hier erlebte er eine der merkwürdigsten Überraschungen, die je einem Menschen vorgekommen sein mögen. Der Zufall, wie man sagt, führte ein Ereignis herbei, wie es einzigartig in der Geschichte der Entdeckungsreisen dasteht.
»Auf der Hochebene von Neu-Granada, mitten in der unbekannten Wildnis, trafen nämlich drei europäische Heerhaufen zusammen, die, ohne etwas voneinander zu ahnen, von drei verschiedenen Punkten ausgezogen waren, das Goldland zu entdecken. Dies geschah im April 1539.
»Das eine dieser drei Heere war den Magdalena heraufgekommen und wurde geführt von Gonzalo Ximenes de Queseda, dem berühmten Konquistador, das heißt Eroberer, Neu-Granadas und von seinem Freunde Adelantado Pedro Fernandez Lugo; diese hatten das Land der Chibcha entdeckt, das eine noch höhere Kultur besaß als das so hochkultivierte Land der Azteken, und waren durch die Plünderung der Städte zu unschätzbarer Beute gelangt. Aus der einzigen Stadt Tunja brachten sie Gold und Silber im Werte von über einer Million Mark und beinahe zweitausend große Smaragden mit! Aber sie suchten noch reichere Goldländer, denn ihre Gier war unersättlich.
»Das andere Heer war unter Sebastian de Belalcazar von Quito ausgezogen, auf Befehl Franz Pizarros. Die Berichte eines Indianers namens Luis Daça aus Tacunda von den großen Schätzen des Zague oder Königs von Cundirumarca hatten Belalcazar schon früher veranlaßt, zwei Hauptleute, Annasco und Ampudia, auszusenden, um das Valle del Dorado zu suchen, das zwölf Tagereisen von Guallabamba liegen sollte.«
»Nein!« unterbrach hier Schulze den Erzähler. »Hören Sie einmal, ich verwundere mich schon lange im stillen, wie Sie so viele Daten und nun vollends alle die vertrackten Namen so auswendig behalten haben: die Schipkas, das erinnert ja wohl an den Schipkapaß und Belasazar an den König von Babylon, Konduiramurca, das ist so etwas wie Parsivals Gemahlin; aber nun gar die Stadt Tunica und Guallibaba! Das ist ja nicht menschenmöglich! Gestehen Sie nur, daß Sie die Namen sich so selber nach Bedarf geschwind zusammenstoppeln.«
Friedrich lachte über die Verketzerung, die die schönen Namen in Schulzes Gedächtnis erlitten, Ulrich aber antwortete: »Herr Professor, auf die Richtigkeit der Namen, die mein Bruder anführt, dürfen Sie sich verlassen; er hat stets ein ganz besonders zuverlässiges Gedächtnis für die absonderlichsten Namen gezeigt, und wir staunten ihn schon als sechsjährigen Knaben an, wenn er die ganze assyrische Königsreihe auswendig hersagte.«
»Das wäre!« meinte Schulze. »Na, lassen Sie sich einmal auf die Probe stellen! Wie heißen denn wohl die Neuseeländischen Inseln, he! junger Freund?«
»Te Wahi Punamu und Te Ika a Maui,« erwiderte Friedrich, ohne sich zu besinnen.
»Fabelhaft! Ich brauchte drei Wochen, um mir diese Namen dauernd einzuprägen; nun aber glaube ich an alle Namen, die ich von Ihnen hören werde. Also! was war weiter mit diesem Belsazar?«
»Die ausgesandten Hauptleute gelangten nicht zum Dorado, doch erhielten sie bestätigende Nachrichten aus dem Munde von Eingeborenen, und Diaz de Pineda, der in die Nähe des Rio Napo gelangte, brachte die Kunde, daß östlich von den Nevado von Tunguragua, Cayanbe und Popayan weite Ebenen lägen, reich an edlen Metallen; daselbst trügen die Eingeborenen Rüstungen aus gediegenem Gold.
»Belalcazar hatte auch von der Casa del Sol gehört, dem goldenen Sonnentempel, den Jorges de Espira, das heißt Hohemut, im volkreichen Dorfe Fragua gesehen hatte, woselbst er auch ein Jungfrauenkloster fand. Dazu kamen die Berichte von den Schätzen der Omagua, Guaype und Manoa, von den Goldlagunen und der Stadt des vergoldeten Königs, den man den großen Patiti, den großen Moxo, den großen Paru oder den großen Enim nannte, mit Vorliebe aber einfach El Dorado, den Vergoldeten.
»Von seiner Hauptstadt Manoa, am See gleichen Namens, wußte man Wunder zu erzählen: da spiegelten sich die Paläste aus lauterem Golde, mit gediegenen goldenen Platten gedeckt, im Spiegel des Sees, dessen Grund aus Gold und Edelsteinen bestand. Rubine, Smaragde, Saphire, Amethyste, Topase, Diamanten von fabelhafter Größe sollten die schweren goldenen und silbernen Götzenbilder in der Casa d'oro del Sol, dem Sonnentempel des Dorado, schmücken.
»Das alles berichtete Belalcazar dem Nikolaus Federmann; andere wußten noch hinzuzufügen, was Diego de Ordaz von den Indianern am Rio Meta erfahren hatte, von einem bekleideten Volke, das auf Lama reite und von einem mächtigen einäugigen Könige beherrscht werde, der fabelhafte Reichtümer an Gold und Edelsteinen besitze. Ordaz selber sah in den Händen der Eingeborenen faustgroße Smaragde, und sie erzählten ihm von einem Smaragdberge, der im Westen liege; das heißt von einem großen Felsen aus grünem Gestein. Ein Schiffbruch hatte aber der Expedition des Ordaz ein Ende bereitet, ehe er den Smaragdberg aufsuchen konnte.
»Diese Berichte entflammten die Lust der Conquistadoren, das Goldland zu entdecken; aber zwischen Queseda und Belalcazar erhob sich ein Streit, da jeder der Entdecker von Nueva-Granada sein wollte, während der eigentliche Entdecker Dalfinger war. Sie suchten beide durch große Angebote aus ihren erbeuteten Schätzen Federmann für sich zu gewinnen, und alle drei zogen schließlich in Gemeinschaft mit Lugo nach Spanien, um die Entscheidung des Königs anzurufen. Lugo starb unterwegs, und Federmann, den die Welser nicht in der Statthalterschaft von Venezuela bestätigen wollten, erlag in Europa dem Gram über diese Enttäuschung, nachdem er seine ›Indianische Historia‹ geschrieben hatte.
»Hermann Fernandez Queseda, der Bruder des Konquistadors, war von diesem als sein Stellvertreter in Bogota zurückgeblieben. Die Habgier aber ließ ihm keine Ruhe, und auch er zog alsbald aus, das Goldland zu suchen. Um aber das Land unbesorgt und in Sicherheit zurücklassen zu können, ließ er zuvor den ihm stets freundlich gesinnten jungen Kaziken der Chibcha nebst vielen anderen Häuptlingen grausam ermorden!
»Er gelangte in das Land der hochzivilisierten Muzoindianer; in den Llanos aber überfiel ihn eine fürchterliche Hungersnot: alle Pferde mußten aufgezehrt werden, und Queseda sah sich genötigt, unverrichteter Sache umzukehren, nachdem er den größten Teil seiner Mannschaft auf diesem unheilvollen Zuge eingebüßt hatte.
»Der zum Statthalter von Venezuela ernannte Bischof Don Rodrigo de las Bastidas rüstete inzwischen einen neuen Zug zur Aufsuchung El Dorados aus und stellte ihn unter den Befehl Philipps von Hutten.
»Hutten erfuhr unterwegs von Quesedas Unternehmen und wollte mit diesem zusammentreffen. Vergeblich warnten ihn die Indianer am Rio Papamene, er werde in wüste Gegenden kommen, wo er unter Krankheit und Hunger zu leiden haben würde. Dagegen erboten sie sich, ihn in ein reiches Goldland zu führen, dessen Hauptstadt Macotoa am Rio Guaviare liege. Sie wiesen ihm Äpfel aus gediegenem Gold und Silber, die von dort stammten. Hutten aber traute den Indianern nicht und folgte Quesedas Spuren.
»Bald mußte er zu seinem Schaden erfahren, daß die Indianer die Wahrheit gesagt hatten: Hunger und Krankheit wüteten unter seinen Leuten; man fand nichts als Früchte, die man nicht genießen konnte, ohne daß einem darauf die Haare ausfielen; die Pferde verendeten überdies an den seltsamen Giftfrüchten. Schließlich mußte man sich von Ameisen nähren.
»Ein volles Jahr irrte er in den Steppen, die seither kein Europäer mehr betreten hat, im Kreise umher, und gelangte endlich wieder an den Rio Papamene.
»Doch sein Mut und seine Unternehmungslust waren nicht gebrochen. Nun wollte er die Goldstadt Macotoa aufsuchen. Nach einem langen, beschwerlichen Marsch erreichte er den Rio Guaviare; dort traf er Indianer, die versicherten, Macotoa sei nicht mehr fern. Er sandte sie als Boten zum Kaziken, dessen eigener Sohn nach einigen Tagen erschien und die Spanier auf fünf Piroguen über den Fluß setzte, um sie in eine Stadt mit wohlgebauten Häusern, breiten, geraden Straßen und großen offenen Plätzen zu führen.
»Der Kazike nahm sie gastfreundlich auf und versorgte sie aufs reichlichste mit Kassave, Wildbret, Fischen, Mais und Früchten.
»Die Stadt Macotoa zählte etwa achthundert Einwohner, und der Häuptling der dort seßhaften Waupesindianer war ein vierzigjähriger, freundlicher und wohlwollender Mann von schönen Gesichtszügen, mit einer mächtigen Adlernase. Er belehrte Hutten, das eigentliche Goldland liege weiter gegen Mittag und sei von den kriegerischen Omagua bewohnt, die unermeßliche Schätze an Gold und Silber besäßen. Zugleich warnte er ihn ernstlich, sich dorthin zu begeben, wo er mit seiner kleinen Schar sicherlich aufgerieben würde.
»Hutten ließ sich aber sein Vorhaben nicht ausreden; und der gutmütige Kazike versah ihn mit Führern und reichlichen Mundvorräten.
»So zog denn Hutten weiter in das Land zwischen dem Rio Guaviare und dem Rio Japura; mit dem Guaviare ist übrigens, wie ich vermute, der Rio Ucayari gemeint, der auch Rio de los Waupes heißt. Nach fünf Tagen langte die kleine Schar auf einer Anhöhe an, von der aus ganz in der Nähe eine Stadt zu erblicken war, so groß, daß ihre Grenzen nicht abzusehen waren. Ihre Straßen waren lang und breit, die Häuser in Zeilen aneinandergereiht, und in der Mitte erhob sich ein mächtiges Gebäude, das nach Aussagen der Waupesführer der Palast des Omaguakaziken Guarica war, zugleich auch der Haupttempel, der eine Menge gediegen goldener Götterbilder von großer Kunst enthalte. Weiter im Lande seien noch viel größere und reichere Städte als diese hier zu finden.
»Obgleich er nur neununddreißig Mann bei sich hatte, stürmte Hutten in die Riesenstadt hinab; doch die Omagua rückten, nach Huttens Angaben etwa fünfzehntausend Mann hoch, mit Trommelschlag und Kriegsgeschrei ihnen entgegen, so daß sie weichen mußten und Hutten schwerverwundet nur mit Mühe in einer Hängematte in den nahen Wald gerettet werden konnte.
»Der Lagerkommandant Limpias sammelte hier seine Leute und schlug die Verfolger zurück, und die Spanier erreichten wieder Macotoa, wo der freundliche Kazike Huttens Wunde heilte.
»Hutten kehrte nach Coro zurück, wo er und sein Begleiter auf Befehl des rohen Soldaten Juan de Caravajal, der sich inzwischen der Regierung Venezuelas bemächtigt hatte, ermordet wurden. Die Grausamkeiten dieses Verräters veranlaßten Kaiser Karl V., einen Untersuchungskommissar nach Venezuela zu senden, der Caravajal hängen ließ.
»Den Welsern oder Belzares, wie die Spanier sie nannten, wurde acht Jahre darauf, 1554, ihre Vollmacht entzogen. Unter der deutschen Herrschaft, die allerdings meist von Spaniern ausgeübt wurde, war Venezuela eine der unseligsten Provinzen der Neuen Welt.«
»Das kommt vom Tropenkoller,« meinte Schulze, »der die meisten Europäer überfällt, wo sie eine unbeschränkte Macht über wehrlose Geschöpfe ausüben können und keine Aufsicht in der Nähe haben, so daß sie nicht befürchten, zur Rechenschaft gezogen zu werden. — Aber was ist's mit dem Dorado? Seither hat man nichts mehr von ihm gewollt?«
»O doch! In die Gegend, wo Hutten die große Stadt der Omagua sah, ist freilich niemals mehr ein Europäer gekommen: merkwürdigerweise wurde plötzlich das Goldland in einer ganz andern Richtung gesucht, nämlich in Guayana, während man doch bisher so bestimmte Nachrichten über seine Lage gehabt hatte und ihm allem nach ziemlich nahe gekommen war!
»Man suchte jetzt einen See Cassipa und eine Lagune Parime: das sollte ein weißes Meer sein, das den Orinoko, den Rio Branco und den Rio Essequebo speise. Dort sollte sich ein ganzer Goldberg befinden. Sir Walter Raleigh ist besonders dieser Fährte nachgegangen.
»Auch in Mexiko suchte man ein Goldland, die Königreiche Cibola und Quivira, von denen der Mönch Marco de Nizza berichtete, der auch von ferne die goldenen Dächer einer großen Stadt gesehen haben wollte. Dort sollten die Einwohner ungeheure Hunde haben, die sie als Lasttiere benutzten, und an den Küsten sehe man reiche Schiffe landen, beladen mit Waren aus Catayo, das heißt China.«
»Sie sehen wohl,« sagte Schulze lachend, »das Gespenst des Dorado irrlichtert überall umher; die Berichte der Reisenden erinnern an die Märchen und Sagen von Sindbad, dem Seefahrer, und von Herzog Ernst: denken Sie an das Diamantental und den Vogel Roch, an den Magnetberg, an Atlantis und die Hesperischen Inseln, endlich an Ophir und die übertriebenen Sagen von den Reichtümern Indiens.«
»Nun,« entgegnete Friedrich, »an den meisten dieser vermeintlichen Sagen ist doch viel Wahres: Indiens Schätze, die England reich gemacht haben, waren keine Fabel, Ophir hat bestanden und wäre wohl heute noch zu finden; Atlantis kann nicht als Märchen nachgewiesen werden, Diamantenfelder gibt es heute noch in Südafrika, und der Vogel Roch, wenn er nicht in den Wäldern Madagaskars noch lebt, kann doch erst im vergangenen Jahrhundert ausgestorben sein, nach den Funden von nicht gar alten und wohlerhaltenen Rieseneiern zu schließen.
»Ebenso sind die reichen Goldschätze der Inka und Azteken geschichtliche Tatsachen: alle westlichen Zuflüsse des Orinoko führen Gold von den Kordilleren her; es muß reiche Goldländer in diesen Gegenden geben. Überdies versichern die ersten Doradosucher, die Eingeborenen hätten ihnen eine Provinz ›Caricuri‹ als das Goldland bezeichnet: nun hat man entdeckt, daß dieses Wort im Tamanakischen wirklich ›Gold‹ bedeutet, im Karaibischen heißt es Carucuru. Das ist doch wieder ein Beweis für die Zuverlässigkeit der Angaben jener Abenteurer, die ja die Bedeutung des Wortes Caricuri nicht kannten.
»Die Nachrichten über ein ganz besonders reiches Goldland der Omagua und über die Stadt Manoa lauteten bei den entferntestliegenden Indianerstämmen so bestimmt und übereinstimmend, alle verlegten das Land in die gleiche Gegend — das ist doch auch wieder ein gewichtiges Zeugnis. Was Hutten gesehen haben will, läßt sich nicht abstreiten, ehe die Gegend zwischen dem Japura und dem Waupes erforscht ist. Philipp von Hutten war übrigens ein edler, durchaus nüchterner und glaubwürdiger Mann. Der Padre Fritz in der Mission Yurimaguas erhielt noch im siebzehnten Jahrhundert Goldbleche von den Manoa, den Nachbarn der Omagua; — kurz und gut, ehe nicht das ganze Gebiet bekannt ist, um das es sich hier handeln kann, wird es als eine unbegründete Voreiligkeit gelten müssen, die ganze Geschichte als Fabel anzusehen.«
»O, Sie idealer Träumer!« lachte Schulze. »Am Ende keilen Sie uns auch noch zu einer El-Dorado-Fahrt! Indessen danke ich Ihnen für Ihren ausführlichen Vortrag: er war mir interessant und hat mich über vieles belehrt, das mir völlig neu war — man lernt eben nie aus!«
»So geht es mir auch,« bestätigte Ulrich, »aber so schön der Aufenthalt auf der Veranda hier ist, so gedenke ich mich doch jetzt zur Ruhe zu begeben: morgen ist auch noch ein Tag.«
»Da haben Sie recht. Aber der Abend war wirklich angenehm: ich hätte nicht geglaubt, daß wir hier, unmittelbar unter dem Äquator, eine so wohltuende Frische finden könnten.«
Damit zogen sich alle zurück, um ihre Schlafstätten aufzusuchen. Friedrich aber träumte von der Goldstadt Manoa und ihrem geheimnisvollen See, von dem vergoldeten Priesterkönig El Dorado und den Wundern des Landes der Omagua.
ALS unsere Freunde am frühen Morgen des 25. Novembers mit ihrem neuen Führer San Joaquim verließen, sagte Schulze feierlich: »Meine Herren, es ist ein großer Augenblick, ein wissenschaftliches und besonders geographisch bedeutsames Ereignis — nicht etwa, daß wir den Äquator überschritten haben und die südliche Halbkugel betreten, was schon Unzählige vor uns getan haben, sondern daß wir von San Joaquim in südwestlicher Richtung geradeswegs gegen San Paulo de Olivença vordringen und somit eine Gegend durchziehen, die überhaupt von einem Weißen noch nie betreten wurde. In diesen Ländern folgten die Europäer stets den Flußläufen, und nur Männer wie Hutten und Queseda wagten, sie zu verlassen. Ein solches Wagnis aber war mit tausend Gefahren und Schrecknissen verbunden. Nun, dank unsern guten Instrumenten werden wir nicht befürchten müssen, wie Hutten monatelang in der Irre zu gehen, vielmehr dürften wir, wenn nicht besondere Hindernisse eintreten, in neun bis zehn Tagen den Rio Japura erreichen, wenn wir auch nur dreißig Kilometer täglich zurücklegen und zwei volle Rasttage halten. Zwischen hier und diesem Flusse aber ist alles unerforschtes Gebiet, und ebenso unbekannt ist wiederum der ziemlich schmälere Landstreifen zwischen dem Japura und dem Rio Iça. Ich fürchte keine großen Schrecknisse, erwarte auch keine seltsamen Abenteuer, aber mein Herz schwillt in dem Bewußtsein, daß wir eine wissenschaftliche Tat vollführen, und auf alle Fälle die Erdkunde bereichern werden.«
»Und mir schweben große Gefahren vor Augen,« sagte Ulrich, »die uns in diesen Wildnissen erwarten, auf die ich mich aber freue, statt sie zu fürchten.«
»Und ich,« erklärte Friedrich seinerseits, »bin voller Erwartung der wunderbaren Abenteuer, die uns bevorstehen, und an denen ich nicht zweifle.«
Die beiden Brüder sollten mit ihren Ahnungen recht behalten. Vorerst freilich schien die Reise ohne alle Hindernisse vonstatten gehen zu sollen: der Weg führte durch eine baumlose Savanne, die dürr und tot, wie ausgestorben, dalag: kein Vogel ließ sich vernehmen, kein Käfer schwirrte, kein Wild regte sich, und kein Bächlein plätscherte durch den ausgebrannten Grund.
Bald aber sollte ein verhängnisvoller Unfall die Reisenden aus ihrer Sicherheit aufschrecken: sie strebten einem Wäldchen zu, das sich vor ihnen erhob, und als sie es erreicht hatten, sahen sie, daß es die Ufer eines Nebenflusses des Rio Negro säumte. Der Fluß war tief und schwer zu durchwaten: doch kamen alle glücklich hinüber, bis auf Matatoa, der auf dem letzten Maultier saß. Ein riesiges Krokodil tauchte plötzlich auf und verbiß sich im Schenkel des Maultiers. Matatoa sprang rasch mit beiden Füßen auf den Rücken seines Tieres und erreichte von da aus mit einem mächtigen Satz das Ufer. Gleichzeitig zischte aber aus den Zweigen eines überhängenden Baumes eine gewaltige Riesenschlange herab, die, unbekümmert um das Krokodil, dem Maultier ihre mächtigen Ringe um dem Leib schlang.
Dem Kaiman schien dies nicht zu passen, er ließ das Tier los, dem er ein großes Stück Fleisch aus dem Leibe gerissen hatte, und schnappte nach der Boa constrictor, die sich unter seinen scharfen Zähnen wand und sich alsbald um den gepanzerten Feind wickelte, ihn zu zermalmen. Der Biß des Krokodils hatte jedoch die Schlange so schwer verwundet, daß ihr diese Absicht nicht mehr gelang; sie fiel kraftlos ins Wasser, in das auch das zerfleischte Maultier gesunken war.

Nun machte sich der Kaiman zunächst über die Schlange her, zwei wohlgezielte Kugeln aber aus Ulrichs und Friedrichs Magazingewehren bereiteten auch seiner Rachelust ein jähes Ende.
Hatten die jungen Schützen gehofft, wenigstens die Ballen zu retten, die das Maultier trug, da es schon selber im Verenden lag, so hatten sie sich getäuscht: das Blut, das sich mit dem Wasser des Flusses mengte, zog in einem Augenblick Dutzende von Krokodilen an, die wie geschlossene Heerscharen, dicht aneinander gedrängt, sowohl das Maultier als auch die tote Boa und ihren eigenen erlegten Gefährten wütend anfielen und in wenigen Minuten vollständig zerrissen und verschlungen hatten.
Dieses grausige Schauspiel zeigte den entsetzten Zuschauern, welch schrecklicher Gefahr sie selber glücklich entgangen waren; sie beeilten sich, diesen unbehaglichen Ort zu verlassen, und bald nahm sie aufs neue die Savanne auf.
Wieder war kein Baum mehr zu sehen, alles bot den traurigen Anblick einer Wüste. Der Verlust des Maultieres ließ sich verschmerzen; aber unglücklicherweise war es eben dasjenige gewesen, dem fast sämtliche Lebensmittel aufgeladen waren, und da vorerst keine Aussicht vorhanden schien, die Vorräte irgend zu erneuern, war die Lage der Reisenden keine unbedenkliche. Zu spät nahmen sie sich vor, ein andermal die Mundvorräte auf alle Tiere zu verteilen: die augenblickliche Not konnte durch diesen weisen Entschluß nicht mehr gehoben werden.
Der neue Führer, Felipe, verhielt sich äußerst schweigsam. Ulrich hielt ihm vor, daß er versichert habe, die Gegend sei wildreich. Der verdächtige Geselle erwiderte nur: »Morgen werden wir die Wälder erreichen, die von Tieren wimmeln.«
Unkas und Matatoa, die von Anfang an kaum dazu zu bewegen gewesen waren, von San Joaquim noch weiter in ein unbekanntes Gebiet zu gehen, von dem sie unterwegs unheimliche Dinge gehört hatten, verlangten nun ernstlich und dringend zurück; dazu aber mochten sich weder Schulze noch seine jungen Gefährten entschließen: »Jetzt sind wir im Begriffe, Großes zu leisten,« sagte der Professor, »kehren wir um, und wäre es nur, um uns wieder mit Lebensmitteln zu versehen, so dürfen wir uns darauf gefaßt machen, daß uns die feigen Indianer unter keinen Umständen mehr weiter nach Süden folgen. Ob wir neue Diener anwerben könnten, ist sehr fraglich, und es wäre höchst bedenklich, bei einer Reise durch ganz unbekannte Landstriche fremde Leute mitzunehmen, von denen man nicht weiß, wie weit man sich auf sie verlassen kann. Ohne indianische Begleitung möchte ich aber auch nicht das Wagnis unternehmen. Was übrigens unsern schweigsamen Führer betrifft, so kommt er mir immer unheimlicher vor.«
Abends erreichte man endlich wieder den Saum eines Urwaldes. Da aber unsere Freunde nicht wußten, was für Gefahren er möglicherweise für sie barg, übernachteten sie auf Rat des Führers in den Llanos, wo weder wilde Tiere noch giftige Schlangen sie bedrohten, wie sie zur Genüge erfahren hatten. Im Walde, versicherte Felipe, würden sie Wild und eßbare Früchte in Menge finden.
Wer beschreibt aber den Schrecken der Betrogenen, als sie am andern Morgen entdecken mußten, daß ihr verräterischer Führer mitsamt Matatoa sie verlassen hatte. Eines der Maultiere hatten die beiden mitgenommen und ihm alle noch übrigen Lebensmittelvorräte aufgeladen: das war ein Umstand, der für die Reisenden geradezu lebensgefährlich werden konnte; dennoch ließen sie den Mut nicht sinken; denn sie bauten fest darauf, daß ihnen der nahe Wald Wild und Früchte zur Nahrung bieten werde. Ein großes Glück war es nur, daß die Schurken nicht auch die reichen Munitionsvorräte geraubt hatten, die in San Joaquim angeschafft worden waren.
Unkas zeigte eine ehrliche Entrüstung über seines Landsmanns Verrat: »Matatoa hat die Seele eines Hundes,« rief er aus. »Unkas hat ihm nie recht getraut, und Felipe war ein Sohn Jolokiamos, des Satans, und hatte die Zunge einer Schlange. Er wollte auch Unkas überreden, den weißen Männern nicht weiter zu folgen, und Unkas' Herz wurde beinahe verzagt, als der Hund ihm vorstellte, was für Schrecknisse die unbekannte Wildnis berge, und daß sie zum Lande der Amazonen führe, die alle Männer, die ihren Grenzen nahen, mit ihren giftigen Pfeilen erschießen und nur einen Monat im Jahre Männer unter sich dulden. Aber Unkas glaubte nicht, daß es ihm ernst sei, er meinte, der Heuchler wolle ihn nur ängstlich machen, um ihn hernach auszulachen. Aber nun hat er Matatoa verführt, den Sohn eines Hundes. Unkas wird jedoch seinen guten weißen Herren folgen bis ans Ende der Welt und keine Gefahren fürchten, denen seine weißen Brüder, die er lieb hat und bewundert, zu trotzen entschlossen sind!«
Unkas hielt denn auch sein Versprechen getreulich.
Eine große Enttäuschung sollte den ausgehungerten Reitern der Urwald, den sie nun betraten, bereiten: keine Spur von Wild zeigte sich, alles war stumm und ausgestorben. Endlich fanden sich wenigstens einige fruchttragende Bäume, und Friedrich sandte die hierzu wohl abgerichteten Affen hinauf: diese zeigten jedoch einen großen Widerwillen, die Früchte zu berühren, und nur auf wiederholte ermunternde und drohende Rufe hin warfen sie einige herab.
Unkas, dem das Benehmen der Affen sofort auffiel, warnte die Weißen vor dem Genusse der völlig unbekannten und seltsam geformten Früchte. Er sagte, er habe viel gehört von den schrecklichen Folgen, die der Genuß von giftigen Früchten in diesen Gegenden mit sich bringe. In der Tat waren die Äffchen trotz ihres Hungers nicht dazu zu bewegen, die verdächtigen Dinger zu kosten, und ein Maultier, das davon fraß, verendete bald darauf, nachdem ihm alle Haare ausgefallen waren. Damit waren die Reisenden der Hälfte ihrer Lasttiere beraubt.
Immer quälender wurden Hunger und Durst, und es zeigte sich keine Aussicht, sie zu stillen. An eine Umkehr war indes nicht mehr zu denken, da die Wüste hinter ihnen keine Lebensmittel bot und unsere Freunde sich zum Schlachten der Maultiere nur im äußersten Notfalle entschließen wollten.
Plötzlich stieß Unkas einen Freudenruf aus: er hatte einen gewaltigen Ameisenhaufen entdeckt, der von großen Ameisen wimmelte; nicht weit davon sah man noch mehrere solcher Haufen.
»Jetzt haben wir Nahrung genug,« versicherte Unkas, »das sind Bachaco.«
Schulze bestätigte, daß der große Fettknopf, in den der Hinterleib der Ameisen endigte, für sehr nahrhaft gelte, und daß sich in manchen Gegenden die Indianer von nichts anderem nährten.
Auch eine Palme, die sich in der Nähe befand, erregte Unkas' Aufmerksamkeit, und er nickte befriedigt, nachdem er mit seinem Beil ein Stück vom Stamme gehauen und gekostet hatte.
Obgleich unsere Freunde vor dem Verspeisen von Ameisen nicht geringen Abscheu empfanden, so trieb sie doch der Hunger dazu, diese Tiere in Massen einzusammeln.
Unkas hatte auch einen Marimabaum entdeckt, den sogenannten »Hemdbaum«, diesen fällte er und löste zylindrische Stücke der roten faserigen Rinde ab, die er über den Stamm herabstreifte, so daß sie in Form von Röhren gewonnen wurden. Solche Stücke werden von den Indianern mit Armlöchern versehen und als Hemden angezogen, wenn es stark regnet; denn das dichte Gewebe schützt vollständig vor Nässe. Nimmt man noch dazu die spitzen Mützen, die sie aus den weitmaschigen Blumenscheiden gewisser Palmenarten schneiden, so kann man sagen, daß auch vollständige Anzüge auf den Palmen der Tropen wachsen.
Unkas dachte aber nicht an eine solche Verwendung der von ihm geschnittenen »Hemden«, vielmehr verfertigte er Säcke daraus, indem er die untere Öffnung der Röhren zunähte; als Faden diente ihm Palmbast, als Nadel ein Dorn, ebenfalls von einer Palme. Die Säcke, die er auf diese Art herstellte, dienten zunächst zur Aufnahme der gesammelten Bachaco und sodann zum Trocknen und Räuchern derselben über einem rasch entzündeten Feuer.
Während dieser Zubereitung nahm Unkas eine reichliche Menge vom Marke der zuerst entdeckten Palme, das er ebenfalls am Feuer gedörrt hatte, zerrieb es zu Mehl und mischte es mit zerquetschten Ameisen zu einem dicken Teig, aus dem er Kuchen formte.
Als er damit fertig war, rief er zum leckeren Mahle: »Hier! eine vorzügliche Ameisenpaste!« sagte er, mit der Zunge schnalzend, indem er jedem einen fetten Kuchen zuschob.
Mit etwas Selbstüberwindung ließen sich denn die Deutschen das seltsame Mittagessen schmecken und fanden es, wenn nicht gerade besonders wohlschmeckend, doch recht hungerstillend. Mehrere Marimasäcke, zum Teil mit geräucherten Ameisen vollgestopft, zum Teil mit gedörrtem Palmenmark gefüllt, wurden den drei Maultieren aufgeladen. Immer undurchdringlicher wurde der Urwald, und das Vorwärtskommen war nur ganz langsam möglich; denn in einem fort mußte mit Beilen und Messern ein Weg durch Gestrüpp und Schlinggewächse gebahnt werden; an ein Reiten war schon lange nicht mehr zu denken. Wenn alles gut ging, konnte doch der Japura auf diese Weise frühestens in drei Wochen erreicht werden, statt in neun bis zehn Tagen, wie Schulze anfangs gemeint hatte.
Abends wurde nochmals eine »gute Ameisenpaste« bereitet und verzehrt, und dann gab man sich im leblosen, schweigsamen Urwald dem Schlafe hin.
Der Charakter des Urwaldes änderte sich auch am nächsten Tage nicht: immer Totenstille, kein Leben, keine Bewegung — es fing an, unheimlich zu werden, und unsere Freunde hätten das Gebrüll eines Jaguars und das Zischen einer Giftschlange wie eine Wohltat empfunden. Immerhin diente es zur Beruhigung, daß man wenigstens keine Gefahren zu fürchten hatte. Sehr lästig war es hingegen, daß eben nur immer schrittweise vorgedrungen werden konnte. So ging es volle zwei Wochen fort, während der Ameisenkuchen die einzige Nahrung bildeten. Trotz der kurzen Tagmärsche war die hindernisreiche Wanderung bei solch schlechter Kost sehr ermüdend, und es mußte hier und da auch an einem Wochentage Rasttag gehalten werden.
»Hurra!« rief Ulrich eines Tages plötzlich aus. »Da habe ich einen Pfad entdeckt; nun werden wir wohl bequemer als bisher vorwärtskommen.«
Alle eilten herzu und sahen wirklich einen ziemlich breiten Fußweg, ähnlich den Indianerpfaden, die im Urwald da und dort angelegt sind. Ganz auffallend war es, wie peinlich sauber diese Bahn gehalten war: kein Grashälmchen wuchs darauf.
Schulze betrachtete aufmerksam den mehr als ein Meter breiten Weg und lachte plötzlich hell auf: »Da haben wir's! Das ist kein von Menschenhand gebahnter Pfad!«
Verwundert schauten ihn Ulrich und Friedrich an, und dieser sagte: »Oho, Herr Professor! Ist diese schöne Straße etwa lediglich infolge eines Naturgesetzes von selber entstanden, oder beginnen Sie an Feen und Geister des Urwalds zu glauben«?«
»Na! eher das erstere! Sehen Sie einmal da hin! — Nun, was sagen Sie?«
»Ja, wahrhaftig!« rief Ulrich. »Das scheint ja eine Auswanderung von Kleeblättern zu sein!«
In der Tat sah man auf dem Boden einen langen, breiten Zug groschengroßer Blattstücke, die sich unaufhörlich in einer Richtung fortbewegten. Friedrich erfaßte solch ein Blättchen, und als er es emporhob, sah er, daß eine hellbraune Ameise mit unverhältnismäßig großem, herzförmigem Kopfe das Blatt krampfhaft mit den Kiefern festhielt, so daß sie damit emporgezogen wurde.
»Wir haben hier einen Pfad der Blattschneideameisen,« erklärte Schulze. »Schon mancher Unkundige hat sich im Urwald durch solch eine Straße vom rechten Weg ablenken lassen, denn die Indianerpfade sind weder breiter noch schöner instand gehalten. Dieser ganze grüne Zug besteht aus Milliarden dieser Ameisen, deren jede den Körper mit einem rund abgenagten Blattstück bedeckt hält. Der große Naturforscher Belt hat beobachtet, daß die Ameisen diese Blätter verwesen lassen, um Pilze darauf zu züchten, von denen sie sich nähren. Natürlich schenkte die Wissenschaft solch einem abenteuerlichen Vorgeben keinen Glauben und war der Ansicht, daß die Blätter zum Bauen verwendet werden.«
»Fabelhaft festes und dauerhaftes Baumaterial!« spottete Ulrich.
»Stimmt!« rief lachend der Professor. »Aber was wollen Sie? Pilzezüchtende Ameisen, das klang zu wunderbar. Allein Belt hat doch recht behalten: alle späteren Forscher fanden seine Beobachtung bestätigt.
»Jetzt schauen Sie einmal da her! So weit man blicken kann, führt ein bedeckter Gang aus Erde an diesem Baumstamme hinauf. Das ist ein Tunnel der Blattschneideameisen. Der Baum ist, wie Sie sehen, beinahe entlaubt, und ohne die üppige Zeugungskraft der Tropen würden diese Ameisen den ganzen Urwald vernichten bis auf einzelne Baumarten wie die Akazien, die durch eine besondere, sehr kriegerische Ameisenart gegen die Angriffe der Blattschneider verteidigt werden.«
Mit hohem Interesse beobachteten unsere Freunde das Treiben dieser merkwürdigen Insekten, und namentlich belustigte es sie, regelrechte Reitzüge zu entdecken, nämlich Arbeiterameisen, die auf andern spazieren ritten!
Der Ameisenpfad führte leider kaum einen Kilometer weit, dann ging es wieder durch ungebahnten Urwald.
Erst am Montag, den 9. Dezember, zeigte sich im Walde eine etwas lichtere Stelle, durch die ein Bach hindurchrieselte. Das Wasser gab den Wanderern einige Hoffnung, daß in der Nähe eßbare Früchte zu finden sein möchten, und daß sich vielleicht auch einiges Wild hier aufhalte.
Nicht weit vom Bache fand sich eine Gruppe schlanker Bäume mit sehr dünnen weißen Stämmen, die man für junge Kirschbäume hätte halten können, wären sie nicht so außerordentlich hoch gewesen.
Dogaressa, das Witwenäffchen, sprang plötzlich an einem dieser Bäume hinauf, gefolgt von Bambino, dem Titi. Alsbald erscholl aus den Zweigen ein klägliches Gekreisch: Aï-ï, aï-aï! so schrill und unangenehm, daß Schulze sich beide Ohren zuhielt, von denen er bei dieser Gelegenheit behauptete, sie hätten ein äußerst feines musikalisches Gehör.
»Aï-aï!« rief Unkas mit aufleuchtenden Augen und ergriff sein Beil, mit dem er in kurzer Zeit den Baum so weit anhieb, daß er sich neigte und langsam zu Boden senkte.
Nun sahen die erstaunten Europäer zwei seltsame Geschöpfe, die mit ihren langen gebogenen Krallen einen Ast umklammert hielten, den sie offenbar nicht loslassen mochten. Immer schrien sie: Aï-aï! ließen aber im übrigen ruhig ihr Schicksal über sich ergehen. Es waren Tiere von der Größe einer Hauskatze; ihr langes, grobes herunterhängendes Haar hatte eine dunkle, graugrüne Färbung, und über den Rücken zog sich ein Strich von schmutzigem Rotgelb.
Der kleine runde Kopf mit dem flachen Gesicht war noch menschenähnlicher als der eines Affen.
»Das sind Faultiere,« bemerkte Schulze, »und ich begreife jetzt, mit welchem Recht man sagt, ihr Geschrei sei ihr bestes Verteidigungsmittel. Großmächtiger Sebastian Bach! ich wollte doch noch lieber einen Schusterjungen eine verstimmte Violine bearbeiten hören: da heißt es ja wahrhaftig ›Jetzt weicht, jetzt flieht, jetzt weicht, jetzt flieht mit Zittern und Zähnegefletsch!‹«
Unkas aber dachte an keine Flucht, in aller Seelenruhe hieb er den Ast ab, an dem die Faultiere hingen, und trug ihn mitsamt den sich noch immer festklammernden Tieren auf eine kleine Lichtung.
»Warum entfliehen denn die Bestien nicht?« fragte Ulrich verwundert.
Schulze antwortete: »Erstens sind sie zu faul dazu, zweitens können sie sich auf dem Boden kaum fortbewegen. Aber einen guten Braten sollen sie liefern: das ist eine herrliche Aussicht nach den vielen Bachacopasteten!«
Unkas machte ein Feuer an, schlachtete und briet die Aï-aï, und in der Tat, der Mittagsbraten war köstlich. Der Rest des Fleisches wurde vorsorglich mitgenommen: er sollte noch bis morgen reichen. Die Weißen aßen nur Palmenmark zum Fleische, Unkas aber verzichtete nicht auf die Zutat von Ameisen, die ihm ein Leckerbissen waren.
AUCH am folgenden Tage stellte der weglose Urwald dem Vordringen noch die größten Hindernisse entgegen. Erst am 11. Dezember ging der Marsch etwas leichter vonstatten; es machte da und dort den Eindruck, als seien von Menschenhand Pfade durch den Wald gebahnt.
Auf einmal blieb Ulrich, der voranschritt, stehen, bückte sich und hob einen Gegenstand von der Erde auf, den er lange betrachtete. »Sollte das ein Smaragd sein?« fragte er, indem er einen apfelgroßen grünen Stein von herrlichem Schimmer, an den Rändern durchscheinend, dem Professor hinüberreichte.
»Holla!« sagte dieser. »Smaragd ist es gerade nicht, aber ein echter Amazonenstein; es ist der seltene Saussurit, der eigentliche Nephritstein, von dem gefabelt wird, er sei nur im Lande der Amazonen zu finden. Der Aberglaube schreibt diesen Steinen merkwürdige Schutz- und Heilkräfte zu, weshalb sie zu Amuletten viel begehrt und mit hohen Preisen bezahlt werden. Man trägt sie dann am Hals zum Schutze gegen Nervenleiden, Fieber und die Wirkungen giftiger Schlangenbisse.«
»Wenn ein solcher Handel damit getrieben wird, so muß es doch noch andere Fundorte dieser Steine geben außer dem Amazonenlande?« meinte Friedrich neugierig.
»Das ist eben das Merkwürdige,« erwiderte Schulze. »Kein Mensch hat bisher solche Steine in der Natur gefunden; sie gehen von Hand zu Hand, und man erhandelt sie von Eingeborenen, ohne je ihre Fundorte entdeckt zu haben. Die Indianer, in deren Besitz man sie vorfindet, behaupten aber samt und sonders, die Steine kämen aus dem Lande der Aikeambenano, das heißt der Weiber ohne Männer oder Amazonen, so zäh hängen diese Wilden an ihren Volkssagen!«
»Das ist freilich sonderbar,« sagte Ulrich kopfschüttelnd. »So wären also wir die ersten, die einen solchen Stein in der Natur gefunden haben? Vielleicht sind wir nahe daran, ihre natürlichen Lagerplätze zu entdecken.«
»Die ersten Europäer sind wir freilich, die einen echten Amazonenstein vom Boden auflasen; dieses immerhin bedeutungsvollen Umstandes dürfen wir uns freuen, aber ich zweifle sehr daran, ob wir deren noch mehr finden werden, ich glaube eher, daß dieser Prachtkerl von seinem Besitzer hier verloren wurde.«
»In dieser Wildnis?!« ließ sich Friedrich vernehmen.
»Seltsam ist der Fund, das gebe ich zu!« fuhr der Professor achselzuckend fort. »Aber es hatte bisher den Anschein, als würden überhaupt diese Steine heutzutage nicht mehr gefunden, sondern stammten alle aus alten Zeiten; sie sind nämlich meistens so kunstvoll zu allerlei Figuren von Tieren und Früchten geschnitten, daß sie auf eine hochentwickelte Kulturzeit hinweisen; denn der Saussurit ist hart und sehr schwer zu bearbeiten: heute würde es niemand, auch einem Europäer nicht, gelingen, derartige feingemeißelte Kunstwerke daraus zu schaffen.«
»Nun! Irgendwo müssen doch auch jene alten Kulturvölker den Stein gefunden haben, und warum sollten die Fundstätten heutzutage spurlos verschwunden sein? Bei der Tierwelt, ja, bei der Pflanzenwelt ist die Ausrottung oder das Aussterben einzelner Arten möglich und nachweisbar, aber bei den reinen Naturerzeugnissen des Mineralreiches habe ich nie gehört, daß eine Art je ganz erschöpft worden wäre, vielmehr entdeckt man immer noch neue!«
Auf diese Bemerkungen Friedrichs erwiderte der Gelehrte etwas ratlos: »Na! ich will es gestehen, mir selber ist die Geschichte mit diesen Amazonensteinen etwas rätselhaft. He! Unkas, du Sohn der Wildnis, was sagst denn du dazu?«
Unkas, der schon lange den Stein mit scheuen Augen betrachtet hatte, streckte die Hand danach aus. Schulze aber ließ ihn los, ehe der Indianer fest zugegriffen hatte; so rollte der rätselhafte Stein zur Erde.
Alle stutzten, denn beim Fallen gab er einen hellen, melodischen Klang von sich.
»Das stimmt!« sagte der Professor. »Der äußerst zähe Amazonenstein kann zu sehr dünnen Platten geschliffen werden, die dann je nach ihrer Größe und Dicke verschiedene, sehr klangvolle Töne von sich geben; ähnlich stellen ja die Chinesen aus Steinplättchen, den sogenannten ›klingenden Steinen‹ ihr beliebtes Musikinstrument King her. Eines aber stimmt wiederum nicht: der Stein, den Herr Ulrich fand, war dick wie eine Kartoffel und konnte daher unmöglich so hell klingen.«
»Da haben wir schon die Lösung dieses Rätsels!« rief Friedrich der sich nach dem Steine gebückt hatte, fröhlich aus. »Hier!« Triumphierend hielt er eine dünne in der Mitte durchbohrte Scheibe der gleichen grünen Gesteinsart empor.
Dieses runde Plättchen, auf das der Saussurit im Fallen aufgeschlagen war, hatte offenbar den schönen Ton von sich gegeben; es war glänzend poliert und schimmerte prächtig in völlig durchsichtigem Smaragdglanz.
»Also! jetzt stimmt's wieder,« lachte Schulze, »und meine Vermutung von vorhin bestätigt sich: diese Scheibe ist von Menschenhand bearbeitet, also handelt es sich hier um keine natürliche Fundstätte, sondern um einen Zufall. Nun, roter Sohn der Natur, jetzt gib endlich Antwort: was sagen deine weisheittriefenden Lippen zu der Sache?«
»Vater der vier Augen und des durchdringenden Verstandes, dein Sohn glaubt, wir sind nicht ferne von dem gefürchteten Lande der Aikeambenano.«
»Da haben wir's!« lachte Schulze. »Auf solch eine Antwort war ich gefaßt; jeder Zufall muß diesen Naturkindern zur Bestätigung ihrer naiven Märchen herhalten! Aber wissenschaftlich, mein Sohn, ja, wissenschaftlich würde man deine gediegene Antwort einen Blödsinn erster Klasse heißen.«
»Herr ...« stammelte Unkas, sichtlich wenig geschmeichelt.
»Na!« sagte Schulze beschwichtigend. »Sagen wir zweiter Klasse; also einen Blödsinn zweiter Klasse, es gibt ja doch noch höheren Blödsinn; aber wissenschaftlich läßt sich mit deiner Ansicht nichts anfangen.«
»Das ist aber wirklich ein merkwürdiger Zufall!« sagte Ulrich ziemlich spöttisch. »Da liegt ja schon wieder so eine Scheibe!«
»Und dort noch eine und noch eine!« rief Friedrich.
Die unbehauenen Amazonensteine bis zu starker Faustgröße und dazwischen die polierten Scheiben in allen Größen zeigten sich immer zahlreicher, und bald hatte Friedrich, der die Töne ausprobierte, zwei ganze Tonleitern mit allen Zwischentönen beieinander. Er zog nun durch die Plättchen eine Schnur von Palmbast und hielt dabei die einzelnen in einiger Entfernung voneinander fest, indem er vor und nach jedem Plättchen einen dicken Knoten in die Schnur schlang, über den die Scheibe mit ihrem engen Loche nicht hinausgleiten konnte.
Als sie kurz darauf Mittagsrast hielten, spannte er sein aus dem Stegreif geschaffenes Instrument zwischen zwei Baumstämmchen aus und konnte nun mittels eines länglichen Steines die Töne beliebig anschlagen.
Eine Weise um die andere zauberte er auf diese Art hervor, und der ungemein liebliche, melodische Klang nahm Ohren und Seelen der Zuhörer gefangen.
»Das nenne ich einen Genuß!« sagte Schulze gerührt, als Friedrich innehielt. »Ach, wie lange haben meine Ohren all die lieben, schönen deutschen Melodien entbehren müssen, und nie hätte ich mir träumen lassen, im tropischen Urwald in solch einem Kunstgenuß schwelgen zu dürfen!«
»Wir sind eigentlich rechte Toren, daß wir nie an einen frisch-fröhlichen Gesang dachten,« warf Ulrich ein. »Wozu haben wir denn unsere Stimmen?«
Diese richtige Bemerkung schlug ein, und nun wurde reichlich nachgeholt, was versäumt worden war. Als erster Ausdruck der ›frischen Fröhlichkeit‹ erklang allerdings merkwürdigerweise die Loreley. Aber was tat's? Friedrich begleitete den Gesang kunstvoll auf den Amazonensteinen, und nie hatte dieser Urwald in den Jahrtausenden seines Bestehens ein solches Konzert vernommen. Unkas machte ein bedenkliches Gesicht, ihm war beinahe bange um den Verstand seiner weißen Herren. Als er aber späterhin noch manches fröhliche deutsche Lied in den Urwäldern vernahm, gewann er selber Geschmack an diesen schönen Gesängen.
Nun mahnte der vorrückende Nachmittag zum Aufbruch.
Keine Viertelstunde waren die Wanderer wieder unterwegs, als plötzlich ihr Pfad im spitzen Winkel in einen etwa ein Meter breiten Fußweg mündete, der vollständig mit den herrlichen grünen Steinen gepflastert war; das war aber noch lange nicht das Merkwürdigste: am Rande des Weges zeigten sich in unregelmäßigen Zwischenräumen allerlei Tiergebilde; da glotzte ein Frosch, hier züngelte eine halbaufgerichtete Schlange, dort lugte eine Eidechse vor, oder eine Schildkröte blickte verwundert zu den Reisenden auf, dann konnte man wieder ein kleines Krokodil gewahren, auch Spinnen, Falter, Skorpionen und Tausendfüßler — und all diese zierlichen Nippsachen waren aus Nephritgestein hergestellt.
»Da hört sich alle Wissenschaft auf!« rief Schulze ein Mal über das andere. »Da sollten wir Professor Haeckel aus Jena bei uns haben, der allein könnte uns hier eine natürliche Erklärung dieser unglaublichen Tatsachen aus dem Ärmel schütteln. Ich glaube aber, er würde sie für Sinnestäuschungen erklären und kaltlächelnd behaupten, er selber, als aufgeklärter Mann, sehe keinen Schimmer davon.«
»Herr Professor,« sagte Friedrich ernst, »ich glaube, Unkas hat recht gehabt mit seiner unwissenschaftlichen Bemerkung: wir befinden uns im Lande der Amazonen.«
»Papperlapapp!« erwiderte Schulze ärgerlich. »Ich sage Ihnen, der ganze Amazonenschwindel rührt von mythologischen Erinnerungen her, die die ersten Erforscher Südamerikas mit ihrer fabelhaften Phantasie in diese Länder verlegten, in denen, wie sie glaubten, alles Wunderbare liegen müsse, was je ein Phantast ausgebrütet hat.«
»Aber Humboldt selber,« warf Friedrich wieder ein, »leugnet doch das Vorhandensein der Amazonen keineswegs. Er nimmt an, daß es Weiber seien, die ihren Männern entflohen und sich zusammentaten wie die flüchtigen Neger in Palenque, weil sie sich vom harten Männerjoch befreien wollten. Er denkt auch an die religiösen Jungfrauenvereine nach der strengen Regel Quezalcoatls, des mexikanischen Buddha, die freilich überhaupt nie Männer unter sich duldeten. An der Tatsache selber wagt er aber doch nicht zu zweifeln, weil sie gar zu allgemein bezeugt ist. Namentlich stützt er sich auf die glaubwürdigen Berichte eines Quaquaindianers.«
»Ach was!« meinte Schulze eigensinnig. »Dieser Quaquaindianer hat dem guten Humboldt etwas vorgequackt als echter Quacksalber. Emanzipierte Frauenzimmer in diesen Wildnissen! Unsinn! Glaube ich einfach nicht!«
Der Streit nahm ein jähes Ende, weil ein heller grüner Glanz von solcher Leuchtkraft zwischen den Waldbäumen hindurchblitzte, daß aller Aufmerksamkeit davon gefesselt wurde.
Mit fieberhafter Eile drangen sie vor, um das neue Wunder zu ergründen, und siehe da! der Wald hörte auf — und vor sich sahen sie in einer waldumsäumten Ebene einen vereinzelten Felsen emporragen, der völlig aus grünem Nephritgestein bestand.
»Der Smaragdberg!« rief Friedrich überwältigt und triumphierend aus.
»Nur daß es kein Smaragd ist, sondern Saussurit,« warf Schulze alsbald wieder kampflustig ein.
Aber keiner dachte mehr daran, den Streit weiter zu spinnen: der Anblick des Berges war allzu märchenhaft.
Der Felsen stieg kegelförmig empor bis zu einer Höhe von etwa zweihundert Metern; an seinem Fuße mochte er etwa einen Kilometer im Umfang haben, auf seinem Gipfel kaum noch fünfzig Meter. Im übrigen war er durchaus nicht regelmäßig geformt, vielmehr wild zerklüftet und reich an merkwürdigen Gebilden; gegen Westen fiel er steil ab, dort zeigten sich senkrechte, glatte, zum Teil überhängende Wände; die Vorderseite wies Schluchten und Höhlen und viel Geröll auf, gegen Osten sah man sanfter geneigte Hänge, dazwischen aber auch scharfe Kämme mit dolomitenartigen Säulen, die zum Teil künstlich in Statuen und Statuetten umgewandelt waren, meist weibliche Gestalten darstellend. Aber auch eine Menge Tierbilder, teils naturgetreu, teils phantastische Fabelwesen von ungeheuren Größenverhältnissen, waren aus dem Stein herausgearbeitet und bewachten drohend die Hänge, an denen sie hinauf- und hinabzukriechen schienen.
Auf dem Gipfel des Berges ragte eine seltsam geformte Burg mit Erkern und Türmen empor; ein Wachtturm besonders erhob sich um volle zehn Meter über die höchsten Zinnen des übrigen Gebäudes. Auch dieses ganze Schloß war sichtlich aus dem Naturfelsen ausgehauen, und einen wahrhaft entzückenden Anblick gewährte es, wie es in den Strahlen der Tropensonne glitzerte und blitzte im herrlichsten Grün. Ja, als unsere Freunde, nachdem sie den Berg von dieser Seite zur Genüge bewundert hatten, im Osten um ihn herumschwenkten, so daß die Nephritburg zwischen ihnen und der Sonne stand, bemerkten sie, daß das Mauerwerk so dünn war, daß die Sonne durch den Hauptturm hindurchschimmerte, der nun ziemlich durchsichtig erschien, und da machten sie eine Entdeckung, die Schulze einen lauten Ausruf des Staunens und zugleich des Schreckens entlockte.
WIE schwarze Schatten, wie Röntgenbilder, wenn dieser Vergleich erlaubt ist, sah man in dem grünen Wachtturm zwei weibliche Gestalten von dem durchsichtigen Gestein sich abheben. Sie standen jede an einem kleinen runden Guckloch, durch das sie die Ankömmlinge offenbar scharf beobachteten.
»Aikeambenano!« flüsterte Unkas in merklicher Angst, und gleich darauf riß er Schulze und nach ihm Ulrich und Friedrich zu Boden. »Sie wollen uns mit ihren Blaserohren das Lebenslicht ausblasen,« rief er entsetzt.
So schien es allerdings, denn die eine der Gestalten hatte ein langes Rohr gegen die Öffnung gelegt, durch die sie zuerst geschaut hatte.
Da aber die Bodenbeschaffenheit nicht derart war, daß sich unsere Freunde vor dem hohen Turme hätten decken können, sahen sie auch, als sie am Boden lagen, die Bewegungen der Amazonen und bemerkten, wie die zweite sogleich ihre Gefährtin am Arm ergriff und diese das Rohr wieder sinken ließ.
Inzwischen krochen die Bedrohten hinter ihre Maultiere, die sie auch zu Boden zogen, und befanden sich hinter diesen vorläufig in Deckung.
»Glauben Sie jetzt an die Amazonen?« flüsterte Friedrich dem Professor zu.
»Mehr noch!« seufzte Schulze ganz kleinlaut. »Ich fürchte mich sogar vor ihnen. Mein Gott! wer solche Burgen anlegt, der muß ein gefährlicher Gegner sein, und wenn diese tollen Weiber einfach jeden Mann abmurksen, der ihr Gebiet betritt, so sehe ich keinen Ausweg, außer sie ließen uns bis zur Nacht ungeschoren; denn bei Tag können wir die hundert Schritt bis zum Waldsaum nicht lebendig zurücklegen, wenn die Hexen gut schießen. Und haben sie böse Absichten, so werden sie uns nicht bis zum Eintritt der Dunkelheit unbehelligt lassen.«
»Nun! vorerst eilt es ihnen scheint's nicht, nach dem, was wir sahen,« beruhigte Ulrich. »Aber was sind das eigentlich, die ›Blaserohre‹, die Unkas erwähnte?«
»Ach!« jammerte Schulze. »Das ist in der Hand des Geübten eine der gefährlichsten Waffen, die es gibt. Es ist sehr leicht damit zu zielen. Sie stecken einen vergifteten Pfeil in das Rohr und blasen ihn hindurch. Mit großer Gewalt und Schnelligkeit fliegt er durch die Luft, und verloren ist, wen er trifft.«
»Ich denke, wir sehen, wie wir beizeiten der Gefahr entrinnen,« riet Friedrich. »Ich schlage vor, wir hängen die Marimasäcke über den Rücken der Maultiere so weit herunter, daß sie bis zum Boden herabhängen und uns so kein Pfeil unter dem Bauch der Tiere hindurch in die Beine gejagt werden kann; dann führen wir die Maultiere langsam gegen den Waldsaum, uns stets hinter ihnen deckend.«
Dieser Rat fand allgemeine Zustimmung, auch Unkas wußte nichts Besseres; so wurden denn die Säcke in der angegebenen Weise befestigt, wobei sich alle sorgfältig hüteten, sich eine Blöße zu geben. Dann wurden die Maultiere emporgerissen und langsam, Schritt für Schritt, dem Waldsaum zugeführt, den eine hohe Hecke einfaßte, nur den Weg freilassend, auf dem unsere Freunde auf die Ebene hinausgelangt waren.
Da es sich darum handelte, möglichst rasch das schützende Gebüsch zu erreichen, ohne doch durch eine auffallende Hast die Absicht zu verraten, strebten die Flüchtigen in gerader Linie dem Walde zu und suchten nicht etwa den Pfad zu erreichen, auf dem sie gekommen waren.
»Wenn wir nur auch in das Gebüsch eindringen können!« meinte Ulrich bedenklich. »Es scheint so dicht zu sein wie eine Mauer.«
»Na, eine Lücke wird sich schon darin finden!« tröstete Schulze.
Sie hatten aber noch nicht die Hälfte des Weges zurückgelegt, als drei Pfeile aus der Umfassungsmauer der Nephritburg schwirrten und die drei Maultiere trafen. Nur mühsam konnten die Tiere noch einige Schritte weiter gezerrt werden, dann brachen sie zusammen. Rasch duckten sich die Bedrohten hinter die verendenden Tiere.
Aufs neue wurde Kriegsrat gehalten und diesmal Ulrichs Vorschlag angenommen, der dahin lautete, von nun an regungslos hinter den Maultierleichen zu verharren, bis es ganz dunkel sei, dabei die Schießwaffen stets in Bereitschaft zu halten, um einem etwaigen Angriffe von der Burg her tatkräftig zu begegnen.
Ein solcher erfolgte jedoch nicht.
Kaum war die völlige Finsternis eingetreten, als unsere Freunde, am Boden hinkriechend, sich dem Gebüsche näherten; plötzlich leuchteten aber auf dem Smaragdberg hundert Lichter auf, und der ganze Platz erschien in grünem Glanze taghell erleuchtet.
Die Flüchtlinge sprangen auf und hatten mit ein paar Sätzen das Gebüsch erreicht, das sich aber als völlig unzugänglich erwies. Sie wußten nicht, sollten sie sich mit ihren Beilen einen Weg bahnen oder den Pfad zu gewinnen suchen, auf dem sie gekommen waren — als auf einmal auch hinter dem Buschwerk grüne Lichter aufblitzten. Gleichzeitig erscholl ein Rufen, Schwatzen und Kichern, und soviel durch das Laub zu sehen war, befanden sich am Waldsaum, in der Hecke verborgen, zahlreiche kleine Wachttürmchen aus halb durchsichtigem Nephritgestein, die alle von einigen Amazonen besetzt schienen.
»O weh! Wir sind in einer Mausefalle!« stöhnte der Professor. »Nun gnade uns Gott!«
Da bewegte sich ein Zug rotleuchtender Fackeln den Berg herunter, geradeswegs auf sie zu.
Unkas und Schulze waren der Meinung, man müsse die Nahenden sofort aufs Korn nehmen und niederschießen, um der nächsten Gefahr zu entgehen und den kriegerischen Weibern Achtung einzuflößen. Ulrich neigte sich auch zu dieser Ansicht.
Friedrich aber bat: »Laßt doch das Schießen sein! Einen wirklichen Wert kann es nicht haben; an dem Schicksal unserer Maultiere haben wir erkannt, daß uns tödliche und sichertreffende Pfeile drohen. Bei der hellen Beleuchtung sind wir den Geschossen schutzlos preisgegeben. Decken können wir uns nirgends, da auch in unserem Rücken in nächster Nähe Feinde sind. Glaubt mir, der erste Schuß, den wir abgeben, wird die Folge haben, daß wir alle vier einen Pfeil in den Rücken bekommen — vielleicht auch einen ganzen Hagel von allen Seiten, was übrigens bei der Giftigkeit der Geschosse aufs gleiche herauskommt.«
Keiner konnte sich der Richtigkeit von Friedrichs Bemerkung verschließen, und so senkten sie die Büchsen und erwarteten die Ankunft der Amazonen.
Es waren sechs hochgewachsene, wohlgebildete Frauengestalten, die sich näherten, alle mit Blaserohren bewaffnet. Sie zeigten zwar unverkennbar den Indianertypus, doch war ihre Haut zart und von fast europäischer Weiße, ein Umstand, der übrigens bei mehreren Indianerstämmen Südamerikas gefunden wird, deren Lebens- und Bekleidungsweise — oder vielmehr Nichtbekleidungsweise — in gar nichts von derjenigen ihrer rothäutigen und dunkelbraunen Brüder abweicht.
Die Führerin der kleinen Schar trat vor, als sie von den Fremden nur noch wenige Schritte entfernt war und redete sie in der Sprache der Amazonen an. »Karáipi hémiri ui; natu Aikeambenano; Cougnantainsecouima ahitsa erináu.«
Ja, wer das verstanden hätte! Die Sprecherin meinte damit: »Die weißen Karaiben sind Schlangen, ich bin eine Aikeambenano; die allein lebenden Weiber wollen nichts von den Männern.« Mit »Karaiben« bezeichnen die nichtkaraibischen Indianerstämme alle Fremden.
Aber selbst Unkas verstand nichts von der Rede, als die beiden Amazonennamen Aikeambenano und Cougnantainsecouima; dennoch machte er einen Versuch, sich ihnen verständlich zu machen, indem er alle Indianermundarten, die ihm zu Gebote standen, hervorholte.
Die Amazonen aber sahen einander nur verwundert an, und dann lachten sie, daß ihre weißen Zähne blinkten.
Dieses Lachen belebte Schulzes tiefgesunkenen Mut wieder. »Die Weiber können doch wenigstens herzlich lachen, was man sonst bei den Indianern nie findet; sie scheinen sich in ihrem Emanzipiertenstande wohler zu fühlen als die Eingeborenen des ganzen übrigen amerikanischen Weltteils,« bemerkte er zu seinen Gefährten.
Die Sprecherin der Amazonen aber machte ihnen ein Zeichen, ihr zu folgen, indem sie nur kurz und befehlend sagte: »Amunao!« Hätten unsere Freunde etwas von ihrer Sprache verstanden, so wäre ihnen klar geworden, daß sie zum »Häuptling«, das heißt in diesem Fall: zur Königin geführt werden sollten.
Die Sprecherin ging voran mit einer Gefährtin zur Seite; zwei der Amazonen bewachten die Fremdlinge zur Rechten und Linken, und zwei schlossen den Zug. So ging es um den Smaragdberg herum gegen dessen Südseite, und nun zeigte es sich, daß im Süden ein ähnlicher Weg wie der nördliche Zugangspfad in den Wald führte. Die Amazonen bogen mit ihren Gefangenen in diesen Weg ein. Auch er war mit Amazonensteinen gepflastert; zu beiden Seiten säumten ihn hohe Hecken; hier und da mündete ein anderer Waldweg in ihn ein oder kreuzte ihn. Dann lichtete sich schließlich der Wald, und im Glanze des Vollmonds, der nun über den Horizont emporstieg, breitete sich ein weites offenes Land aus, rings von Wald umschlossen, eine Ebene, aus der einzelne Hügel sich erhoben, und die von mehreren Bachtälern durchfurcht war. Diese ausgedehnte Lichtung war von einer einzigen großen Stadt bedeckt, deren eigentümliche aber geschmackvoll gebaute Holzhäuser in großen Abständen voneinander standen.
Auf dem größten der Hügel, inmitten dieser weitläufigen Stadt, zeigte sich ein hellerleuchtetes zierliches Schloß aus Nephritgestein, durchsichtig schimmernd wie die Burg auf dem Smaragdberg, so daß man fast wie durch Glas die leuchtende Pracht im Innern schauen konnte.
Hierhin wurden unsere Freunde geführt. In einem von Gold und Edelsteinen flimmernden Saale saß die Amazonenkönigin auf einem Schemel, der mit einem Jaguarfell bedeckt war und ihren Thron vorstellte. Sie war umgeben von einer Schar lustig kichernder Mädchen. Auf dem mit Palmbastmatten belegten Fußboden ringelten sich Schlangen aller Arten und Größen, in bunten Farben schillernd; an den Wänden standen silberne Näpfe, aus denen die Tiere Milch schlürften.
Schulze wagte sich kaum in diese unheimliche Gesellschaft, doch sagte er sich alsbald, die Schlangen seien jedenfalls gezähmt und der Giftzähne beraubt.
Beim Eintritt der Fremdlinge erhob sich die Königin und ging ihnen entgegen. In ihrem malerischen Schmuck machte sie einen wirklich achtunggebietenden Eindruck, auch hatte sie etwas wahrhaft Königliches in ihrem Wesen und ihren edlen Gesichtszügen. Ihr Kalu oder Arara, das heißt ihre Federkrone, war aus bunten Federn von blendendem Glanze kunstvoll zusammengesetzt, ebenso ihr Napakalu oder Lendenschurz; außer farbenprächtigen Federn der Arara und Kolibri befanden sich darunter einige besonders lange und leuchtende Federn, die Schulze hernach auf Friedrichs Frage für das Gefieder des Quezal, des mexikanischen Paradiesvogels, erklärte.
In etwas eigentümlichem, doch wohlverständlichem Spanisch redete die Amunao ihre Gäste — oder Gefangenen — an: »Die weißen Fremden,« sagte sie mit wohlklingender, freundlicher Stimme, »sind dem Tode verfallen.«
Der Professor schaute bestürzt auf. Diese kaltblütige Äußerung stand in seltsamem Gegensatz zu dem liebenswürdigen Klange der Stimme.
»Nur im Monat April,« fuhr die Königin fort, »gestatten wir Männern den Zutritt in unser Land; allein auch dann nur denjenigen, die wir selber einladen, und wir empfangen sie in einem Garten an der äußersten Grenze unseres Reiches. Niemals dürfen sie bis zur Smaragdburg oder gar bis in meine Hauptstadt dringen. Wer es wagt, unsere wohlbewachten Grenzen eigenmächtig zu überschreiten, dem ist der Tod sicher. Wäret ihr nicht die ersten weißen Karáipi, die dem Smaragdberg sich nahten, so hätte Yutaténeru nicht Befehl gegeben, euch zu schonen; nun aber war sie neugierig, euch zu sehen.«
»Herrin, wir sind nicht im Übermute in dies Reich eingedrungen; wir hatten keine feindlichen Absichten und kamen ahnungslos in dein Gebiet, dessen strenge Gesetze uns unbekannt waren.«
Also redete Ulrich, und Friedrich fügte, die großen blauen Augen voll zu der anmutigen Königin aufschlagend, hinzu: »Sei milde, wie dein Antlitz erscheint, laß uns frei ziehen. Was kann unser Tod dir nützen? Wir zogen aus, unseren Vater zu suchen, nachdem wir unsere Mutter verloren hatten. Beraube nicht einen edlen Mann seiner Kinder. Dein Reich wollen wir verlassen auf dem Wege, den du uns heißest, und dir schwören, es nie wieder zu betreten.«
Wohlwollend blickte die Königin auf den schönen Jüngling. Schulze aber hub alsbald an: »Edle Königin, Herrin des herrlichsten Reiches der Welt, Fürstin der Smaragdberge und Beherrscherin aller emanzipierten Frauenzimmer! Mondlicht schimmert aus deinem reizenden Angesicht, und die Rosen von Schiras blühen auf deinen Wangen; in deinen dunkeln Augen leuchtet die Mitternachtsonne, und um den Schmuck deines Hauptes beneidet dich Quezal, der König unter den Vögeln. Draußen in der Welt weiß man wenig von deiner Macht und strahlenden Schönheit. Laß uns hinziehen in alle Lande, deinen Ruhm zu verkündigen deinen staunenden Sklaven, und die Welt wird geblendet werden von deinem Glanze. Laß uns verkündigen, daß du ein Herz hast, so weich wie Kokosbutter, und durch deine Milde dich beweisest als die echte Tochter des hochgepriesenen Quezalcoatls.«
Yutaténeru, »das Jungfräuliche Reh«, verstand zwar nicht die Hälfte des spanischen Redeschwalls unseres schlauen Professors, aber mit sichtlichem Entzücken lauschte sie den Schmeichelworten, die ihr Ohr noch nie in dem Maße vernommen hatte, und man sah ihrem Gesichte den günstigen Eindruck an, den die bombastischen Phrasen auf ihr weibliches Herz machten.
Als aber der Professor geendet hatte, erwiderte sie: »Wir haben unerbittliche und unabänderliche Gesetze, ihnen gehorcht auch die große Amunao. Wenn wir sie ein einziges Mal verachteten, so wäre die Kraft unserer Herrschaft gebrochen. Ihr müßt sterben!«
Zugleich winkte sie einem Mädchen. Dieses tauchte die Spitze eines Dolches in eine Schale, die offenbar Gift enthielt, und reichte die haarscharfe Waffe der Königin, die sie ihrerseits einem andern Mädchen aus ihrer Umgebung übergab, einige feierliche Worte redend.
Die Jungfrau schritt mit gezücktem Dolche auf unsere Freunde zu, die wohl merkten, was ihnen drohte, und nach einer Gelegenheit zur Flucht ausspähten. Eine solche erschien jedoch unmöglich, denn überall blitzten plötzlich in den Händen der Amazonen Dolche auf, die sie aus ihren Gürteln zogen.
In diesem Augenblick erscholl ein allgemeiner Ausruf des Staunens und großer Erregung von den Lippen sämtlicher Mädchen. Eine prächtig gezeichnete Korallenschlange, auf deren Haupt eine zierlich gearbeitete Miniaturkrone aus Nephrit in kunstvoller Weise befestigt war, wand sich an Friedrich empor, bis ihr Kopf sich über dem seinen wiegte, während ihr Leib sich ihm um Hals und Brust schlang.
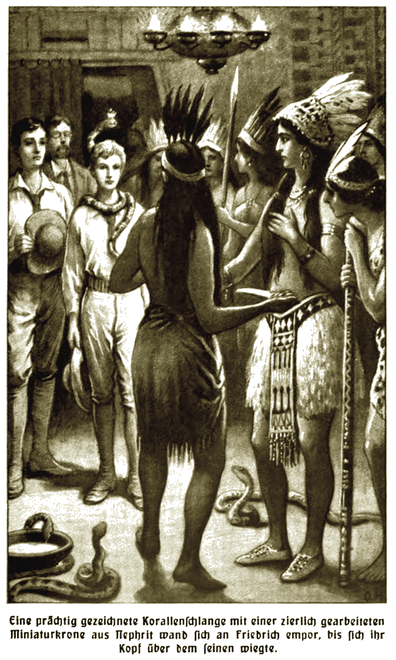
Friedrich hatte so viel Geistesgegenwart, sich regungslos zu verhalten, was, wie er wußte, in solch einem Fall das beste Mittel ist, einem Bisse zu entgehen. Er war überzeugt, daß die gefährliche Schlange keine Giftzähne mehr haben werde; aber gewiß konnte er es doch nicht wissen.
Seine mutige Standhaftigkeit erregte ein allgemeines Beifallsgemurmel; zugleich sahen alle Amazonen mit einer gewissen scheuen Ehrfurcht zu Friedrich empor.
Die Königin aber sprach: »Wer bist du, Karáipi, daß die Götter dich lieben und dir solche Ehre antun? Mein Reich steht dir offen, du bist frei, darin umherzugehen, wie dir's beliebt.«
»Und diese?« fragte Friedrich, auf die Genossen blickend, deren Rettung ihm mehr am Herzen lag als die eigene.
»Gehören sie zu dir?«
»Gewiß! Und ihr Schicksal will ich teilen!«
»Wenn du so redest, so können wir ihnen nichts anhaben. Mächtig ist die Amunao der Aikeambenano, und alle Häuptlinge der Welt wagen nichts gegen sie zu unternehmen; aber hoch über ihr steht der Wille der ewigen Götter, auf deren Gunst allein ihr Glück und ihre Macht beruht. Die heilige Schlange hat euer Leben verschont, sie hat dein Haupt berührt und geweiht. Der Zorn des Höchsten der Götter würde uns zermalmen, wollten wir seine Wunderzeichen gering achten und seinen Lieblingen Schaden tun.«
Nun glitt die Schlange wieder an Friedrichs Leib hinab zu Boden, blieb aber in seiner Nähe.
»Siehst du!« fuhr die Königin fort, »sie hat meine Worte gehört und weiß, daß euch keine Gefahr mehr droht, darum konnte sie dich wieder verlassen, sonst hätte sie dich gegen jeden Angriff geschützt; ihre Bisse sind tödlich, und selten vergeht ein Tag, da sie nicht auf heimlichen Befehl des Gottes ein Menschenleben aus unserer Mitte fordert. Ich selber aber wurde zur Königin meiner Schwestern ausgewählt durch das gleiche göttliche Zeichen, das heute dein Leben gerettet hat.«
Die Amazonen ringsum hatten sich so lange still verhalten, offenbar eingeschüchtert durch das außerordentliche Wunder, unter dessen Banne sie noch standen. Das Schweigen war ihnen jedoch sichtlich schwer gefallen, und nun entschädigten sie sich durch um so lautere Jubelrufe. Sie schwenkten ihre Dolche in der Luft, als seien es nur harmlose Spielzeuge, und steckten sie dann wieder in die Gürtel.
Yutaténeru aber gebot ihnen Stillschweigen, und so groß war die Macht der Königin, daß augenblickliche Stille eintrat und auf ihren Wink sich die Mädchen alle mit untergeschlagenen Füßen niedersetzten.
Während des allgemeinen Freudenlärms hatte Schulze Friedrich zugeflüstert: »Seien Sie kühn, greifen Sie zu; nie und nirgends war die Gelegenheit zu einem Staatsstreiche günstiger, als sie sich heute hier Ihnen darbietet. Yutaténeru selber sagte ja, das Wunder mit der Korallenschlange sei als ihre göttliche Bestimmung zur Königin angesehen worden. Was ist einfacher, als daß Sie sagen, der Gott habe Sie zum Könige der Amazonen bestimmt, deren Gesetze Sie im übrigen hochhalten würden? Uns machen Sie zu Ministern, sonst halten Sie die Abgeschlossenheit aufrecht. Ich sage Ihnen, es geht prächtig. Sehen Sie nur die scheu bewundernden Blicke, die Ihnen die Königin zuwirft! Die besinnt sich keinen Augenblick. Greifen Sie zu, greifen Sie zu! Eine Königskrone findet man nicht alle Tage!«
Friedrich lächelte über des Professors abenteuerliche Pläne, die übrigens leicht in die Wirklichkeit hätten umgesetzt werden können. Inzwischen redete Yutaténeru ihn wieder an: »Wohin befiehlt mein Gebieter, daß meine Töchter ihn und seine Gefährten führen sollen? Doch es ist Nacht, und eure Tiere sind tot. Tut mir die Ehre an, meine Gäste zu bleiben, so wird morgen unser Ohr euren weiteren Befehlen geneigt sein.«
»Hören Sie, wie untertänig das klingt!« flüsterte Schulze.
Friedrich nahm das Anerbieten dankend an, und eine Amazone geleitete die Fremden aus dem Schlosse in ein benachbartes Gebäude. Dort wurde ihnen ein köstliches Mahl aufgetragen und eine weiche Lagerstatt bereitet. Dann entfernten sich die dienstfertigen Mädchen mit der Versicherung, jedes Rufes gewärtig zu sein.
In der Freude über ihre wunderbare Rettung unterhielten sich unsere Freunde noch lange über die seltsamen Erlebnisse dieses ereignisreichen Tages, bis endlich der Schlaf sie übermannte.
In aller Frühe wurden sie durch ein helles Klingen geweckt; als sie sich rasch erhoben und vor das Haus traten, sahen sie zehn zierliche Lama, von zwei Amazonen geführt, ihrer harren. Um den Hals hatte jedes der Tiere eine Schnur mit Nephritscheiben, die, aneinanderschlagend, den melodischen Klang erzeugten. Fünf der Lamas trugen teils das sämtliche Gepäck, das den toten Maultieren abgenommen worden war, teils Geschenke der Königin, namentlich viele reizende Tierbilder und Früchte, aus Amazonensteinen gebildet.
Yutaténeru erschien dann persönlich in all der Pracht ihres königlichen Schmuckes vor den Toren ihres herrlichen Palastes.
»Eure Magd,« begann sie, »darf euch nicht länger bitten, in ihrer Nähe zu verweilen; ihr Herz hat gesprochen, und sie fürchtet die Überschreitung jahrhundertealter Gesetze. Dem Glück des Herzens könnte der Fluch des Volkes folgen; auch ist die Gunst der Götter wandelbar und möchte sich wieder von euch kehren. Das Jungfräuliche Reh fleht euch aber an, diesen geringen Ersatz für euren Verlust anzunehmen, und gibt euch sicheres Geleite mit bis zu den Grenzen seines Reiches. Weit dehnen sich der Amazonen Wälder und Ebenen, ihre Berge und Täler mit Städten und Dörfern gegen Sonnenuntergang. Lüstet's euch, noch mehr von der Macht und Größe meines Reiches zu sehen — ihr sollt geführt werden, wohin ihr wollt, bis zu sieben Tagen; dann aber müßt ihr die Grenzen überschreiten und nicht wiederkehren, es sei denn im Monat der Erináu.«
»Große Königin,« erwiderte Friedrich, der von der Amazonenfürstin angeredet worden war, »nimm unsern tiefgefühlten Dank entgegen für deine königlichen Gaben — mehr aber noch für deine hochherzige Milde. So sehr uns jedoch verlangte, dein wunderbares Reich noch weiter anstaunen zu dürfen, so drängt doch unsere Reise, und wir bitten, du mögest uns den Weg gegen Mittag weisen lassen.«
Schulze, dem Friedrichs Rede nicht überschwenglich genug erschien, nahm nun auch das Wort:
»Sonne der Erde, unser Verlangen geht danach, die Pracht deines paradiesischen Reiches in durstigen Zügen zu genießen; doch deine Knechte sagen sich, daß sie nichts mehr schauen werden, was dem Glanze deines Palastes und der Holdseligkeit deiner Gestalt gleichkommen könnte. Da sie nun nicht länger im Sonnenscheine deines Angesichtes verweilen dürfen, so wollen sie die Augen schließen und sich nicht aufhalten, nicht rechts noch links schauen, damit das Bild deiner Herrlichkeit sich unauslöschlich ihrem Gedächtnis einpräge!«
Yutaténeru strahlte vor Vergnügen. Der Professor verstand es, ihr zu schmeicheln. »Karáipi hémiri!« rief sie. »Kehret wieder im Monde der Erináu, und ihr werdet Yutaténerus Seele mit Sonnenschein erfüllen; ihr aber sollt festliche Tage erleben, die euer Gedächtnis festhalten wird bis ans Ende eurer Jahre.« Mit diesen Worten entließ die Amazonenkönigin ihre Gäste, ihnen huldvollen Abschied zuwinkend.
NACHDEM den so verheißungsvoll Verabschiedeten noch ein reichlicher Morgenimbiß vorgesetzt worden war, brachen sie mit den zehn Lama unter Führung der zwei Amazonen auf. Ein letztes Mal sahen sie den Palast der Königin im Strahle der aufgehenden Sonne erschimmern, und es war ihnen, als blicke Yutaténeru ihnen durch die durchsichtigen Wände ihres Schlosses nach.
Hoch über den Wald funkelte und blitzte in grünem Feuer der Smaragdberg aus der Ferne herüber, und die seltsamen Formen der ihn krönenden Burg versetzten unsere Freunde nochmals in die lebhafteste Bewunderung. Dann aber rissen sie sich los von dem unvergleichlichen Schauspiel, und der Urwald mit seinen glitzernden Nephritpfaden nahm sie wieder auf.
Sie wanderten den ganzen Tag fort und nach kurzer Nachtruhe noch den folgenden Morgen, ehe sie die Grenzen des Amazonenreiches erreichten, wo ihre Führerinnen sich von ihnen trennten. Von da ab ging es wieder langsam und mühsam durch fast undurchdringlichen, pfadlosen Urwald, bis sie endlich am Abend des 21. Dezembers die Ufer des Japura erreichten.
Hier fanden sie einen herrlichen Lagerplatz auf dem rechten Ufer des Flusses, den sie durch eine Furt durchschritten. Fruchttragende Bäume waren in Menge vorhanden, und zahlreiche Spuren wiesen auf großen Wildreichtum hin. Obgleich die Wanderer noch Lebensmittel auf mehrere Tage besaßen, waren sie doch an diesen Entdeckungen froh; denn sie wollten ihre Vorräte möglichst sparen, bei Gelegenheit auch vermehren; wußten sie doch nicht, was für Gegenden sie noch zu durchziehen hatten; möglicherweise konnten sie noch tagelang auf ihren Vorrat angewiesen sein.
Da der 22. Dezember ein Sonntag war, verbrachten sie auch diesen folgenden Tag am Ufer des Flusses. Nachmittags sollte auf die Jagd gegangen werden.
Schulze, der gewaltige Nimrod, konnte seine Jagdlust am wenigsten zügeln, und während die andern der Ruhe pflegten, schlich er sich heimlich fort, um auf eigene Faust sein Glück zu versuchen. Er hatte sich in der letzten Zeit viel im Schießen geübt und glaubte nun so weit zu sein, einmal seinen jungen Freunden seine Kunst beweisen zu können; er träumte von Bisonen und Edelhirschen und anderem Getier, das es in diesen Jagdgründen gar nicht geben konnte; er sah sich in Gedanken gar als Sieger über einen Grislybären, den er in Nordamerika hätte suchen müssen. Das focht ihn wenig an, denn er war in diesem Augenblick ganz Jäger und schwelgte als solcher in kühnen Jagdphantasien und -träumen, ohne den nüchternen Gelehrten in sich zum Worte kommen zu lassen.
Im voraus arbeitete er seine Pläne aus, wie er sich solchem Großwild gegenüber verhalten wolle, um es sicher zur Strecke zu bringen. Ha! dann sollten die Gefährten staunen, namentlich der rauhe Sohn der Wildnis, welche Heldentaten ein Professor der Zoologie zu vollbringen vermochte!
Lange streifte er vergebens umher: es zeigte sich nur einiges Wild kleinerer Gattungen, das sein Weidmannsherz verschmähte — weil es zu schnell davonjagte, als daß er hätte zielen können. Er setzte zwar oft den Flintenkolben an die Wange, aber bis er so ein Geschöpf richtig aufs Korn genommen hatte, war es schon wieder verschwunden, und der Fleck, auf den er die Mündung seiner nie fehlenden Büchse gerichtet hielt, war leer. Da konnte doch der beste Jäger nicht zum Schuß kommen!
Plötzlich horchte Schulze hoch auf. Was war das? Ein Stampfen und Krachen erhob sich in der Ferne und kam immer näher. Vorsichtig verschanzte er sich hinter einen Baumstamm und wartete der Dinge, die da kommen sollten. Und sie kamen! Eine Herde von Pekari, mindestens hundert Stück auf einmal.
Na! das waren freilich keine Bisone, dafür aber war es schwer, einen Fehlschuß zu tun; es bedurfte keines Zielens, Schulze brauchte nur in die dichte Masse zu pfeffern, und jeder Schuß mußte treffen; wenn er sich beeilte, konnte er hoffen, vier bis fünf Stück zu erlegen, ehe die Tiere, so ungestüm sie einherstürmten, außer Schußweite waren.
Unkas' Warnung bei der früheren Begegnung mit solchen Wildschweinen hatte er vergessen oder verachtete sie in seinem kühnen Jägermute. Diese kleinen Pekari, so wild sie sich gebärdeten, konnten doch unmöglich gefährlich werden! Und so gab er denn Feuer, zwei Schüsse hintereinander, und hoch klopfte sein Herz vor Freude, als richtig zwei der Tiere zusammenbrachen.
Allein, zu einem dritten Schuß blieb ihm keine Zeit, denn die freche Horde, von der er nichts anderes erwartet hatte, als daß sie in jähem Schrecken vor ihrem furchtbaren Feinde fliehen werde, stürzte wütend geradeswegs auf ihn los. Bald war er eng bedrängt, und die Vordersten der Unholde sprangen an ihm empor und schnappten nach ihm. Zwar wehrte er sich ritterlich mit dem Flintenkolben, aber die rücksichtslosen Geschöpfe begannen ihm mir nichts, dir nichts die Beinkleider zu zerfetzen, und bald spürte er einen scharfen Biß in den Waden.
»Mein Gott!« dachte der beklagenswerte Nimrod, »die Teufelsbiester sind imstande, mich bei lebendigem Leibe zu zerfleischen!«
Er begann, gellende Hilferufe auszustoßen; da kam ihm ein rettender Gedanke: er blickte an dem Baum hinauf, neben dem er stand, und sah, daß der Stamm in nicht allzu großer Höhe einige Äste ausstreckte, die Schulze, obgleich im Turnen schwach, mit Hilfe der zahlreichen emporrankenden Lianen zu erreichen hoffte.
Rasch warf er die Flinte über und mühte sich weidlich ab, bis er den untersten Ast erfassen konnte. Nun schwang er sich schwerfällig hinauf, und aufatmend machte er sich's auf dem breiten Aste so bequem wie möglich.
Aber was nun? Die Pekari dachten nicht daran, zu weichen: sie umzingelten den Stamm, an dem sie grunzend emporsprangen, ja, einige suchten den Baum zu unterwühlen; dazu hätten sie aber ein paar Tage gebraucht. Eine unmittelbare Gefahr war also nicht vorhanden.
»Ewig werden sie auch nicht dableiben,« dachte der Professor beruhigt, »und schließlich werden meine Gefährten nach mir suchen und meiner Belagerung ein Ende machen.« Damit holte er philosophisch seine Pfeife hervor, stopfte sie würdevoll und begann zu qualmen.
Nachdem er so eine Weile in stoischer Gelassenheit verharrt hatte, kam ihm der kluge Gedanke, noch möglichst viele seiner Feinde zu erlegen; zuletzt würde sie wohl doch das bleiche Entsetzen packen, und sie würden sich aus dem Bereich seiner nie fehlenden Büchse begeben.
Er begann sofort, seinen Plan auszuführen, und da er gemächlich zielen konnte, auch die Pekari Rücken an Rücken gedrängt standen, gelang es ihm nur selten, ganz daneben zu schießen, was eine große Kunst war.
Dazwischen stieß er von Zeit zu Zeit ein lautes »Hallo! hierher!« aus, um seine Freunde auf die richtige Fährte zu bringen, wenn sie sich nähern sollten.
Richtig! Da erschien Friedrich. Dieser mußte lachen, als er den guten Professor mit seinen zerfetzten Hosen auf dem Baume hocken sah; doch gab er sich nicht lange der Heiterkeit hin, wohl sehend, daß die Sachlage des Ernstes nicht entbehrte; und so begann er alsbald seinerseits, unter Schulzes Belagerern aufzuräumen.
Allein, schon der erste Schuß hatte zur Folge, daß sich eine ziemliche Anzahl der gereizten Tiere ihm zuwandte. Sofort begriff Friedrich, daß es ihm nicht anders gehen werde als dem unglücklichen Zoologen. Unverzüglich sah er sich nach einem geeigneten Baume um und erkletterte ihn wie eine Katze, ehe er noch etwas von seiner Bekleidung eingebüßt hatte.
»Ha, ha!« lachte nun Schulze seinerseits. »Da sehen Sie selber, wie wenig Eindruck die vorzüglichste Schießkunst auf diese tollen Bestien macht. Habe ich nicht höchsteigenhändig bereits acht Stück davon erlegt? Aber sie lassen sich nicht einschüchtern — im Gegenteil!«
Friedrich war nun ebenso belagert wie sein Leidensgenosse und wußte auch nichts Besseres zu tun, als ein Stück um das andere wegzuschießen; doch hatte er weitaus nicht genügend Schießvorrat bei sich, um daran denken zu können, alle Tiere zu erlegen, die den Stamm des Baumes umkreisten, auf den er sich geflüchtet hatte.
Nun hörte man aber Ulrichs rufende Stimme. »Hierher!« rief Friedrich, und bald darauf erschien der Bruder auf der Bildfläche. Rasch hatte er den Stand der Dinge erfaßt, der zunächst auch seine Heiterkeit erregte, und schickte sich sofort an, unter die grunzende Herde hineinzuschießen.
»Halt, halt!« rief Friedrich. »Steige nur erst auf einen Baum, sonst geht dir's an die Waden wie dem Herrn Professor.«
Ulrich sah die Vernünftigkeit dieser Warnung ein und bestieg einen Baum, der so ziemlich in der Mitte zwischen den beiden andern stand. Von hier aus konnten seine Kugeln beiden Teilen Luft verschaffen.
Aber auch den dritten Schützen hatten die Pekari bald bemerkt, als seine Schüsse unter ihnen aufzuräumen begannen, und wie auf Kommando lösten sich von beiden Herden einige Eber ab und begannen die Belagerung von Ulrichs Zufluchtstätte.
Es mochten im ganzen noch etwa achtzig Tiere sein, von denen Schulze und Friedrich je annähernd dreißig, Ulrich etwa zwanzig zu Füßen hatten.
»Fortgeschossen wird!« gab Friedrich die Losung aus. »Fortgeschossen bis zur Munitionserschöpfung. Hätte ich einen solchen Strauß geahnt, wahrlich, ich hätte mich besser versehen.«
»Bei mir wird's auch nicht ganz reichen,« meinte Ulrich, »und der Herr Professor — wahrhaftig, mir scheint, er will aus dem Waldboden ein Sieb machen!«
In der Tat, seit die Reihen seiner Belagerer sich so bedeutend gelichtet hatten, schoß Schulze beharrlich daneben; das Sitzen auf dem harten Aste begann auch unbequem zu werden, und seine Jagdlust ermattete bedeutend.
Nichtsdestoweniger erwiderte er: »Oho! sehen Sie nicht, daß bereits fünfzehn Stück da unten alle Viere von sich strecken? Wenn mir die Füße nicht eingeschlafen wären, könnte ich bald Ihnen zu Hilfe kommen, denn ich habe wohl noch zwanzig Patronen, die freilich für ganz anderes Wild bestimmt waren.«
Inzwischen taten Ulrich und Friedrich keinen einzigen Fehlschuß. »Das ist wieder genau so wie auf dem Islote,« meinte ersterer.
»Ja, so ähnlich,« bestätigte Friedrich, »aber doch etwas harmloser. Haben wir uns verschossen, so steigen wir herab und werfen uns unter die Feinde; dann werden wir wohl mit Kolben und Jagdmessern ihrer Herr werden, wenn auch mit Verlust einiger Kleidungsstücke und Hautfetzen.«
Ulrich war zuerst mit seiner Munition zu Ende. Allerdings tobten auch nur noch fünf Wildschweine um seinen Baum herum, während siebzehn Stück tot darunter lagen.
»Halt, Herr Schulze,« rief er, »Sie treiben wahrhaftig Munitionsverschwendung! Sparen Sie mir auf, was Sie noch übrig haben. Ich sehe, daß ich gut zu Ihnen gelangen kann, die Äste unserer Bäume berühren sich ja vielfach.«
Als gewandter Turner hatte Ulrich denn auch bald den nicht ungefährlichen Weg zurückgelegt und verwertete jetzt des Naturforschers letzte Patronen mit tödlicher Sicherheit.
»Sehen Sie, das gibt aus!« rief er. »Jetzt sind wir doch alle los bis auf drei!«
Aus den dreien wurden aber wieder acht, denn die Pekari am mittleren Baume hatten Ulrichs Entweichen bemerkt und wandten sich sofort dem ersten Baume zu.
Indessen hatte Friedrich auch die Zahl seiner Belagerer auf zehn vermindert, als er den letzten Schuß tat; er besann sich aber noch, ob er sich vom Baume herabwagen solle.
Da erschien Unkas, den das unaufhörliche Schießen stutzig gemacht hatte, und der daher der Fährte seiner Herren gefolgt war. Mit der Vorsicht eines Indianers schlich er sich heran. Als er die Lage der Dinge sah, überlegte er nur kurz und entschloß sich, den Baum zu ersteigen, den Ulrich soeben verlassen hatte. Von dort aus wollte er seinerseits auf die Tiere zur Rechten und Linken schießen.
»Laß lieber mich machen,« rief ihm Ulrich zu, der Unkas' mangelhafte Schießkunst kannte, und turnte alsbald zu Unkas hinüber.
»Zum Kuckuck! Hat der Tölpel von einer Rothaut nur fünfzehn Patronen mit sich genommen, wo doch noch achtzehn Pekari vorhanden sind,« schalt er lachend. »Kann Unkas nicht auf achtzehn zählen?«
»Junger Herr!« erwiderte der Indianer, den Tadel für ernst nehmend, »Unkas sah die Pekari nicht vom Lager aus und konnte ihre Zahl nicht wissen.«
Ulrich schoß nun vollends ab, was er erreichen konnte; er mußte dann noch einmal zu Schulze hinüber, weil einige der Pekari auf der andern Seite des Baumes wühlten, die er von seinem Standpunkte aus nicht bestreichen konnte. Dann aber blieben auch nur noch drei Tiere am Leben, sämtlich auf Friedrichs Seite.
Jetzt kletterte Unkas hinab und machte kurzen Prozeß. Einige wuchtig geführte Stöße mit seinem langen Jagdmesser befreiten auch den letzten der belagerten Jäger von seinen Bedrängern.
»Fabelhaft!« sagte Schulze, als er vom Baum herabgerutscht war und die Strecke besichtigte und hundertundzwei Leichen zählte. »Sollte man solche Zähigkeit für möglich halten?«
»Wenn man die Nachzügler der Herde schießt,« erklärte Unkas, »so kehren die Pekari nicht um; greift man aber die Vordersten an, so daß alle es sehen, so sind sie gereizt, und dann weichen sie nicht, bis entweder ihr Gegner erliegt oder sie alle bis auf das letzte die Walstatt bedecken.«
»Schade, daß wir nicht all das gute Fleisch mitnehmen können,« seufzte Schulze. »Immerhin wird es uns so bald nicht an Schweinebraten mangeln.«
Den Abend wurde noch viel von den besten Stücken gedörrt, geräuchert und gebraten, da frisches Fleisch sich in den Tropen nicht lange hält. Von den zehn Lama waren nur fünf bepackt; so ließen sich einem sechsten die Fleischvorräte aufladen, es blieb dann immer noch für jeden der Reisenden je ein Reittier; denn die Lama, so klein sie waren, hatten doch Kraft und Ausdauer genug, um sich vorzüglich zum Reiten benutzen zu lassen, auch waren sie von den Amazonen tüchtig zugeritten worden.
DIE drei Mestizen hatten in San Joaquim das seltene Glück gehabt, ein Dampfschiff zu treffen, das handeltreibend den Amazonas und den Rio Negro hinaufgefahren war und nun nach Santarem zurückkehrte. In Manaos sanden sie einen Regierungsdampfer, der nach San Paulo de Olivença hinauffuhr, und dessen Kapitän sie gerne als Reisende mitnahm, um sich ein Trinkgeld zu verdienen. So legten sie in vier Wochen einen Weg zurück, zu dem sie in einer gewöhnlichen Pirogue wohl drei bis vier Monate gebraucht hätten, ohne wahrscheinlich dabei billiger wegzukommen.
Von San Paulo aus schlugen sie den Weg nach Nueva Esperanza ein, der Stätte, wo früher Friedungs Farm gestanden war. Dort hielten sie sich einen Tag auf, um einen heimtückischen Anschlag vorzubereiten. Dann ging es weiter gegen Westen den Kordilleren zu.
Inzwischen setzten unsere Freunde in dem Gebiete zwischen dem Japura und dem Rio Iça ihre Reise fort. Es ging wiederum durch einen wildarmen Urwald, und sie waren herzlich froh an den reichen Fleischvorräten, die sie ihrer denkwürdigen Pekarijagd verdankten.
Dienstag, den 24. Dezember, schlugen sie frühzeitig ihr Lager auf; so wünschten es Ulrich und Friedrich, die viel im geheimen miteinander geflüstert hatten und offenbar irgend etwas vorhatten; denn während Unkas das Nachtessen bereitete, entfernten sie sich und baten Schulze, der sich anschließen wollte, er möchte diesmal zurückbleiben, es handle sich um eine geringfügige Überraschung. Nach etwa einer Stunde war es völlig dunkel geworden; da kehrten die Brüder zurück und baten den Professor und Unkas, ihnen zu folgen. Bald schimmerte ein heller Glanz durch das Gebüsch, und als sie auf eine Lichtung hinaustraten, zeigte sich den überraschten und geblendeten Augen Schulzes und des Indianers ein strahlender Weihnachtsbaum. Friedrich hatte ein junges Bäumchen ausgewählt, das in seinem Wuchse einer Tanne möglichst ähnlich erschien. An den Zweigspitzen hatte er mit Ulrichs Hilfe harzreiche Holzstücke befestigt, die durch zahlreiche seitliche Einschnitte in hellbrennende, kleine Fackeln verwandelt worden waren. Dann hatten die Jünglinge bunte Früchte und Blumen — was nur Farbenschimmerndes und Glänzendes zu finden war, vor allem auch die prächtigen Amazonensteine an das Bäumchen gehängt, und nun leuchtete, glitzerte und funkelte der Stegreif-Christbaum wie nur je einer in der deutschen Heimat.
Schulze stand ganz ergriffen da, Unkas aber war schier närrisch über die wunderbare Pracht und vollführte einen Freudentanz rings um den Baum herum.
Nun begann Friedrich auf seiner Nephritorgel einen Weihnachtschoral zu spielen, den die drei Deutschen mit ihrem Gesang begleiteten, während Unkas ganz feierlich gestimmt den Tönen lauschte. Hierauf sagte Ulrich das Weihnachtsevangelium her, fast wortgetreu, wie er es im Gedächtnis hatte. Und als dann bald darauf die Fackeln zu erlöschen begannen, wurde das Bäumchen geleert und das Lager wieder aufgesucht. Nach dem Nachtmahl wurde der Heilige Abend mit ernsten Gesprächen beschlossen.
Der folgende Tag wurde als Weihnachtsfest und Ruhetag gefeiert, und der Urwald hallte schon am frühen Morgen von all den alten, trauten, herzerfreuenden deutschen Weihnachtschorälen wider, die Ulrich und Friedrich auswendig wußten, während Schulze meist nur bei den ersten Versen miteinzustimmen vermochte.
Dann erzählte Friedrich dem aufhorchenden Unkas die ganze Weihnachtsgeschichte, die dem Indianer, obgleich er sich zum katholischen Glauben bekannte, bei der in der venezolanischen Republik herrschenden religiösen Gleichgültigkeit fast völlig neu war.
Der Professor war ganz gerührt: »Unsereiner,« sagte er, »macht sich in der Heimat vor lauter Gelehrsamkeit oft gar zu wenig aus der Religion. Hier aber im weiten Urwald, wo man keine Gelegenheit zum Kirchenbesuch mehr hat, erkennt man viel eher, welch herrlichen, unvergleichlichen Schatz wir an unserm trostreichen und erhabenen Christenglauben besitzen, und wie selbst die großartigsten Naturwunder und alle menschliche Größe und Herrlichkeit der unsterblichen Seele keinen solch köstlichen und unverwüstlichen Eindruck hinterlassen können wie der schlichte Ausdruck dieser ewigen Gotteswahrheiten, wie vor allem die liebliche Weihnachtsbotschaft von der schuldvergebenden Liebe eines himmlischen Vaters! Nur schade, daß die biblischen Berichte mit so viel Wundergeschichten durchsetzt sind, daß sie dem gebildeten Menschen zum Teil ungenießbar werden.«
»Sie glauben wohl nicht an Wunder?« fragte Ulrich.
»Als Mann der Wissenschaft — ne! gewiß nicht!«
»Was verstehen Sie denn unter einem Wunder, Herr Schulze?«
»Nun, alles was mit dem geordneten Laufe der Natur nicht übereinstimmt, was den Naturgesetzen widerspricht.«
»Hören Sie, Herr Professor,« erwiderte Ulrich, »wenn man genauer zusieht, so ist das nichts. Den geordneten Lauf der Natur kennen wir eben nur zum Teil, und die Naturgesetze überhaupt nicht.«
»Na, na, junger Mann!«
»Gewiß, gewiß! Naturgesetze — was wir Naturgesetze nennen — sind doch nur menschliche Ausdrücke, um bestimmte regelmäßige Tatsachen zu erklären. Da keine Beobachtungen lückenlos sind und wir ohnedies nicht wissen, ob unser Ausdruck für das anscheinende Gesetz irrtumslos richtig ist, so können wir für die unbedingte Richtigkeit eines Naturgesetzes, wie wir es aufgestellt haben, niemals Gewähr leisten. Sie sagen zum Beispiel ›Wärme dehnt die Körper aus‹. Feuchtigkeithaltende Körper aber werden von der Wärme zusammengezogen, und das Gesetz gilt überhaupt nur bis zu einem gewissen Grad; endlich erklärt es so gut wie nichts. Was ist Wärme? Ein Wunder! Was ist Ausdehnung? Ein Wunder; denn die Molekel- und Atomentheorie mit der Isolierungstendenz sind eben unbeweisbare Erklärungsversuche, die uns überdies nur neue Wunder darbieten. Und schließlich: Warum dehnt Wärme die Körper aus? Wenn Sie nun auch die Elektrizität zu Hilfe nehmen — Sie setzen stets nur wieder etwas Erklärungsbedürftiges an Stelle desjenigen, das Sie erklären wollen.«
»Das gebe ich zu, daß wir den letzten Grund der natürlichen Erscheinungen nie werden beweisen können.«
»Nun frage ich Sie: Wasser in Wein verwandeln, das halten Sie wohl für ein Wunder und daher für unmöglich?«
»Na, und ob!«
»Der Weinstock besorgt aber diese Verwandlung in jeder Minute seines Daseins, und jede Pflanze leistet ähnliches, indem sie die aus dem Erdboden aufgenommenen Zersetzungstoffe in fabelhaft kurzer Zeit in ihren eigentümlichen Saft umwandelt und zur Bildung neuer Zellen benutzt; gibt es doch Pflanzen, deren Wachstum man von Minute zu Minute beobachten kann.«
»Ja, das ist etwas andres; man weiß jetzt, daß Bazillen diese Umwandlungen vornehmen.«
»Ist das weniger wunderbar? Und merkwürdig, daß die gleichen Bazillen die gleichen Stoffe im Birnbaum in Birnensaft, im Apfelbaum in Apfelsaft, in der Tollkirsche in tödliches Gift verwandeln.«
»Halt, halt! Es werden nicht gerade immer die gleichen Bazillen sein, auch wird eine Auswahl der Stoffe getroffen werden; freilich spielt jedenfalls auch die Eigenart der Pflanze eine Rolle.«
»Dies alles zugegeben: sind nicht diese Bazillen mit ihrer wunderbaren Tätigkeit Wunder? Ist nicht die Umwandlung der Stoffe ein Wunder? Ist nicht die folgenreiche Eigenart der Pflanze ein Wunder?«
»In gewissem Sinne wohl: das sind aber natürliche Wunder.«
»Warum natürliche?«
»Weil sie im Laufe der Natur Vorkommen.«
»Also, alles, was wirklich vorkommt, ist natürlich?«
»Gewiß!«
»Also ist es natürlich, wenn ein Toter erweckt wird?«
»He! he! Das kommt nicht vor!«
»Es gibt aber doch Berichte über solche Erweckungen.«
»Freilich! Das sind aber Fabeln!«
»So? und warum denn?«
»Weil eine Totenerweckung unmöglich ist.«
»O, Herr Professor, nun habe ich Sie: sehen Sie, so sind Ihre Schlußfolgerungen. Sie sagen, eine Totenerweckung ist unmöglich, weil sie im Laufe der Natur nicht vorkommt, und wiederum: sie kommt nicht vor, weil sie unmöglich ist. Das ist der bekannte Kreistrugschluß, wo 1 durch 2 und 2 wiederum durch 1 bewiesen wird, so daß keines von beiden wirklich bewiesen ist. Meiner Ansicht nach gibt es für die Wissenschaft überhaupt nichts Unmögliches, also auch kein Wunder. Sie hat nur die Aufgabe, das tatsächlich Vorkommende zu durchforschen und zur Grundlage ihrer Schlußfolgerungen zu machen. Sie müßte sich aber immer bewußt bleiben, daß diese Schlußfolgerungen selbst zweifelhafte Notbehelfe sind, und daß immer noch neue Tatsachen entdeckt werden. Die Tatsachen sind an und für sich alle wunderbar. Ob sich eine Raupe verpuppt und in einen Schmetterling verwandelt, ob ein Käfer oder ein kleineres Insekt erst drei, vier oder noch mehr Umwandlungsstufen durchmacht, wobei Geschöpfe von den verschiedenartigsten Lebensbedingungen entstehen und ineinander übergehen, das ist an und für sich nicht weniger wunderbar, als wenn eine Leiche wieder zum Leben käme. Der einzige Unterschied ist der: das eine hat man täglich vor Augen, das andere nicht.
»Nehmen Sie an, ein Gelehrter, wie Aristoteles, träte plötzlich in unser Zeitalter herein. Um ihm die Eisenbahnen, Telegraphen, Röntgenstrahlen und so weiter als etwas Natürliches glaubwürdig und begreiflich zu machen, brauchte es eine große Arbeit mit unendlichen wissenschaftlichen Belehrungen und Erklärungen nebst Experimenten. Und dennoch stünde das alles dem Stand der damaligen Wissenschaft so fern, daß zuletzt wohl alles umsonst wäre und er sich nach wie vor in eine Welt der Wunder versetzt fühlen würde. Nehmen Sie dagegen einen modernen Menschen, der weder so viel weiß, noch so gescheit ist wie Aristoteles: ihm kommen alle jene Dinge ganz natürlich vor — auch ohne Beweise und Erklärungen, nur deshalb, weil sie ihm zum Teil von Kind auf als vorhanden bekannt sind, oder weil er ihre Entdeckung mit erlebt hat.
»Die ganze Unterscheidung von ›Wunder‹ und ›Natur‹ ist bei Licht betrachtet Schwindel; denn wenn man lange Zeit etwas geleugnet hat als ein unwissenschaftliches Wunder und kann es schließlich eben doch nicht mehr leugnen, so erfindet man ein neues Naturgesetz — und siehe da! das Wunder ist jetzt ganz natürlich und wird anstandslos von der Wissenschaft in ihren Bestand eingereiht.«
»Oho!« rief Schulze. »Da behaupten Sie doch etwas viel, mein junger Freund!«
»Nicht zu viel!« erwiderte Ulrich ruhig. »Vor wenigen Jahrzehnten verwies zum Beispiel die Wissenschaft alle hypnotischen Erscheinungen ins Reich der Fabel: sie stimmten nicht mit der Reihe der damals festgesetzten Naturgesetze. Als sich die Sache nicht mehr wohl leugnen ließ, erfand man den Namen ›Hypnose‹, stellte deren Naturgesetze auf, und nun sind die betreffenden Erscheinungen ›ganz natürlich‹. Sind sie deshalb etwa weniger wunderbar? Dinge, die zum Teil heute noch als wider alle Naturgesetze streitend für unmöglich erklärt werden, beginnt man bereits, weil sie allzugut und häufig bezeugt sind, unter dem Namen ›Hellsehen‹, ›Fernsehen‹, ›Fernwirkung‹ und dergleichen in die Wissenschaft einzubürgern. Man erfindet für die Tatsachen einen Namen, stellt einige neue Naturgesetze auf, und nun sind diese ›Wunder‹ ganz natürlich geworden! Wer verbürgt Ihnen, daß nicht in zehn Jahren als Naturgesetz erkannt ist, daß die Willenskraft oder Glaubenskraft Elemente zu verwandeln vermag und dergleichen mehr? Über die Macht der Einbildung weiß man bereits Wunder zu berichten, sollten Glauben und Willen weniger vermögen?«
»Über die Entdeckungen der Zukunft steht uns allerdings kein Urteil zu, und niemand kann wissen, was in zehn und zwanzig Jahren wissenschaftlich feststehen wird.«
»Das ist es ja, was ich sagen will,« nahm Ulrich wieder das Wort. »Die Wissenschaft hat einfach festzustellen, was wirklich da ist und vorgeht, zu erforschen, wie alles zugeht, sie hat es nur mit dem Tatsächlichen zu tun. Sobald sie aber ihre Befugnisse überschreitet und von ihrer immerhin beschränkten Erkenntnis aus über Möglichkeiten und Unmöglichkeiten ein bestimmtes Urteil fällen will, so täuscht sie sich völlig über ihre Befähigung. Wer auf Grund der Wissenschaft, der Naturgesetze und so weiter irgend etwas für ein Wunder erklärt, für unmöglich hält, der zeigt, daß er vom Wesen der Wissenschaft keine Ahnung hat, in kindischem Selbstbewußtsein einen Tümpel fürs Weltmeer hält und sich einbildet, hinter dem Horizont, der seine Aussicht begrenzt, gebe es nichts mehr. Aber die Wissenschaft steigt und steigt, und ihr Gesichtskreis erweitert sich, so daß sie immer wieder imstande und genötigt ist, ihre früheren Ansichten zu verbessern.«
»Es gibt aber doch vieles, das für alle Zeiten feststeht.«
»Sehr wohl, Herr Professor! Aber wer ist dessen sicher? Eben das, was wir für feststehend hielten, wird sich vielleicht mit der Zeit als irrig erweisen. Geben Sie mir doch nur so viel zu, daß die Wissenschaft nur über Tatsachen berichten darf, sonst aber keinen sichern Grund unter den Füßen hat; die Naturwissenschaft beispielsweise kann weder ein Geschöpf erfinden noch leugnen: ist es da, so ist es eben nicht unmöglich, so wenig es mit den Naturgesetzen übereinstimmen mag, die man lediglich aus den bisher gemachten Beobachtungen gefolgert hat; ist es nicht da — so kann es gewesen sein oder noch entdeckt werden, aber unmöglich ist es nicht. Alles, was die Naturwissenschaft sagen kann, ist: zu meinen bisherigen Beobachtungen stimmt ein solches Geschöpf nicht! Aber wieviel Tausende von Geschöpfen stimmten damit nicht und sind eben doch da oder waren vor Zeiten da.«
»Wollte ich Ihnen das zugeben, mein junger Freund, dann allerdings hörten alle wissenschaftlichen Behauptungen auf, und es blieben nur noch die Tatsachen übrig; denn wer nur einigermaßen in die Naturwissenschaft einen Einblick gewonnen hat, der weiß sehr wohl, daß die Fülle des Unbekannten, namentlich in der Kleinlebewelt und bei den Wassertieren, alles weit übertrifft, was bisher beobachtet und beschrieben ist; und doch ist das letztere schon so viel, daß kein Menschenleben ausreicht, um auch nur einen umfassenden Überblick darüber zu gewinnen.«
»Da haben wir die wahren Wunder, Herr Professor: diese Mannigfaltigkeit der Geschöpfe, das Leben, die Tatsache, daß überhaupt etwas vorhanden ist, das ist das wahrhaft Unerklärliche. Wie das Vorhandene nun aussieht, wie es sich entwickelt, verändert und verhält, das haben wir einfach zu beobachten. Für mich gibt es nur ein Wunder, das ist der Schöpfer. Aus ihm aber läßt sich alles begreifen, außer ihm gibt es kein Wunder mehr. Wer natürlich den Schöpfer leugnet — wozu, meiner Ansicht nach, eine bedeutende Verstandesschwäche gehört, der setzt an die Stelle dieses einzigen Wunders tausend andere, die einfach nicht zu erklären sind.«
»Darin gebe ich Ihnen recht,« stimmte Schulze bei. »Nur logisches Unvermögen und hohle Halbbildung können im Ernste an den Blödsinn glauben, daß der Stoff ewig war oder von selbst entstand, daß er ohne Ursache in Bewegung kam, daß alle Naturgesetze, die aus Bewegung Wärme, aus Wärme Leben und schließlich eine so wundervolle Weltentwicklung herbeiführten, eben auch ganz von selber und von Ewigkeit her waren. Der krasseste Aberglaube und Wunderglaube stehen ganz gewiß nicht auf einer solch niedern Stufe des Verstandes und des Urteils als der Glaube an diese materialistischen Hirngespinste.«
»Nun,« fuhr Ulrich fort, »da sich im Schöpfer alle Wunder und Naturgesetze erklären, so hat es für mich nichts Unmögliches, daß unter bestimmten Umständen nach des Schöpfers Willen ein Toter lebendig werden kann oder das Altern und die Sterblichkeit völlig aufgehoben werden könnten und dergleichen; das Wunder liegt in der Schaffung des Lebens überhaupt, und das Leben ist da, wir können's nicht wegleugnen. Die fortwährende Erhaltung des Lebens oder die Wiederbelebung ist dagegen eine Kleinigkeit, gar nichts so Wunderbares!«
»Freilich wunderbar nur insofern, als sie noch nicht oder nur sehr selten beobachtet wurde.«
»Also, an und für sich ist das, was da ist und nicht geleugnet werden kann, weil es eben da ist, viel wunderbarer als alles, was wir nicht oder noch nicht kennen. Wie töricht, dieses nun als unmöglich zu leugnen, nur weil es im Zusammenhang unserer beschränkten Beobachtungen und Erfahrungen noch nicht vorkommt! Ich war vor Jahren einmal im Zirkus; neben mir saß ein biederer Bauer mit seinem Buben. Der Vater wohnte zum ersten Male einer Vorstellung bei, während der Sohn bereits überall Bescheid wußte. ›Jetzt wird das Fräulein durch den Reif springen‹, sagte der Knabe. ›Sei doch nicht so dumm‹, erwiderte der Vater. ›Das ist ja gar nicht möglich!‹ Aber die Kunstreiterin sprang durch den Reif. ›Gib auf den Hanswurst acht!‹ fuhr der Sohn fort. ›Der springt dem andern auf den Kopf, überschlägt sich in der Luft und kommt wieder auf den Kopf zu stehen.‹ ›Dummkopf!‹ entgegnete der Alte. ›Schwatze doch keinen solchen Blödsinn, so etwas werd' ich dir nie glauben.‹ So ging es fort: alles, was der Bursche vorhersagte, wurde vom Vater für Unsinn und Unmöglichkeit erklärt, der Bube wurde stets als Dummkopf behandelt, weil er solchen Schwindel behaupte; und obgleich er immer recht behielt, so kam der alte Bauer doch nie zur Einsicht, daß sein Sohn Glauben verdiene. Nun, wie dieser Bauer im Zirkus kommen mir diejenigen Vertreter der Wissenschaft vor, die immer und immer wieder dieses und jenes für unmöglich erklären, und wenn es dann doch als tatsächlich erwiesen ist, nicht lernen, mit ihrem Urteil bescheidener zu werden, sondern mit ihren Behauptungen fort- und fortfahren und dabei verächtlich auf die vermeintlich beschränkten Köpfe herabblicken, die für möglich halten, was ihnen unmöglich erscheint.
»Kolumbus wird von den gelehrten Professoren in Salamanca ausgelacht, wissenschaftlich widerlegt und für einen Narren erklärt. Er aber fährt den ›Wasserberg hinab und hinauf‹ und entdeckt Amerika. Galilei wird von den Vertretern der Wissenschaft gezwungen, die Bewegungstheorie der Erde zu widerrufen — und sie bewegt sich doch! Die Weisen Europas spotten über das Märchen vom australischen Bumerang; einer von diesen Überklugen wird durch die Tatsachen in gehörige Angst getrieben. Die Akademie der Wissenschaften in Paris verkündigt, es sei unmöglich, daß Steine vom Himmel fallen: hoppla! da hagelt es gleich darauf Meteorsteine. Der Erfinder des Dampfschiffes wird für das Irrenhaus reif erachtet; das Gesetz von der Erhaltung der Kraft erscheint der Wissenschaft so unmöglich, daß keine wissenschaftliche Zeitschrift einen Artikel darüber aufnehmen will; die Erfindung einer Setzmaschine wird für unmöglich erklärt, da der menschliche Geist sich nicht durch eine Maschine ersetzen lasse; die Luftschifferabteilung in Berlin entscheidet, daß nach mathematischer Berechnung das Schwarzsche Aluminiumluftschiff überhaupt nicht steigen könne: es steigt jedoch dem mathematischen Beweis zum Trotz mit rasender Geschwindigkeit. Graf Zeppelin wird für schwachsinnig gehalten, weil er glaubt, ein lenkbares Luftschiff erfinden zu können, das alle Sachverständigen für unmöglich erklären. Die Berichte über afrikanische Zwergvölker bringen Schweinfurth in den Ruf eines Schwindlers, wie Marco Polo und andere lange Zeit wissenschaftlich über die Achsel angesehen wurden. Über die Nachrichten betreffs der Brontosauren-Knochenfunde spöttelte die ganze europäische Gelehrtenwelt: solche fabelhaften Größenverhältnisse seien wissenschaftlich einfach unmöglich! In allen diesen Fällen und in tausend andern hat sich die Wissenschaft mit ihren überlegenen Zweifeln gründlich bloßgestellt, und dennoch gibt es wissenschaftlich gebildete Leute, die nichts, gar nichts aus diesen Erfahrungen gelernt haben und meinen, nach wie vor dürften sie sich erlauben, mit einem Schein von Wissenschaftlichkeit diese und jene Berichte ohne weiteres in das Reich der Fabeln zu verweisen. — Kurz und gut, vom Standpunkt einer wahren, vernünftigen Wissenschaft aus muß einfach alles für möglich gehalten werden, und statt über tausend Dinge als Fabeln und Hirngespinste zu spotten, sollte alles und jedes unparteiisch und ernstlich auf seine Tatsächlichkeit hin geprüft werden: denn das voreilige Verwerfen von Dingen, die für unmöglich gehalten werden, hindert in unglaublicher Weise den Fortschritt der Wissenschaft und der Kultur.«
»Hören Sie,« meinte Schulze, »Sie reden da über die Grenzen der Wissenschaft wie ein alter Fachmann. Ich kann Ihnen noch lange nicht in allem beistimmen, aber die Fülle Ihrer Gründe setzt mich in Erstaunen.«
»Sie hören aus mir meinen Vater reden,« sagte Ulrich lachend. »Es lag ihm immer sehr am Herzen, daß wir die wahre Wissenschaft schätzen und uns so viel als möglich davon aneignen, aber daß wir ihr ja nicht die Stellung eines Götzen einräumen sollten, sondern uns stets darüber klar blieben, daß sie uns im letzten Grunde kein sicheres Wissen, sondern höchstens zweifelhafte Wahrscheinlichkeiten vermitteln könne, sobald es sich nicht um die einfache Feststellung von Tatsachen handelt, sondern um Schlüsse und Urteile.«
So wenig Schulze es zugab, so machte doch die innere Wahrheit so vieler von Ulrichs Bemerkungen einen nachhaltigen Eindruck auf ihn; freilich bedurfte es noch einer Reihe beschämender Erfahrungen, bis sein Wissensstolz genügend gebrochen war, daß er ein für allemal die Wertschätzung der Wissenschaft auf das richtige Maß herabschrauben lernte.
Am 26. Dezember wurde die Reise mit neuer Kraft und Frische fortgesetzt, und drei Tage darauf erreichten unsere Freunde die Ufer des Rio Iça. Hier stießen sie auf ein Indianerdorf und konnten von den Eingeborenen den genauen Weg nach Nueva Esperanza erkunden. Zugleich aber erhielten sie sehr entmutigende Nachrichten. Die Zerstörung von Friedungs Rancho durch die Napoindianer fand ihre Bestätigung, von einer Wiederherstellung der Farm wußten die Indianer jedoch nichts; auch konnte keiner sagen, was aus Friedung selber geworden sei.
Die Reise ging nun teils durch Urwalddickicht, teils durch Steppen weiter, den Umweg über San Paulo de Olivença konnten sich die Reisenden ersparen, da sie nun über die Richtung belehrt waren, die sie einschlagen mußten, um die Pflanzung zu finden.
Je näher sie aber dem Ziele ihrer Reise kamen, desto niedergeschlagener wurden Ulrich und Friedrich. Drückende Sorgen umdüsterten ihr Gemüt. Nach den am Rio Iça erhaltenen Nachrichten war es mehr als wahrscheinlich, daß ihr Vater die Stätte einer bittern Enttäuschung verlassen hatte, wenn er überhaupt mit dem Leben davongekommen war.
Und war er je allen Gefahren und Mühsalen entronnen, wer mochte sagen, wo er sich zur Zeit aufhielt?
Nach der Küste hatte er jedenfalls Nachricht gesandt, damit die Seinigen wüßten, wo er zu finden sei: er hatte sie ja aufgefordert, ihm nachzukommen. Freilich, so bald hatte er sie nicht erwartet; aber fast wollte es nun die besorgten Söhne bedünken, sie hätten besser getan, an der Küste zu bleiben, bis sie sichere Kunde über den gegenwärtigen Aufenthalt ihres Vaters erhalten hätten. Andererseits, wer konnte wissen, wie lange sie da hätten warten müssen? Wie langsam kamen doch die Nachrichten aus diesen entlegenen Wildnissen an die Postorte, die sie weiter befördern konnten! Nein! die Jünglinge hätten ihre Ungeduld nicht so lange zügeln können; und jedenfalls, dachten sie, hat unser Vater dafür gesorgt, daß in der Nähe seiner früheren Niederlassung sein gegenwärtiger Aufenthalt bekannt ist, damit er für alle Fälle erfragt werden kann. Finden wir also seine Spuren nicht bei Nueva Esperanza, so erhalten wir doch sicher in San Paulo die nötige Auskunft.
Ihre Befürchtungen hatten sie leider nicht betrogen; am Neujahrstage erreichten sie die Stätte, wo Friedung an einem Nebenfluß des Rio Iça in der Nähe der Grenzen von Peru und Ecuador sein Rancho mit so vielen Hoffnungen gegründet hatte. Aber welch einen trostlosen Anblick gewährte das Bild grausiger Verwüstung, das sich hier ihren Blicken bot: der Hato niedergebrannt, die Kulturen zerstört, die Plantagen wie mit der Sense abgemäht. Freilich, die Bananen hatten wieder ausgeschlagen, und viele Kulturgewächse waren der Vernichtung entgangen; aber alles war verwildert.

Um so betrübender sah das Schauspiel aus, als noch Teile der Umzäunung erhalten waren, so daß man auf Schritt und Tritt merkte, daß hier ein mühevolles und lohnversprechendes Werk menschlichen Fleißes dem Untergang geweiht worden war.
Den ganzen Tag blieben unsere Freunde auf diesem Schauplatz einer barbarischen und rohen Gewalttat. Als eine schmerzliche Genugtuung empfanden sie, daß sie sich hier von den Früchten der Kulturarbeit ihres Vaters nähren konnten, soweit diese in der üppigen Tropennatur die Verwüstung überdauert hatten. Schulze und auch Unkas waren voll der ehrlichsten Teilnahme für ihre jungen Freunde und halfen ihnen redlich suchen, ob nicht irgendwo eine Kunde von Herrn Friedungs Hand aufzufinden sei. Aber alles war vergeblich! Nur einige Gerätschaften und Waffen fanden sich unter den verkohlten Überresten des Wohngebäudes und wurden von den trauernden Brüdern pietätvoll mitgenommen. Ein besonders glücklicher Fund waren zwei Kisten mit Patronen, die sowohl in Schulzes als der Brüder Magazingewehre paßten, die das gleiche Kaliber hatten. Die Pekarischlacht hatte nämlich ihre Vorräte bedenklich vermindert.
Sie beschlossen nun, nach San Paulo zu gehen, in der Hoffnung, dort etwas Bestimmtes erfahren zu können. Schulze wollte sie begleiten, und wenn sich ihre Wege hier trennen sollten, noch einige zuverlässige Begleiter anwerben, mit denen er das Fabeltier aufsuchen könnte, dessen Nichtvorhandensein nachzuweisen ihm nun einmal so sehr am Herzen lag. Er gedachte demnach eigentlich nur die Stätten zu erforschen, wo es sich den Berichten nach aufhalten sollte, und nicht das Tier selbst zu finden, an das er nicht glaubte.
Sie waren noch nicht weit gekommen, als sie auf einen alten Halbblutindianer stießen, der sich sofort mit lauerndem Interesse erkundigte, ob sie vielleicht gekommen seien, Don Friedung zu suchen, und ob die jungen Sennores am Ende gar dessen Söhne seien?
Erfreut und voller Hoffnung bestätigten die Brüder diese Vermutung.
»Da kann der alte Miguel den Sennores gute Nachricht geben. Don Friedung, dessen Nachbar ich hier war, trug mir nach dem Unglück, das ihn betroffen hat, persönlich auf, wenn etwa die Seinigen hier nach ihm forschen sollten, ihnen mitzuteilen, daß er sich nach Colombia begeben habe und zwar in die Gegend bei den Ausläufern der Cordillera de los Pastos.«
»Und können Sie uns den nächsten Weg dorthin angeben?«
»Gewiß, den gleichen Weg, den Don Friedung einschlug. Wenn Sie von hier geradeaus nach Westen gehen, erreichen Sie in fünf gelinden Tagmärschen die Quellen des Rio Atajuari und in fünf weiteren Tagen den Ursprung des Rio Ambiyacu. Von dort aus ist in zwei bis drei Tagen der Rio Napo erreichbar; den gehen Sie hinauf, immer am linken Ufer bis zu seinem großen Nebenfluß, dem Rio Aguarico; diesen verfolgen Sie hierauf bis an den Fuß des Gebirges; dort wenden Sie sich nach Norden und gelangen, am Fuße der Berge hingehend, zum Rio San Miguel — Gott segne ihn! er heißt so nach meinem Schutzpatron — dieser ist ein Nebenfluß des Putumayo, des Oberlaufes vom Rio Iça, und sehet, dort, zwischen dem Rio San Miguel und dem Rio Putumayo — es ist ein Gebiet von geringer Ausdehnung — werdet ihr Don Friedung auf seinem neuen Rancho finden, jedenfalls werdet ihr Leute genug treffen, die euch den Weg dahin genau sagen können, denn er versprach, dafür zu sorgen, daß jeder, der in jener Gegend nach ihm frage, überall Auskunft bekommen solle.«
Hocherfreut über diese bestimmte und tröstliche Nachricht, dankten unsere Freunde dem alten Miguel voller Rührung, gaben ihm auch ein ansehnliches Geldgeschenk und einen Amazonenstein, welch letzterer ihn anscheinend noch mehr erfreute als das Geld.
Sie beschlossen, sofort den gewiesenen Weg einzuschlagen, und Schulze jubelte. »Das ist ja genau die Gegend, die ich zu durchforschen beabsichtige, jetzt brauche ich keine zweifelhaften Begleiter anzuwerben, gottlob! ich habe die liebste Begleitung und den zuverlässigsten Schutz, die ich mir denken und wünschen kann: na! denn man zu!«
Die Reise verlief ganz programmäßig, wie der alte Miguel sie beschrieben hatte; meist waren es ausgedörrte Llanos, die zu durchqueren waren, am Saum der Flüsse aber fand sich stets wildreicher Urwald.
Am 8. Januar wurde das Lager an den Quellen des Rio Atajuari aufgeschlagen, am 13. war der Rio Ambiyacu erreicht; am 19. gelangte man bis zum Rio Napo und am 30. zur Einmündung seines Nebenflusses, des Rio Aguarico; von dort aus ging die Reise stromaufwärts in einem herrlichen Walde am Aguarico hin.
An saftigen Braten litt jetzt Schulze keinen Mangel, und wenn nicht Friedrich seiner Jagdlust gewehrt hätte, so wäre manches Stück Wild verschiedenster Gattungen seiner nie fehlenden Büchse zum Opfer gefallen, nur, um hernach den Zamuro und Krokodilen zur Atzung zu dienen.
Vierzehn Tage darauf gelangte die Karawane an der Grenze von Ecuador und Colombia auf einen Weg im Urwald, der nicht nur gebahnt, sondern auch gepflastert war; das Pflaster bestand zum Teil aus Steinen, die mit dauerhaftem Mörtel fest verkittet waren, zum Teil aus ebenso harten Luftziegeln. Freilich war es mit einer Moosdecke überzogen, deren Grün dem Pfade Ähnlichkeit mit den Amazonenwegen verlieh, nur daß es einen weichen, äußerst angenehmen Teppich bildete, auf dem die Lama leicht einherschritten. Das Pflaster hätten unsere Freunde wohl kaum bemerkt, wenn nicht Unkas das Moos an einer Stelle entfernt hätte, wobei die Ticacuna, wie er die Luftziegel nannte, zutage traten.
Unkas war ganz begeistert; denn er hatte damit eine alte Heerstraße der Inka entdeckt, deren Ruf so weit verbreitet war, daß die Indianer am unteren Orinoko heute noch von diesem Weltwunder erzählen, von dem Unkas sich nie hätte träumen lassen, daß er es noch zu Gesicht bekäme; sprach man doch von diesen Schöpfungen der Inka wie von Mären aus grauer Vorzeit, und die Überreste davon waren so sehr in Vergessenheit geraten, selbst in den Gegenden, in denen sie sich befanden, daß nur eingeweihte Indianer sie kannten, und die hüteten ihre Kenntnis wie ein altheiliges Geheimnis. Die Grausamkeit der Spanier hatte ja die Eingeborenen überhaupt dazu gebracht, den Weißen alles zu verheimlichen, was diesen wissenswert gewesen wäre. Wie viele Eingeborene wissen noch aus uralter Überlieferung die Stellen, wo die reichen Silber- und Goldminen der Inka verschüttet liegen; aber heute noch bewahren sie darüber das strengste Stillschweigen, wie vor Jahrhunderten weder Lockungen noch Folterqualen ihren Vätern die Offenbarung solcher Geheimnisse zu erpressen vermochten.
Plötzlich stieß Unkas einen gellenden Freudenruf aus und gebärdete sich wahrhaft närrisch; er deutete nur über die Wipfel der hier lichter und niedriger stehenden Bäume, und unsere Freunde sahen alsbald, daß er einen gewaltigen Schneegipfel erblickt hatte, ohne daß sie sich erklären konnten, warum dieser allerdings sehr ungewohnte und herrliche Anblick das Herz des Indianers so sehr bewegte.
Ach! sie wußten nicht, wie der Eingeborene in den Tälern des Orinoko von Kind auf erzählen hört von den gewaltigen Bergzügen mit den eisigen Gipfeln, die das alte Reich der Inka durchziehen, von dessen Herrlichkeit ihre Sagen zu künden wissen als von einem längst entschwundenen goldenen Zeitalter.
Und der Wald hörte auf, und da lag sie vor ihnen, die himmelanstrebende Bergwand! Zuvörderst dunkle bewaldete Höhenzüge, dahinter Felsengebirge mit seltsam geformten, oft wildgezackten Gletscherhäuptern, zum Teil mit nadelscharfen Spitzen, zum Teil mit abgestumpftem Kegelgipfel; denn die meisten dieser Riesen waren furchtbare Vulkane, die mitten aus Eis und Schnee heraus verderbliche Gluten gen Himmel schleudern konnten, und deren Ausbrüche häufig Erdbeben verursachten, denen große, blühende Städte und Dörfer zum Opfer fielen: Tausende von Menschenleben wurden in solchen furchtbaren Augenblicken oft in wenigen Sekunden vernichtet.
Merkwürdig sah es aus, wenn da und dort gewaltige düstere Rauchsäulen aus dem leuchtenden Weiß der vulkanischen Schneegipfel emporstiegen.
Da sah man vor allem im Südwesten den vielzackigen Antisana bei Quito, dann den rauchenden Cotopaxi mit seiner regelmäßigen Kegelform; den merkwürdig gezackten Eiskrater des kuppelförmigen Cerro del Altar und den Rauchwolken emporschleudernden hochaufgeschossenen Gletscherturm des Sangay. Und in der Mitte zwischen diesen vier himmelanstrebenden Gipfeln schaute als Wahrzeichen der dahinter liegenden parallellaufenden Andenkette die gewaltige Masse des Chimborasso hervor, der lange Zeit als der höchste Berg der Erde gelten konnte.
Nicht weniger ehrfurchtgebietend erschien im Westen die näherliegende gipfelreiche Cordillera de los Pastos, über die vorgelagerte Bergkette emporragend.
»Antafuyu, Antafuyu!« rief Unkas immer und immer wieder, ganz außer sich vor Entzücken. Antafuyu, »die Heimat der Metalle«, ist nämlich der einheimische Name der Anden, aus dem die Spanier durch Verketzerung die Bezeichnung »Andes« gemacht haben.
Auch den folgenden Tag blieb die Andenkette in ihrer ganzen Pracht den Wanderern vor Augen, und sie konnten sich nicht satt sehen an der herrlichen, wahrhaft großartigen Aussicht auf eine Gebirgswelt, wie sie in solch überwältigender Majestät auch die üppigste menschliche Phantasie sich nicht ausmalen könnte. Nächst den Fällen des Orinoko und dem Smaragdberg der Amazonen haftete dieses Bild als das wunderbarste, das sie je geschaut, in ihrem Gedächtnis, bis späterhin noch ein viertes sich ihm anreihen sollte, das allerdings alle andern noch weit übertraf; doch davon konnten sie jetzt noch nichts ahnen.
Allmählich kamen sie dem Gebirge immer näher, und die Schneegipfel verschwanden einer nach dem andern hinter den vorgelagerten Bergzügen. Am Abend des 14. Februars langten unsere Freunde am Ufer der Andenausläufer an. Den Sonntag rasteten sie wieder und wanderten dann am 16. Februar, der Weisung des alten Miguel gemäß, nordwärts, bis sie den Rio San Miguel erreicht hatten. Dieser wurde in der Morgenfrühe des 18. Februars überschritten, und nun hatten sie das Gebiet betreten, in dem sie Friedung zu finden hofften.
Sie befanden sich hier am Fuße eines mächtigen Felsengebirges, dessen unersteigliche schroffe Wände von wilden Schluchten zerrissen waren; einige niedere, dichtbewaldete Hügel lagerten den Felsmassen vor, sonst war das Land gegen Osten flach, ein Teil der ausgedehnten Savannen, die sich vom Fuße der Anden bis fernhin zu den Llanos von Caracas erstrecken.
»ES ist doch merkwürdig,« sagte Friedrich, während Mittagrast gehalten wurde, »daß der uralte Name der Anden, ›Antafuyu‹, wie Unkas mir erklärte, ›die Heimat der Metalle‹ bedeutet.«
»Zweifellos,« erwiderte Schulze ironisch, »ist dies ein untrüglicher Beweis dafür, daß dies Gebirge irgendwo das vielgesuchte geheimnisvolle Goldland mit dem See Manoa birgt. Geben Sie nur acht, Ihnen ist es jedenfalls vorbehalten, zu entdecken, was jahrhundertelang vergebens gesucht wurde.«
»Vorerst liegt es mir viel mehr am Herzen, die Farm unseres geliebten Vaters zu entdecken; aber Ihnen, Herr Professor, prophezeie ich, daß Sie jenes Fabeltier auffinden werden, das Sie so weit in die Wildnis gelockt hat.«
»Ho, ho!« eiferte der Professor lachend. »Das wäre mir die allerfatalste Entdeckung: sie würde ja alle meine wissenschaftlichen Überzeugungen über den Haufen werfen. Sie vergessen, daß ich eben auszog, um es keinesfalls zu entdecken.«
»Nun, wenn Sie es hier nicht finden sollten, so wird man ihm eben einen andern Wohnort anweisen; ich glaube, die negative Aufgabe, die Sie sich gestellt haben, gehört zu den Unmöglichkeiten, denn es läßt sich eben nie sicher beweisen, daß etwas nicht besteht.«
»Wissenschaftlich wird alles bewiesen! Man braucht sich nur auf die Technik des Beweises zu verstehen. Es wäre doch schmählich, wenn ich Professor sein wollte und könnte nicht einmal etwas nachweisen, das ich mir nun einmal nachzuweisen in den Kopf setzte!«
»Steigt dort drüben aus dem Wäldchen nicht Rauch auf?« unterbrach plötzlich Ulrich diese Auseinandersetzung.
Der Vater der vier Augen sah nichts; aber Friedrich und Unkas bestätigten sofort Ulrichs Vermutung, und die Ruhe wurde rasch abgebrochen, da man hoffte, dort Menschen zu finden, die möglicherweise über Friedungs Aufenthalt Auskunft zu geben vermochten.
Bald war der Waldsaum erreicht; hier wurden die Ankömmlinge von zwei finster und mißtrauisch blickenden Indianern aufgehalten, die offenbar als Wachtposten aufgestellt waren. Eine Verständigung mit den Leuten, die eine ganz fremde Mundart sprachen, erwies sich als unmöglich; doch entschlossen sich unsere Freunde, auf ein Zeichen der Wächter hin, ihnen zu folgen.
Die Napoindianer, denn solche waren es, führten die Karawane auf eine große Lichtung des Waldes, wo sich ein ausgedehntes Indianerlager mit zahlreichen Zelten und auch einzelnen zerstreuten Hütten befand.
Kurze Zeit darauf standen unsere Freunde vor dem Häuptling, der kunstvoll mit Onoto bemalt war, was ihm ein ziemlich wildes Aussehen verlieh; doch trotz der finster zusammengezogenen Brauen hatte der Mann etwas Vertrauenerweckendes und Wohlwollendes in seinem Blick. Glücklicherweise sprach der Napohäuptling Spanisch, freilich mit einer höchst sonderbaren zischenden Aussprache, die den Deutschen ganz »spanisch« vorkam. Er redete sie sofort in dieser Sprache an, als er sah, daß er Weiße vor sich hatte.
»Was suchen meine weißen Brüder auf den Weideplätzen der Napo, und was führt sie in unsere Jagdgefilde? Der Weg ist weit und gefährlich von den steinernen Zelten meiner Brüder bis zu unseren wandernden Hütten; ist nicht Raum genug in den Savannen und Wäldern der Küsten und der großen Ströme, daß meine Brüder das freie Gebiet der kriegerischen Napo aufsuchen?«
Als Friedrich und Ulrich vernahmen, daß sie sich unter den Napo befanden, erfüllten schwere Sorgen ihre Herzen: waren es nicht Napoindianer gewesen, die Nueva Esperanza verwüstet hatten? War es denkbar, daß ihr Vater sich wieder in der Nähe seiner Feinde angesiedelt hatte, oder waren diese erst später hierhergezogen? Was mochte aber dann geschehen sein? Wenn übrigens das Gebiet der Napo sich so weit nach Westen erstreckte, so war es immerhin möglich, daß die hier umherziehenden Indianer ganz andere waren als jene, die Friedungs Farm zerstört hatten. Weil überdies der Häuptling nicht unfreundlich schien, hielt es Friedrich, so sehr sein Bruder ihn stupste, für am besten, frei herauszusagen, was sie hierherführte.
»Tompaipo ist zufrieden, daß keine feindliche Absicht die weißen Karai hergeführt hat,« sagte der Häuptling ernst, als Friedrich seine Darlegung beendigt hatte. »Der Häuptling der Napo bezweifelt aber, ob sie den finden werden, den sie suchen; meine roten Stammesbrüder, die nicht ferne von hier lagern, haben seine Farm niedergebrannt, weil er die heiligen Geheimnisse der Napo ergründen wollte, und Cachimana weiß, wohin er sich hernach gewendet hat.«
»O, so führet uns zu Cachimana!« bat Friedrich mit bewegter Stimme.
Blitzhand, denn dieses bedeutete des Häuptlings Name »Tompaipo«, lächelte und wies gen Himmel. »Zu Cachimana kann ich euch nicht führen; euer Gott schließt sich in ein steinernes Haus ein, denn er ist alt und krank, Cachimana aber ist ewig jung und ein starker Gott, er wohnt frei im Wald und im Feld und auf den Bergen, von denen der Regen kommt; denn er ist gut und schafft uns Wild und Früchte und sendet das Wasser aus den Wolken, wenn die Dürre uns Hunger bringt.«
»Unser Gott ist wie Cachimana,« sagte Friedrich. »Er wohnt auch nicht in Tempeln, von Menschenhänden gemacht, sondern der Himmel ist sein Stuhl und die Erde seiner Füße Schemel.«
»So spricht mein kluger Bruder, um Tompaipos Herz zu verführen; aber Blitzhand kennt die steinernen Häuser, in denen eure Götter wohnen, und er hat es gesehen in den Missionen, wie die Priester den toten Bildern Opfer bringen und Rauch aufsteigen lassen, und in jeder Mission ist wieder ein eigener Gott, und alle sind Bilder von Männern und Weibern. Cachimana ist kein Bild aus gemaltem Holz oder Stein, er ist der Große Geist der Napo.«
»Die Bilder, die du meinst, sind keine Götter; sie sind Bilder der Heiligen bei den Portugiesen oder Spaniern, wir aber sind Deutsche.«
»Wenn meine Brüder Paranaquiri sind, dann will ich ihnen glauben; aber die Jaranavi und Uavemi sind falsch wie die Jolokiamo und suchen unseren roten Brüdern ihre Religion beizubringen, nur um sie zu Poito zu machen.«
Den Sinn dieser Worte konnte Friedrich natürlich nicht verstehen, denn erst viel später, bei längerem Verkehr mit den Indianern, erfuhr er nach und nach, daß diese unter »Paranaquiri,« wörtlich »Meeresbewohner«, die Holländer an der Küste von Guayana und demnach auch die gleichfalls evangelischen Deutschen verstehen, während sie die Portugiesen »Musikantensöhne« oder »Jaranavi« heißen und die Spanier »bekleidete Menschen«, nämlich »Uavemi« oder auch »Pongheme«. »Jolokiamo« ist der böse Geist oder Teufel, von dem alles Unheil kommt, im Gegensatz zu Cachimana, dem guten Gott, und »Poito« bedeutet »Sklaven.«
Immerhin begriff Friedrich so viel, daß Blitzhand ihm einiges Vertrauen schenkte, weil er ein Deutscher sei.
Nach einer Pause fuhr Blitzhand fort: »Meine weißen Brüder sollen in meinem Lager willkommen sein, möchten sie recht lange Zeit darin verweilen; Tompaipo wird seine roten Brüder fragen, ob sie Kunde haben, wohin sich Don Friedung gewendet hat.«
Mit Dank wurde Blitzhands Anerbieten angenommen. Der Häuptling ließ sofort den Fremden eine Hütte bauen mit einem umzäumten Hof für die Lama. Noch vor Abend war der ganze Bau vollendet, da fast alle männlichen Indianer mit Hand anlegten und die Errichtung eines solch einfachen Bauwerks aus Pfosten und Rohrstäben sehr rasch vor sich geht.
ETWA zwei Stunden von Tompaipos Lager entfernt befand sich ein zweites Indianerlager am Eingang einer wilden Felsenschlucht. Es war ebenfalls eine Horde der Napoindianer, die sich zeitweilig hier niedergelassen hatte, und zwar befand sich in ihrer Mitte Narakatangetu, »der Rote Papagei«, der Morekuat oder Häuptling der ganzen großen Familie der Napo, die der Nation der Omagua angehört. Die Napo selber zerfallen in mehrere einzelne Stämme, deren einer von Tompaipo beherrscht wurde. Narakatangetu aber war das anerkannte Oberhaupt sämtlicher Napostämme, und auch Blitzhand stand unter seiner Oberhoheit. Freilich hatte der Rote Papagei selten Gelegenheit, seine Macht zu betätigen, denn die Napo sind Nomaden, und ihre einzelnen Stämme ziehen meist weit voneinander getrennt in den Savannen und Wäldern ihrer ausgedehnten Gebiete umher, und da ist denn jeder kleinere Häuptling Selbstherrscher. Wenn es aber einmal Gelegenheit gab, daß Narakatangetu einen Befehl an einen Unterhäuptling erteilen konnte, wurde unweigerlich Gehorsam geleistet. Tompaipo war der einzige, der zuweilen wagte, seinem Vorgesetzten Vorstellungen zu machen, weil Narakatangetu Blitzhands Weisheit hoch achtete.
In der Felsenschlucht, an deren Ausgang sich das Lager befand, finden wir an einem einsamen Plätzchen drei bekannte Gestalten wieder: Don José de Alvarez, Diego und Lopez, die drei Mestizen, die ausgezogen waren, El Dorado zu entdecken.
»Wißt ihr das Neueste?« begann Diego, der soeben vom Indianerlager hergekommen war und sich neben den Genossen niederließ.
»Und was wäre das?« forschte Lopez.
»Die sauberen Söhnchen Don Friedungs sind seit zwei Tagen drüben in Tompaipos Lager.«
»Carajo!« rief Alvarez aus, und seine Augen funkelten tückisch. »Diesmal sollen sie uns nicht mehr entkommen! Aber wahrhaftig, der schlaue Miguel hat seine Sache gut gemacht! Ich habe es ihm auch gehörig eingeschärft, daß er die Bübchen, wenn sie nach Nueva Esperanza kämen, hierher weisen solle, wohin wir den Napo folgten; ich versprach ihm eine glänzende Belohnung. Felipe in San Joaquim hat scheint's nichts ausgerichtet. Gut, daß wir unsere Maßregeln so reichlich getroffen haben!«
»Die Hauptsache ist, daß sie da sind,« fuhr Diego fort. »Nun müssen wir überlegen, wie wir sie ins Verderben stürzen wollen. Sie haben noch den deutschen Professor bei sich und einen der Indianer.«
»Das wäre meine geringste Sorge,« lachte Don José. »Aber Tompaipo gefällt mir nicht: mir wäre es lieber, sie wären in unser Lager geraten.«
»Je nun! Wir werden doch irgend eine List ausfindig machen, um sie den Indianern ebenso verdächtig zu machen wie weiland ihren Vater,« meinte Lopez.
»Daran soll's nicht fehlen,« beteuerte Alvarez, »und mir dämmert schon ein ausgezeichneter Plan. Ihr wißt, daß ich nicht umsonst Narakatangetus Vertrauen erschlichen habe; was ich von ihm nicht erfahren konnte, habe ich erlauscht, und was ich nicht erlauschte, habe ich durch Nachsinnen vollends herausgebracht. So kam ich zur Entdeckung der geheimnisvollen Höhle.«
»Ach! Was du immer mit deiner Höhle willst: wir waren ja letzthin alle drei darinnen, aber außer den gespenstischen Guacharo ist nichts von Wichtigkeit dort zu finden,« äußerte Diego ärgerlich.
»Caramba! Daß ihr so schwerfällig denkt! Ist es nicht offenbar, daß mit dieser Höhle ein großes Geheimnis zusammenhängt, jedenfalls das Geheimnis, dessen Entdeckung wir uns zum Ziele gesetzt haben? Denkt nur, wie sorgfältig der Eingang der Schlucht versteckt ist: das ist nicht alles Natur, da haben die Menschen nachgeholfen. Noch schwieriger ist es, in der Schlucht selber den Eingang der Höhle zu finden, und dann in der Höhle erst die bewegliche Säule! Na! ich sage euch, die Schlucht und die Höhle hätte ich nie gefunden, wenn ich nicht Narakatangetu heimlich nachgeschlichen wäre, und das Geheimnis der Säule entdeckte ich nur durch einen Zufall.«
»Und was weiter? Wir sahen ja selber, daß nichts dahinter steckt.«
»Narr! Wir haben eben nicht alles gesehen; was hätte denn Narakatangetu dort zu suchen, wenn kein Geheimnis dahinter verborgen wäre? Warum würde er so strenge Befehle geben, daß bei Todesstrafe niemand das Lager verlassen dürfe, wenn er sich dorthin begeben will? Und der junge Indianer, den er letzthin hinrichten ließ?«
»Nun? Was ist's mit dem?«
»Ich habe gelauscht: der junge Mann kam zum Häuptling und berichtete ihm, wie er durch Zufall den Eingang einer verborgenen Schlucht entdeckt habe. Der Morekuat fragte nur, ob er schon jemand anders Mitteilung von seiner Entdeckung gemacht habe; das verneinte der Jüngling. Hierauf ließ Narakatangetu den Armen binden und hinrichten — ohne alles weitere. Ihr seht, daß ein großes und wichtiges Geheimnis mit der Schlucht und Höhle verbunden sein muß, wenn der große Häuptling, der sonst nicht grausam ist, einen Menschen töten läßt, nur weil dieser zufällig Mitwisser eines Teiles dieses Geheimnisses werden konnte. Ich hätte mich daher nie mit euch in die Höhle gewagt, wenn Narakatangetu nicht auf einem Jagdzuge abwesend gewesen wäre.«
»Aber, was soll denn das große Geheimnis sein?«
»Geschwätz! Wenn ich's wüßte, wäre es kein großes Geheimnis mehr. Aber ich vermute, ja, ich bin dessen beinahe gewiß, es handelt sich um nichts anderes als El Dorado.«
»Wie kommst du zu dieser Vermutung?«
»Ganz einfach: hat Narakatangetu nicht ohne alle Umstände Friedung überfallen und seine Farm verwüstet, als ich ihm vorlog, der Deutsche wolle El Dorado ausspionieren? Nie hätte er das getan, wenn er von dem Dorado nichts wüßte und ihm nicht alles daran läge, es geheimzuhalten? Sodann habe ich schon in früheren Jahren dieses ungeheure Felsengebirge von allen Seiten umgangen: ich brauchte vier Wochen dazu — und nirgends sind die steilen Wände zugänglich; der einzige Aufgang muß durch die verborgene Höhle führen.«
»Und wenn wir nun auf die Felsen gelangten?«
»Dann wären wir in El Dorado; ihr seht ja selbst, dort oben hat es Platz genug für Dörfer und Städte, Wälder und Weiden und Seen. Ich sage euch, dort droben ist El Dorado!«
Der Mestize, dem die Ursprünge der Doradosage wenig bekannt waren, verstand unter El Dorado das vielgesuchte Goldland der Omagua und wußte nicht, daß der Name eigentlich den vergoldeten Kaziken von Manoa bedeutete. Diese Unwissenheit teilte er übrigens mit den meisten seiner venezolanischen Landsleute; die Bedeutung der Sagen verändert sich oft im Laufe der Zeiten, und falsche Begriffe schleichen sich unvermerkt ein.
»Nehmen wir an, du habest mit deinen kühnen Behauptungen recht,« nahm Lopez das Wort. »Was hat das alles mit unsern Racheplänen zu tun?«
»Wir spiegeln den jungen Deutschen vor, ihr Vater werde in der Höhle gefangen gehalten oder dergleichen; wir beschreiben ihnen die Eingänge von Schlucht und Höhle, unzweifelhaft begeben sie sich dorthin. Inzwischen erwecke ich Narakatangetus Verdacht, er entdeckt die Missetäter aus den verbotenen Wegen, und wir brauchen keinen Finger weiter zu rühren, ihr Tod ist gewiß.«
»Wohl, wohl!« nickte Diego beifällig. »Aber sie kennen uns und werden uns kein Wort glauben; einen andern aber können wir ohne eigene Lebensgefahr unmöglich ins Vertrauen ziehen.«
»Habe ich auch schon überlegt,« erwiderte Alvarez. »Einer von uns muß sich als Indianer verkleiden oder vielmehr entkleiden, ha, ha, ha! und das Vertrauen der Knaben erschleichen. Mich, der ich vorher bartlos bin, könnten sie leicht erkennen, aber einer von euch, wenn er sich rasiert und bemalt, wird unmöglich zu erkennen sein, zumal euch die Knaben auch noch nie so in der Nähe sahen wie mich.«
Lopez strich seine drei Bartspitzen und weigerte sich entschieden, seinen Stolz zu opfern. Diego zeigte sich zugänglicher und versprach, die Sache auf sich zu nehmen.
In den nächsten Tagen kam oft ein Indianer, der sich Moiatu, das ist »Die große Schlange«, nannte, in das Lager Tompaipos herüber; nach und nach schloß er Freundschaft mit den jungen Deutschen, und bald fing er an, ihnen geheimnisvolle Andeutungen zu machen, er könnte ihnen wohl Auskunft geben über den Verbleib Don Friedungs. Er verkehrte hauptsächlich viel mit Ulrich und bat ihn eines Tages, an einem entlegenen Orte wie zufällig mit ihm zusammenzutreffen und ja alles Aufsehen zu vermeiden. »Ich will meinem Bruder wichtige Enthüllungen machen,« sagte er; »aber kein Roter darf wissen, daß Moiatu dir das Geheimnis vertraut hat. Aus Liebe zu seinen weißen Freunden und aus Mitleid mit ihnen setzt sich Moiatu der größten Gefahr aus; denn er wäre des Todes, wenn es herauskäme, daß er ein Wort von den heimlichen Dingen geredet hat.«
ULRICH, der wohl ahnte, daß es sich um eine gefahrvolle Sache handelte, beschloß, Friedrich kein Wort zu sagen und zunächst für sich allein zu handeln.
Am 6. März waren Friedrich und Schulze auf Jagdabenteuer ausgezogen, während Ulrich zurückblieb; auf diesen Tag hatte er eine Zusammenkunft verabredet mit Moiatu, dem vermeintlichen Indianer, der kein anderer als Diego war.
Da sich die drei Mestizen unter den Indianern stets viel auf ihre indianische Abkunft zugute taten, war es nicht aufgefallen, daß Diego eines Tages erklärte, er wolle auch äußerlich zu den Sitten seiner Vorfahren und Stammesgenossen zurückkehren und die Spuren einer ihm verhaßten Zivilisation ablegen; ja, die Napo nahmen mit Genugtuung diesen Entschluß auf, der ganz geeignet war, ihr Vertrauen zu dem Mestizen zu erhöhen.
In Tompaipos Lager war Diego nicht weiter bekannt, und man sah ihn ruhig als Vollblutindianer an, zumal er die Sprache der Napo, in der Alvarez seine Gefährten schon unterwegs unterrichtet hatte, bereits vollständig beherrschte, unterschied sie sich doch nicht so wesentlich von einigen Mundarten, die ihm schon zuvor geläufig waren.
Da es unter den Napo immerhin einzelne gab, die fließend Spanisch sprachen, so hatte Ulrich gegen den flott Spanisch redenden Mestizen weiter keinen Verdacht geschöpft und war ganz geneigt, dem so harmlos und teilnehmend tuenden Heuchler zu glauben. Er hätte sich ja auch entfernt keinen Grund denken können, warum ihn der Mann täuschen sollte.
So ließ er sich denn leicht einreden, sein Vater sei von den Napo auf seiner Flucht gefangen genommen worden und befinde sich in einer Höhle ganz in der Nähe. Er werde nicht bewacht, da er an eine Säule gefesselt sei; nur täglich einmal werde ihm von einem Indianer Nahrung gebracht.
Auch jetzt entschloß sich Ulrich nicht, seinen Bruder ins Geheimnis zu ziehen, obgleich ihm der Indianer dringend ans Herz legte, sich ja nicht allein in die Höhle zu wagen. Eben weil es ein Wagnis sein sollte, wollte er Friedrich keiner Gefahr aussetzen. Davon sagte er dem Indianer jedoch nichts, um allen Weiterungen aus dem Wege zu gehen. Hätte Diego geahnt, daß es so stand, so hätte er freilich unverzüglich selber seine Mitteilungen auch dem andern Jüngling gemacht, denn wenn Friedrich nicht zugleich in die Falle ging, war das Werk doch nur halb getan.
Die Mestizen hatten Narakatangetu schon länger darauf aufmerksam gemacht, daß sich Friedungs Söhne in Tompaipos Lager befänden, und daß diese offenbar die gleichen Absichten verfolgten, die Don José seinerzeit dem Vater unterschoben hatte. Narakatangetu war es zufrieden, als sich Diego erbot, diese Pläne auszuspionieren.
Nun begab sich der verräterische Mestize zum Häuptling und erzählte ihm, die Knaben hätten von einer geheimnisvollen Schlucht geredet, die sie entdeckt hätten, und in der sich eine verborgene Höhle befinde; dort wüßten sie aus alten Zauberbüchern einen Weg zu großen Reichtümern, und heute nacht wollten sie sich dorthin begeben.
Der Napohäuptling tat Diego gegenüber, als ob es eine derartige Höhle weit und breit nicht gäbe und alles nur müßige Phantasie oder Prahlerei der Weißen sei; aber der schlaue Mestize wußte wohl, daß Narakatangetu nur sein Geheimnis wahren wollte und heute nacht wohl auf dem Posten sein werde. Darauf ging er hin, seinen Mitverschworenen den vorläufigen Erfolg seiner Ränke mitzuteilen.
Mit Einbruch der Nacht schlich sich Ulrich, der gar nicht in das Lager zurückgekehrt war, um durch eine nächtliche Entfernung kein Aufsehen zu erregen, dem Eingang der Schlucht zu, die ihm Moiatu beschrieben hatte. Er hatte auf dessen Rat hin die Vorsicht gebraucht, schon bei Tageslicht den Ort zu besuchen, da er sonst bei Nacht unmöglich den verborgenen Zugang entdeckt hätte.
Der Felsen war nämlich gerade an dieser Stelle derart mit den üppigsten Schlingpflanzen überwuchert, und so dichtes Buschwerk umsäumte seinen Rand, daß das schärfste Auge den schmalen Einschnitt nicht gewahren konnte, der ihn von oben bis unten spaltete.
Nur eine einzige Lücke war in dem dichten Gewirre zu finden, durch die sich eindringen ließ, und so genau sich Ulrich die Stelle eingeprägt hatte, so brauchte er doch lange, bis er sie in der Dunkelheit wiederfand. Dann wand er sich auf engem Pfade durch das Buschwerk, bis er aus ihm ins Freie trat, an einer Stelle, wo die Schlucht begann, sich zu erweitern.
Durch die schwarzen himmelanstrebenden Wände, die zu beiden Seiten die Schlucht einschlossen, schien der Streifen Sternhimmel, der von oben hereinschimmerte, in unendliche Ferne gerückt, und mit einem gewissen Gefühl der Beklemmung setzte Ulrich seinen Weg fort: es sah aus, als wollten die ungeheuerlichen Felsmassen zusammenrücken, den Erdenwurm zu zermalmen, oder als neigten sie sich über seinem Haupte, um über ihn hereinzustürzen. Keine zehn Minuten war Ulrich in der Schlucht vorgedrungen, als sie plötzlich aufhörte. Er befand sich in einem Kessel, dessen glatte Wände auf allen Seiten gleichmäßig senkrecht aufstrebten, ohne irgendwelche Spur einer Öffnung zu zeigen.
Nun zündete Ulrich eine mitgebrachte Fackel an, um eine genauere Untersuchung anstellen zu können. Diese verlief jedoch völlig ergebnislos. Erst jetzt fiel ihm ein, daß der Indianer ihm gesagt hatte, er müsse alle paar Schritte das Ohr an die linke Seite der Schlucht halten, er werde dann bald ein dumpfes Geräusch vernehmen, und an der Stelle, wo dieses Geräusch am deutlichsten zu hören sei, befinde sich der Eingang der Höhle in doppelter Mannshöhe. Diesen Rat befolgte nun Ulrich im Zurückgehen; in der Tat vernahm er bald im Innern der Felswand ein Rauschen wie von einem weit entfernten Wasserfall. Eine Zeitlang nahm das Tosen zu, dann wurde es wieder schwächer.
Sobald Ulrich diese Abnahme des geheimnisvollen unterirdischen Rauschens bemerkte, ging er wieder um ein paar Schritte zurück, bis er den Punkt gefunden zu haben glaubte, wo es am deutlichsten vernehmbar war.
Hier leuchtete er an der Felsenmauer hinauf. Eine Öffnung war nicht zu entdecken, wohl aber einige stärkere Unebenheiten, Felsvorsprünge, auf den sich ohne große Schwierigkeit emporklettern ließ.
Er schwang sich denn auch hinauf, und als er die vierte dieser unauffälligen Naturstufen erreicht hatte, gähnte ihm ein enges, schwarzes Loch entgegen, aus dem ein feuchter, kühler Luftstrom ihm ins Angesicht wehte. Von unten war diese Öffnung unmöglich zu sehen, da sie von den vorspringenden Felsen völlig verdeckt wurde.
Klopfenden Herzens kroch Ulrich in die Höhle. Würde er nun den Vater finden, und wie, in welcher Verfassung?
Kaum hatte er den Eingang hinter sich, so konnte er aufrecht gehen, ja, ein so gewaltig hoher Höhlenraum nahm ihn auf, daß ihm schien, man könnte das Ulmer Münster bequem hineinstellen. In der Höhle aber herrschte ein wahrer Höllenlärm: das war ein Schwirren und Kreischen, daß einem Hören und Sehen verging! Beim matten Scheine seiner Fackel sah Ulrich Tausende von krähengroßen Vögeln mit gebogenem Adlerschnabel umherflattern, um welchen Büschel steifer, seidenartiger Haare emporstarrten. Ihr blaugraues Gefieder blitzte im Scheine der Fackel auf, und die herzförmigen, weißen Flecken auf Kopf und Schwanz verliehen ihnen ein noch eigentümlicheres Aussehen.
Ulrich erkannte in diesen Vögeln die Guacharo, von denen er schon viel gehört hatte. Er wußte, daß sich die Indianer aus Aberglauben nicht weit in solche Höhlen vorwagen. Wenn sich also sein unglücklicher Vater hier befand, so durfte er hoffen, ihn in der Nähe des Eingangs zu finden; aber was mußte der Gefangene auszustehen haben, wenn er Tag für Tag, Nacht für Nacht diesem betäubenden Lärm ausgesetzt war? Schon jetzt tat Ulrich das gellende, widerhallende Gekreisch in den Ohren weh; und da sich die Vögel förmlich dabei ablösen, gibt es in solchen Höhlen keine Ruhepausen. Ließ sich da überhaupt Schlaf finden? Mußte nicht der Verstand auf die Dauer notleiden oder Taubheit sich einstellen?
Von solchen Gedanken gequält, schritt Ulrich weiter und weiter, jeden Winkel der Grotte beleuchtend. Er bewunderte nicht ihre kühnen Wölbungen, ihre prächtigen Tropfsteingebilde, die schweren drohend herabhängenden Stalaktiten und die mächtig emporstrebenden Stalagmiten oder die herrlichen Säulen, die aus der Vereinigung beider sich da und dort gebildet hatten und das Gewölbe zu tragen schienen: er spähte nur nach dem Vater aus, und seine Blicke suchten das fernste Dunkel zu durchbohren. An ein Rufen war bei dem herrschenden Lärme nicht zu denken.
Die Höhle begann sich zu verengern, die zusammenstrebenden Wände glitzerten, als wären sie mit Diamanten besetzt, die Decke senkte sich herab. Immer stiller wurde es: in diesem schmalen Gange war kein Guacharo mehr, bald drang das Gekreisch nur noch wie fernes Rauschen an Ulrichs Ohr. Da plötzlich stand er still. Was war das? Ein Tönen wie von einem musikalischen Instrument, leise und doch ganz nah.
Ulrich entdeckte bald die Quelle dieser Töne: einige dünne, schmale Steinplättchen lagen über einer Rille im Boden, und die abwechselnd auffallenden Wassertropfen entlockten ihnen die merkwürdigen melodischen Klänge.
Aber es galt, noch vorwärts zu eilen, die hintersten Winkel der Höhle zu durchforschen. Auf einmal jedoch schwankte der Boden unter Ulrichs Füßen, eine Steinplatte, auf die er getreten war, kippte um, er glitt aus und sank in die Knie; die Fackel entfiel seiner Hand und erlosch.
Im gleichen Augenblick wurde ihm das Gewehr von der Schulter gerissen und eine Schlinge über die Brust gestreift, die blitzschnell zusammengezogen, seine Arme jeglicher Bewegungsfreiheit beraubte.
Dann blitzte ein Licht auf, und ein hochgewachsener Indianer mit schrecklich funkelnden Augen stand vor dem gefesselten Jüngling.
»Was sucht der weiße Spion in der Höhle des Todes?« fragte eine drohende Stimme wie Gewitterrollen.
»Meinen Vater!« erwiderte Ulrich unerschrocken.
Der Indianer lachte grell auf. »Narakatangetu ist kein Knabe, der die Märchen eines Knaben glaubt: der weiße Kundschafter sage die Wahrheit; denn er hat sein Leben verwirkt.«
»Ich kann dich nicht zwingen, mir zu glauben,« erwiderte Ulrich verächtlich, »aber ich bin kein Indianer, der mit Lügen umgeht.«
»Der weiße Späher ist ein frecher Bursche,« rief der Napo wütend, aber sichtlich erstaunt über des Jünglings kühle Ruhe. »Die Söhne der Sonne sind den Tugenden ihrer Väter treu geblieben, aber die Weißen haben gespaltene Zungen; sogar ihre Haut lügt, denn sie ist weiß und umhüllt eine schwarze Seele.«
»Du kannst mich beleidigen, nachdem du mich in weibisch feiger Weise überrumpelt hast, aber dein Mut, häßliche Reden zu vergeuden, erscheint mir verächtlich.«
»Den wilden Jaguar erlegt man in ehrlichem Kampfe, aber der heimtückischen Schlange darf man mit List nachstellen.«
»Wenn ihr meinen edlen Vater, der keinem Menschen etwas zuleide tat, der im Frieden leben und für Weib und Kinder sein Land bauen wollte, überfallen konntet, sein Hato verbranntet und seine Pflanzungen verwüstet habt, so nennt das wohl ein Napo ›ehrlichen Kampf‹; wir nennen das Schurkerei und Feigheit. Wenn ihr ihn nun gefangen haltet hier in dieser Höhle, so ist das wohl eine Heldentat, eurer großen Ahnen wert?! Hundert Wilde gegen einen friedlichen Weißen: wahrhaftig, es gehört viel dazu, sich da noch seiner Ahnen zu rühmen. Sie würden sich ihrer Enkel schämen, diese Väter, die milde, tapfer und gerecht waren.«
»Dein Vater war ein Verräter ...«
»Lügner, beschimpfe meinen Vater nicht!«
»Der weiße Knabe spricht wie ein Mann. Fürchtet er nicht den Tod oder schreckliche Martern, daß er wagt, so kecke Reden zu führen, da er doch in Narakatangetus Gewalt ist?«
»Die Rothäute sind scheint's ein Volk von Memmen geworden, daß sie so viel von Todesfurcht reden, und die ›Knaben‹ mit dem Lasso fangen bei Nacht, wenn ein Fehltritt sie zu Fall gebracht hat!«
»Der Karai hat einen unerschrockenen Mut, und so spitz seine Reden sind, so sind sie doch nicht die Reden eines feigen Spions. Warum ist er dennoch gekommen, die heiligen Geheimnisse der Omagua auszuforschen?«
»Wenn du das ein heiliges Geheimnis nennst, daß ihr meinen Vater in dieser Höhle gefesselt haltet, so darf ich es mit viel größerem Recht eine heilige Pflicht nennen, wenn ich meinen Vater suche und befreien will.«
»Wer hat dem betrogenen Karai gesagt, die Napo halten seinen Vater gefangen?«
»Einer, der es wissen muß, ein Napo.«
»Der weiße Knabe folge mir! Es war beschlossen in Narakatangetus Seele, daß er das Tageslicht nicht mehr sehen solle; allein seine Rede klingt wie die Wahrheit, und sein Auge ist klar wie der Himmel am hellen Tage. Der Häuptling der Napo ahnt schlaue Ränke und will noch mehr aus dem Munde seines Gefangenen vernehmen, ehe er über sein Schicksal entscheidet. Die Wege der Nacht sind dunkel; doch das Auge der Sonne beleuchtet sie hell, wenn die Zeit Jolokiamos vorüber ist und die Stunde Cachimanas erscheint.«
Mit diesen Worten führte der Häuptling den gebundenen Jüngling aus der Höhle in das Lager und in sein eigenes Zelt.
FRIEDRICH war am Nachmittage des 6. März mit Schulze jagen gegangen. In der Nähe war die Jagd nicht besonders ergiebig, da die Savanne dürr lag und keine größeren, zusammenhängenden Wälder, sondern nur verhältnismäßig wenig umfangreiche Büsche am Fuße des Gebirges die Ebene unterbrachen.
So zogen denn die beiden längere Zeit vergebens an den Bergen hin, wobei sich das Gespräch, wie häufig in der letzten Zeit, um das Fabeltier drehte. Die Napo wußten nämlich viel von dem Lindwurm zu erzählen; mehrere von ihnen wollten ihm schon begegnet sein und berichteten haarsträubende Geschichten über seine Größe und seine Kraft; mit seinem ungeheuren Rachen verschlinge er ein halbes Dutzend Krieger auf einmal, und zu überwinden sei er überhaupt nicht, da man ihm tausend Wunden beibringen könne, ohne daß er irgend etwas zu spüren scheine.
Schulze freute sich königlich, daß doch das Jägerlatein eine Allerweltssprache und an den Lagerfeuern der Rothäute genau so zu Hause sei wie an den Stammtischen Deutschlands.
Friedrich meinte immer, es müsse doch etwas an der Sache sein; aber der Professor verlachte ihn im Namen der Wissenschaft und erklärte, wenn man einmal so etwas glaube, dann sei überhaupt keine Autorität der Wissenschaft mehr anzuerkennen, sondern man müsse sagen, die Wissenschaft habe stillzuschweigen, sie könne nur noch über erwiesene Tatsachen bescheiden Bericht erstatten, nicht aber sich anmaßen, über Möglichkeiten und Unmöglichkeiten irgend ein maßgebendes Urteil abzugeben.
Friedrich erwiderte, es wäre gar kein Schade, wenn die Männer der Wissenschaft einmal zu dieser demütigen, aber allein richtigen Erkenntnis kämen; dann würde die Wissenschaft den Mund nicht mehr so voll nehmen und wie vom Himmel herab urteilen und aburteilen, wodurch sie manchen Fortschritt im Keime ersticke, oder wenn er sich ihr zum Trotz entwickle, hinterher jämmerlich blamiert sei.
Von solchen laienhaften Angriffen auf die erhabene Wissenschaft wollte jedoch der Gelehrte nichts wissen; natürlich war auch sein bißchen Eitelkeit mit im Spiele. Denn wenn die Wissenschaft ihren strahlenden Heiligenschein verlor, dann wurden selbstverständlich auch ihre Priester nicht mehr mit der gehörigen Ehrfurcht angestaunt. Der Weihrauch, den man den Götzen streut, steigt doch in die Nase der Priester; diese haben den Genuß davon, die toten Bilder bedürfen seiner nicht.
Also Schulze hatte auch sein bescheidenes Weihrauchsbedürfnis und trat daher rücksichtslos für die Unantastbarkeit seiner Göttin, der Wissenschaft, ein. »Sehen Sie, lieber Freund, was Sie da reden, das ist sozusagen Mumpitz, genau so wie der Lindwurm der Napo, der eine Fabel ist, ein Schemen, ein Hirngespinst, eine Ausgeburt ...«
»Da ist er!« rief Friedrich.
Der Professor fuhr erschrocken zurück; er war todesblaß. »Wie? ... Was? ... Wo? ...« stammelte er. »Nein, Sie schnöder Kamerad, einen so zu erschrecken!«
Friedrich lachte: »Wie kann man nur vor etwas erschrecken, an das man durchaus nicht glaubt, das wissenschaftlich einfach unmöglich ist, eine Fabel, ein Schemen, ein Hirngespinst, eine Ausgeburt ...«
»Na, na! Ich bitte Sie, hören Sie auf, Sie Spötter; aber kein Wunder, daß ich erschrak: wenn man von solchen Dingen spricht, und die Phantasie ist vollständig damit beschäftigt, und plötzlich erfolgt ein derartiger Ausruf! Das klang so bestimmt, so tatsächlich; eine solche Verstellung hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut.«
»Es war auch gar keine Verstellung. Ich selber wäre durchaus nicht überrascht, wenn wir im nächsten Augenblick das Tier erblickten; denn — hören Sie nur! Haben Sie je so etwas gehört, dieses dumpfe Schnauben — allerdings noch in ziemlicher Ferne, aber nun doch schon deutlicher als vorhin? Diese Töne waren es, die unwillkürlich meinen Ausruf veranlaßten; es war gewiß keine beabsichtigte Bosheit dabei.«
Schulze horchte. »Das ist in der Tat ein merkwürdiges Blasen; aber es läßt sich wissenschaftlich leicht erklären: sehen Sie, diese Felsenberge sind voller tief eingeschnittener Schluchten, und dort drüben ist gerade wieder der Eingang in eine solche. Von dorther kommt auch deutlich das Geräusch. Verfängt sich der Wind in diesen schmalen Felsritzen, so muß er nach den Gesetzen der Akustik derartige eigentümliche Laute notwendig erzeugen; die Schallwellen können sich nach rechts und links nicht ausdehnen, es entstehen Reibungen, Häufungen, Verstärkungen, Rückschläge, Verdichtungen, und das alles ist wohl geeignet, Töne hervorzubringen, die den Eindruck des eben vernommenen Niegehörten machen. Erinnern Sie sich nur der Felsenorgel bei Carichana.«
»Das alles ist freilich unleugbar und wissenschaftlich wohl begründet; nur habe ich zwei Bedenken gegen Ihre überzeugende Erklärung, Herr Professor; erstens geht kein Wind, sondern die Luft ist so still wie das Grab; zweitens handelt es sich hier nicht um eine enge Felsenritze, sondern, wie Sie sehen, um eine ziemlich weite Schlucht, deren Eingang ich auf fünfzig Meter Breite schätze.«
Sie waren inzwischen an den allerdings im Vergleich zu vielen andern Einschnitten dieses Gebirges weit zu nennenden Eingang des berufenen Tales gelangt, und das Schnauben, das ihnen daraus entgegenscholl, begann einen unheimlichen Charakter anzunehmen.
Friedrich bog unbekümmert in die Schlucht ein.
»Ums Himmels willen, was fällt Ihnen ein!« rief Schulze erschrocken. »Begeben Sie sich doch nicht mutwillig in eine unbekannte Gefahr.«
»Im Interesse der Wissenschaft müssen wir doch diesem Rätsel auf den Grund gehen, Herr Professor; ich meine, hier haben Sie die günstigste Gelegenheit, Ihren gewünschten Nachweis zu liefern, daß jenes Ungeheuer in Wirklichkeit nicht vorhanden sei, wenn Sie sich durch den Augenschein überzeugen, daß man ein fabelhaftes Geschnaube hören kann, das dennoch von keinem Fabeltiere herrührt.«
Wo es das Interesse der Wissenschaft galt, konnte der Professor, ohne sich bloßzustellen, nicht weniger Mut zeigen als sein junger Gefährte, den die Wissenschaft nichts weiter anging. Er folgte denn, wenn auch in einigem Abstand.
Das Tal zog sich in mehreren Schlangenwindungen in das Felsengebirge hinein. Bei einer Biegung hielt Friedrich plötzlich inne mit seinem kühnen Vormarsch und erwartete Schulzes Nachkommen.
»Und da ist es doch, Herr Professor! Nun, sind Sie bekehrt?« rief er ihm zu.
Der Mann der Wissenschaft war tatsächlich bekehrt, überzeugt, überwunden: das bewiesen seine weitgeöffneten Lippen und sein zu Berge stehendes Haar. Jetzt wäre er geflohen, auf die Gefahr hin ausgelacht zu werden, hätten ihm nicht die zitternden Füße den Dienst versagt.
Etwa hundert Schritte vor ihnen wand sich ein Reptil durch die Schlucht, die es mit seinem dicken Leibe fast ausfüllte: die Felswände standen nämlich hier kaum noch drei Meter voneinander, und der Körper des Riesenwurmes maß mindestens zwei Meter im Durchmesser. Man hätte glauben können, die berühmte Seeschlange vor sich zu sehen, so krümmte sich der ungeheure Leib in zahllosen Windungen; die Länge des Scheusals mochte an die dreißig Meter betragen, und entsetzlich war es anzusehen, wie der Vorderleib im langsamen Vorwärtskriechen bald rechts, bald links an den Felswänden bis zu einer Höhe von fünf Metern emporglitt, um dann schwerfällig wieder hinabzusinken; dabei zeigten sich zwei mächtige Tatzen mit armdicken Fingern, zwischen denen das widerliche Geschöpf wohl einen Jaguar ersticken mochte. Der Kopf, der sich bei den emporschlängelnden Bewegungen oft nach hinten zurückwendete, sah wahrhaft grauenerregend aus; die kürbisgroßen, blöden Augen quollen weit hervor, und der gähnende Rachen konnte gewiß, wie die Napo berichtet hatten, sechs Männer mit einem Schnapper verschlingen. Die harten, gezackten Kiefer ersetzten ohne Zweifel die Zähne so vortrefflich, daß sie dem stärksten Stier mit einem Bisse alle Knochen im Leibe zermalmen konnten. Am entsetzlichsten aber erschien das boshafte Grinsen des Maules, das, ähnlich wie beim Krokodil, bis weit unter die Augen geschlitzt und am Ende seines Spaltes nach oben gekrümmt war, so daß es beständig den Eindruck des Lachens hervorrief — ein wahrhaft gräßliches Lachen, das dem mutigsten Manne das Blut in den Adern erstarren lassen konnte, im Verein mit dem boshaften Blick der tückischen matt und langsam rollenden Augen.
Friedrich war im Begriff, sich mit Schulze möglichst rasch und geräuschlos zu entfernen, als er im Hintergrunde der kesselförmig abgeschlossenen Schlucht einen hochgewachsenen jugendlichen Indianer gewahrte, der, nur mit einem Speer bewaffnet, dem Nahen des Ungetüms entgegensah. Einen Ausweg hatte der Unglückliche nicht: den einzigen Ausweg aus dieser Sackgasse verschloß ihm der auf ihn zu kriechende Drache.
Es war offenbar, daß dieser den Bejammernswerten als seine sichere und willkommene Beute betrachtete, als ein kleines Insekt, das er mehr zum Leckerbissen als zur Stillung seines Hungers wegzuschnappen gedachte.
Immerfort schielte das Untier nach dem in starrer Ruhe ihm entgegensehenden Jüngling, der doch seines Loses gewiß schien. Wohl hielt er seine Lanze gezückt, eine mächtige Waffe, die einem Kaiman oder Bison hätte lebensgefährlich sein mögen — aber was sollte dieses Holzsplitterchen mit der eisernen Spitze solch einem Lindwurm gegenüber, der sich schon lüstern mit der plumpen Zunge die wulstigen Lippen leckte, unbekümmert darum, daß das zu verschluckende Insekt einen harmlosen Stachel besaß?
Schulze hatte sich inzwischen aus seiner Betäubung aufgerafft. »Kommen Sie, eilen Sie! Fliehen wir, ehe es zu spät ist!« flüsterte er Friedrich zu.
Dieser blickte währenddessen unverwandt nach dem Indianer, der erst jetzt die beiden bemerkte und den teilnahmsvollen Blick mit einem trüben Lächeln erwiderte.
»Ich kann den unseligen Menschen nicht feige in seiner Todesnot ohne Beistand lassen,« erwiderte Friedrich auf Schulzes Drängen.
»Aber sind Sie wahnsinnig? Was wollten wir gegen ein solches Gewürm ausrichten? Soll es zwei oder drei Opfer haben statt eines einzigen? Auf das kommt doch jeder Versuch der Hilfeleistung hinaus! Nehmen Sie Vernunft an und begeben Sie sich nicht aus falschem Edelmut in den sicheren Rachen des Todes.«
»Herr Professor, Sie meinen es gut — aber ich kann Ihnen nicht folgen. Leben Sie wohl und grüßen Sie Ulrich; aber beeilen Sie sich, daß Sie hinwegkommen.«
»Nein!« sagte Schulze mit festem Entschluß. »Werde, was da wolle, allein mache ich mich keinesfalls aus dem Staube; ich werde immerhin auch ein paar Kugeln in den Leib des Ungetüms senden; vielleicht wird es dann doch bewogen, umzuwenden, und bei seinen trägen Bewegungen ist eine Flucht in solchem Falle nicht aussichtslos.«
Er glaubte wohl selber nicht, was er da sagte; denn die Indianer hatten oft von den ungeheuren Strecken erzählt, die der Lindwurm in kurzer Zeit zurücklege, so daß der beste Reiter ihm kaum entrinnen könne. War das Tier auch anscheinend von Natur träge, so mußte es bei seinen riesigen Körperverhältnissen doch mühelos mit einem einzigen Ruck seine zehn Meter zurücklegen können — und alle paar Sekunden so einen Ruck, da ließen sich ziemliche Leistungen herausrechnen!
Jetzt eilte es ihm anscheinend nicht; es spielte mit seinem Opfer wie die Katze mit der Maus; das zeigten die vielen Wendungen nach rechts und links an den Felswänden hinauf. Offenbar war es sich bewußt, daß es für seine Beute kein Entrinnen gab.
Doch Friedrich gab sich keinen solchen Betrachtungen hin, sondern er handelte, und zwar rasch. Er sah mit einem Blicke, daß die Felswand zur Linken, wenn sie auch größtenteils senkrecht emporstieg wie die gegenüberliegende, doch bis zu einer Höhe von zehn oder zwölf Metern für einen gewandten Kletterer Anhaltspunkte genug bot: da waren Rinnen und Vorsprünge, und an einigen Stellen erhoben sich von der Talsohle aus ganze Mauern aufeinandergetürmter Felsblöcke von verschiedener Größe, die sich an die Hauptwand anlehnten. Sie mochten früher von oben herabgestürzt oder durch gewaltige Wasserfälle losgerissen und herabgespült worden sein.
So begann denn Friedrich eine Kletterpartie, um in die Nähe des Indianers zu gelangen; ohne sich unmittelbar neben dem Drachen durchdrücken zu müssen, der ihn gewiß bei einer seiner Bewegungen an der Felswand zerquetscht oder erstickt hätte.
Kaum erkannte der junge Indianer Friedrichs Absicht, als er, höchlichst erstaunt und voller Bewunderung eines solchen Todesmutes und Edelsinns, mit lebhaft abwinkenden Gebärden bedeutete, der tapfere Jüngling möchte von seinem Vorhaben ablassen und schleunigst fliehen.
Friedrich aber ließ sich nicht beirren. Schon war er so weit vorgedrungen, daß er unmittelbar über dem Kopfe des Ungetüms auf einem Turm von Felsblöcken stand, etwa acht Meter über dem Erdboden, als das Reptil seinem Opfer so nahe gekommen war, daß der Indianer von seiner Lanze Gebrauch machen konnte. Blitzschnell führte er Stoß auf Stoß gegen die Lippen des Ungeheuers, das durch diesen wütenden Angriff nicht wenig verblüfft zu sein schien. Es leckte sich die geritzte Haut; doch war diese so dick, daß keiner der Stiche auch nur die geringste Blutung verursachte. Zuletzt stieß der Indianer seine Lanze mit aller Wucht in das rechte Auge des Lindwurms, der sich etwas beunruhigt schüttelte. Der Fremdkörper im Auge mochte ihm unbequem sein, es quoll auch dickes Blut neben dem Schaft der Lanze hervor; im übrigen schien bei der Größe des Auges und bei der Nachgiebigkeit seiner Hornhaut der eingedrungene »Splitter« nicht einmal die Sehkraft merklich zu beeinträchtigen.
Inzwischen hatte Friedrich das linke Auge des Scheusals aufs Korn genommen. Er hielt mit Recht die Augen für die empfindlichsten Teile eines Riesentieres, in dessen Fleischmassen ganze Mengen von Kugeln spurlos und wirkungslos hätten verschwinden müssen. Die erste Kugel beachtete das Tier nicht; als sich aber eine Kugel um die andere in sein Auge bohrte, fing es an, den winzigen Gegner ernst zu nehmen. Es wandte sein Haupt Friedrich zu, hob es empor und sperrte den Rachen weit auf: es gedachte sicherlich, im nächsten Augenblick den verwegenen Schützen in seinem Schlunde verschwinden zu lassen.
Friedrich schien verloren und wußte sich selbst keine Rettung mehr; da fühlte er den mächtigen Felsblock unter seinen Füßen schwanken. Um ein Haar wäre der Jüngling heruntergefallen und hätte dem Tiere eine geringe Mühe erspart, indem er von selbst in den offenen Rachen gestürzt wäre; aber behende sprang er vom Block herab zur Seite auf einen niedriger gelegenen; und da kam ihm ein verzweifelter Gedanke: er stemmte sich aus aller Kraft gegen das schwankende Felsstück, auf dem er zuvor gestanden hatte, und siehe da, der umfangreiche Block kam vollends aus dem Gleichgewicht und stürzte mit furchtbarer Wucht in den gähnenden Schlund des Ungeheuers.
Solch einen Brocken mochte der gefräßige Geselle noch nie geschluckt haben, er brachte es auch jetzt nicht fertig. Die Schwere des Steines riß seinen Kopf zu Boden und preßte seinen halb zerschmetterten Unterkiefer so fest auf den Grund, daß er vorerst wie festgenagelt liegen blieb. Um so heftiger arbeitete der Riesenleib, und es war fraglos, mit der Zeit mußten diese krampfhaften Bewegungen das Gewicht des Blockes überwinden, und das Tier würde den Kopf wieder freibekommen. Friedrich beeilte sich mittlerweile, das Ungetüm womöglich völlig zu blenden, indem er beide Augen unaufhörlich mit seinen Kugeln durchlöcherte.
An eine Flucht war nicht zu denken, da der Leib des Reptils in seinen gewaltigen Zuckungen die Felswände zu beiden Seiten geradezu abfegte und jeden zerschmettert haben würde, der es versucht hätte, durchzukommen.
Schulze schoß von hinten fortwährend in die sich aufbäumenden Fleischmassen, wenn da überhaupt Fleisch vorhanden war und nicht bloß Fett; seine Kugeln hatten aber nicht die geringste Wirkung.
Allein nun sprang der Indianer zu Friedrich hinüber und begann einen Felsblock um den andern auf das machtlose Haupt des Scheusals hinabzurollen. Der Mann besaß Riesenkräfte, und Friedrich, der ihm alsbald beistand, hatte den Eindruck, als seien seine eigenen Anstrengungen völlig überflüssig.
In Zeit von einer Viertelstunde war von dem widerlichen Kopfe nichts mehr zu sehen, er war unter einem Berg von Felsblöcken begraben, die Augen waren jedenfalls völlig vernichtet, und eine Befreiung des Drachen war nicht mehr zu befürchten, er hätte sie denn mit Hinterlassung seines Hauptes bewerkstelligen können. Dieses schien aber doch einen wesentlichen Bestandteil seines Daseins auszumachen; denn die Zuckungen des Leibes wurden immer schwächer und hörten zuletzt ganz auf.
Da tat der Indianer zum ersten Male seinen Mund auf, um zu reden, und zwar sprach er zu Friedrichs größter Verwunderung Deutsch und merkwürdigerweise in ganz altertümlichen Redewendungen. »Niemalen zît Jahrhunderten, als Menschen gedencken, ist solch Gewürm von eines Menschen Hand erlegt worden: Ihr seid ein teutscher Held, als jemalen gewest seind und habet ein fremd und welsch Blut aus Todes Noth befreiet mit kühnlichem und treuem Muth, deß ich Euch meines Lebens Zît zu gedancken schuldig bin, als ich auch mit Freuden zu thun gelobe. Deß nehmet hie ein Wahrzeichen.«
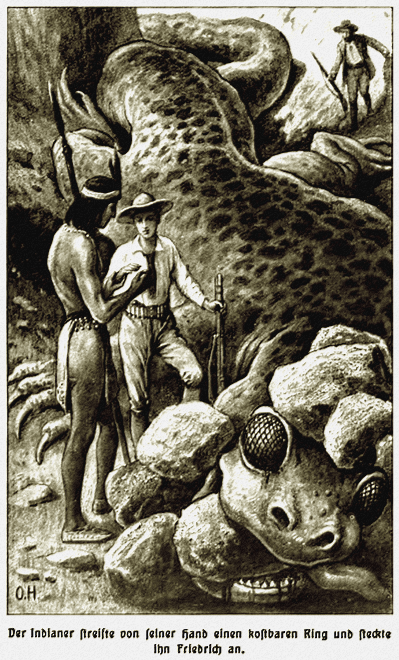
Und damit streifte er von seiner Hand einen kostbaren Ring in Form einer gewundenen Schlange, mit blitzenden Edelsteinen besetzt, und steckte ihn Friedrich an. Dann nickte er ihm freundlich zu und sprang über den Leib des toten Reptils wie über eine Brücke weg am verblüfften Schulze vorbei und war alsbald hinter der nächsten Wegbiegung verschwunden.
Friedrich mochte nicht über den Körper des Ungetüms turnen; er benutzte den schmalen Raum, den dieser frei ließ, und drückte sich zwischen der weichen, unförmlichen Masse und der Felswand durch; dann begab er sich mit dem erschöpften Gelehrten, den der Kampf viel mehr angegriffen hatte als den mutigen Jüngling, ins Lager zurück, wo sie bei sinkender Nacht eintrafen.
Nachdem sie so recht erlebt hatten, welche unerhörten Gefahren einem Menschen in diesen abgelegenen Erdenwinkeln begegnen konnten, war es ihnen eine doppelt große Sorge, daß sie Ulrich nicht antrafen und niemand ihnen über seinen Verbleib Auskunft zu geben vermochte. Friedrichs Angst wuchs von Stunde zu Stunde; trotz der Anstrengungen des Tages konnte er vor Sorge um den Bruder die Nacht keinen Schlaf finden, und in aller Frühe zog er aus, ihn zu suchen, nachdem auch Tompaipo ihm versprochen hatte, sein Möglichstes zu tun, um über das Schicksal des Vermißten sichere Kunde zu erhalten.
Schulze hatte schon am Abend Friedrichs Heldentat überall ausposaunt: diesmal wollte aber ihm niemand glauben, und alle hielten seine Erzählung für das großartigste Jägerlatein, da der Lindwurm einfach für unbesiegbar galt. Man lachte und sagte, es werde sich um ein Krokodil oder um eine Riesenschlange handeln, die seine Phantasie mit Hilfe der Gelehrtenbrille vergrößert habe.
Als aber am andern Morgen einige Männer nach dem Schauplatz des Kampfes zogen und außer sich vor Staunen in wilder Freude zurückgerannt kamen, um die Wahrheit von Schulzes Angaben zu bestätigen, pilgerte das ganze Lager hinaus, und von nun an betrachteten die Napo Friedrich mit Ehrfurcht als den größten Helden aller Zeiten.
FRIEDRICH irrte ziemlich planlos umher, fehlte es ihm doch an jeglichem Anhaltspunkt über die Richtung, in der er den Bruder suchen mußte. Gegen Mittag bemerkte er, daß er sich im Kreise bewegt hatte; denn er befand sich gar nicht weit von dem Wald, in dem das Lager der Napo aufgeschlagen war. Die Stelle, an die er soeben gelangte, betrat er zum erstenmal: es war ein niedriger Hügel, auf dessen Gipfel einige Felsblöcke im Kreise umherlagen, die ihn an die Verschanzung auf dem Islote erinnerten; möglich, daß sie zu ähnlichem Zwecke einmal von Menschenhand hierher gewälzt worden waren. Inmitten dieser Blöcke lagerte sich der Jüngling, denn er war müde und hungrig. Seinen Hunger stillte er aus den mitgenommenen Vorräten; dann streckte er sich aus und verfiel unversehens vor Übermüdung in einen tiefen Schlaf.
Zwei Stunden mochte er so geschlummert haben, als er plötzlich aufwachte, eine Hand hatte seine Stirne berührt, und legte sich nun auf seinen Mund. Friedrich fuhr auf.
»Pst, pst!« machte Schulze. »Seien Sie mäuschenstill! Entschuldigen Sie, mein Ritter Georg und Drachentöter, daß ich Ihre wohlverdiente Ruhe zu unterbrechen wagte; aber ich fürchtete, Sie möchten geräuschvoll aufwachen, wenn es gerade am wenigsten angezeigt wäre. Ich habe nämlich diesen ausgezeichneten Beobachtungs- und Lauscherposten entdeckt, und dort unten sind zwei, die offenbar Geheimnisse miteinander verhandeln. Vielleicht schnappen wir einiges auf, was uns auf Ulrichs Spur bringt.«
»Heimliches Lauschen und Ausspionieren ist nicht mein Geschmack,« erwiderte Friedrich, unwillkürlich in Schulzes Flüsterton verfallend.
»Mag sein; aber in diesem Falle ist es geboten: heimtückische Verschwörer müssen mit List entlarvt werden. Tompaipo hat mir etwas ganz Verdächtiges, er kann einen so sonderbar ansehen, als ob er Dinge wisse und Anschläge im Schilde führe, von denen wir gewöhnliche Sterbliche nichts ahnen. Es kann keinesfalls schaden, wenn wir hinter seine Schliche kommen. Und er verhandelt soeben mit einem Schurken, den ich vom Lager der Guahibo her in unangenehmster Erinnerung habe, und der auch Ihnen mehr als einmal übel mitspielte.«
Friedrich war noch lange nicht mit Schulzes Absicht einverstanden; als er aber einen Blick zwischen den Felsblöcken hindurch warf, sah er am Fuße des Hügels, kaum hundert Schritt von sich entfernt den Mestizen Don José de Alvarez, der mit leiser Stimme eifrig auf Tompaipo einredete.
Nun schien ihm die Sache doch wichtig!
Freilich half die äußerste Anspannung der Gehörnerven nichts, der Mestize sprach so vorsichtig, daß kaum hie und da eine Silbe für die Lauscher verständlich wurde, und Tompaipo lag, die Pfeife rauchend, da und hörte ihm mit unbeweglichen Gesichtszügen zu, nur selten ein kurzes Wort dazwischenwerfend.
Endlich schien Alvarez zu Ende zu sein; der Häuptling erhob sich langsam und würdevoll, und da er nicht bloß durch seine Körperlänge, sondern auch durch seinen Standpunkt den Mestizen überragte, mußte dieser zu ihm aufblicken. Man sah, wie lauernd Don Joses Augen sich bemühten, Tompaipos Antwort von dessen Lippen vorwegzunehmen.
Aber Tompaipo antwortete zunächst mit der Hand, eine gewaltige Ohrfeige sauste auf die hagere Wange des Mestizen hernieder, so daß der verblüffte Spanier zur Seite taumelte; alsbald stellte aber eine zweite Ohrfeige auf den andern Backen das Gleichgewicht wieder her. Blitzschnell klatschten nun die Backpfeifen abwechselnd rechts und links auf die sich feuerrot färbenden Wangen des völlig fassungslosen Opfers.
Niemals hatten Schulze und Friedrich gehört oder gesehen, daß diese europäische Art, der höchsten Entrüstung Ausdruck zu geben, bei den würdevollen Söhnen der Wildnis üblich sei. Sie mußten beinahe lachen über das köstliche Schauspiel, das sowohl der Indianer mit seinen raschen Bewegungen, die man gar nicht an ihm gewohnt war, als auch der Mestize in seinem ratlosen Staunen und seinem hilflosen Ingrimm bot.
Dazu kam, daß Tompaipo jede seiner Ohrfeigen mit der Anrufung eines spanischen Heiligen begleitete, wobei seine eigentümliche Aussprache erheiternd wirkte: »San Eschteban, Santiago de Camposchtella, San Schose, San Michel (statt Miguel), San Chrischtophoro!« so donnerte er dazwischen.
Endlich kam der Geohrfeigte so weit zur Besinnung, daß er sich durch eine rasche Flucht weiteren Mißhandlungen entzog. Er lief wie ein Hase, obgleich Tompaipo an keine Verfolgung dachte, sondern sich mit herzlichem Lachen wieder bequem auf die Erde hinstreckte: — ein lachender Indianerhäuptling — schon wieder ein neues Wunder!
Nun aber geschah etwas, was die Lauscher vollends ganz aus der Fassung brachte: Tompaipo begann mit lauter Stimme in abgebrochenen Sätzen ein Selbstgespräch zu führen, und dieses lautete also:
»Na! der Kerle hat sei' Sach! — Aber dees isch emol e saudumme G'schicht mit dene Bube! Der Ulrich hat sich e schlimme Supp' ei'brockt! ... Wann i nur wüßt', wie i den Narakatangetu — e blitzwüschter Nam', der ei'm schier 's Maul verreißt — 'rumkriege könnt'!«
Und sinnend saß er da.
Schulze glaubte den Verstand zu verlieren, er flüsterte Friedrich zu: »Bitte, kneipen Sie mich mal ins Ohr, aber man fest, daß ich total aufwache; so verrückt habe ich im Leben noch nicht geträumt!«
»Es geht mir wie Ihnen,« erwiderte Friedrich ebenso leise. »Nur daß es wahrhaftige, wachende Wirklichkeit ist!«
»Aber hören Sie mal, da hört sich doch alle Wissenschaft und Menschenmöglichkeit auf; das ist ja wohl Bayrisch oder Schwäbisch, was die olle Rothaut da redet? Wo zum Kuckuck soll der Mensch in der tropischen Wildnis das aufgeschnappt haben?«
»Gutes Schwäbisch ist es, und zwar muß der Häuptling ein geborener Schwabe sein. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir hier dran sind; gestern redet mich ein Indianerjüngling in mittelalterlichem Hochdeutsch an, heute brummt ein alter Napohäuptling in gemütlichen Schwabenlauten vor sich hin! He da! Herr Professor, halten Sie jetzt überhaupt noch etwas für unmöglich?«
»Nee! Ich bin vollständig auf dem Nil-admirari-Standpunkt angelangt, meinetwegen darf mich jetzt das nächste beste Krokodil anreden und mir ›Mahlzeit‹ wünschen, oder unser Brüllaffe Salvado darf zu mir sagen: ›Mein Name ist Schulze, ich habe die Ehre, mich als entfernten Vetter von Ihnen vorzustellen, indem ich von einer Seitenlinie Ihrer Familie aus der Zeit der Darwinschen Entwicklungsvorgänge stamme.‹ Ich schwöre Ihnen, ich werde das als etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches ansehen und dem guten Vetter sofort Schmollis anbieten. Ich glaube in der Tat, wir leben in einem Märchen aus Tausendundeiner Nacht, und überhaupt halte ich die Ereignisse, die in jenen Märchen geschildert werden, für höchst glaubwürdig und wahrscheinlich.«
»Sehen Sie,« lachte Friedrich, »das ist der Fluch der Gegensätze; wenn der eine unhaltbar wird, so verfällt man leicht in den anderen. Ich meinesteils, der ich viel mehr für möglich hielt als Sie, fühle mich trotz alles Erstaunlichen noch lange nicht in ein Märchen versetzt.«
»Aber ich bitte Sie! Eine Rothaut, die schwäbelt! Wenn er wenigstens ...«
»Jebildetes Daitsch' redete,« fiel Friedrich lachend ein. »Nein! eben die Schwaben sind, wie schon ihr Suevenname besagt, das in die Ferne schweifende Volk, und wenn sich schon ein Brahmine in Indien als geborenen Schwaben entpuppt hat, warum nicht auch ein Häuptling der Napoindianer? Aber kommen Sie, wir wollen Tompaipo selber fragen.«
So schritten sie denn den Hügel hinab. Sobald der Häuptling Tritte vernahm, wandte er sich langsam und gemessen um. »Sind die weißen Jäger vergeblich den Spuren ihres Bruders gefolgt?« fragte er auf spanisch, indem er sich vom Boden erhob.
Friedrich jedoch redete den alten Heuchler sofort auf gut Deutsch an. »Dem Mestizen haben Sie aber ordentlich gezeigt, wo er her war.«
Ein kaum merkliches Erstaunen blitzte in den Augen Tompaipos auf; er hatte unter den Indianern gelernt, jede Muskel zu beherrschen. Nun sah er sein Geheimnis entdeckt, mochte auch denken, es habe wenig Wert, vor seinen Landsleuten länger Verstecken zu spielen, zumal es gar nicht mehr möglich war. Er brach daher in ein herzliches Lachen aus und sagte: »Ja! mit sotte Kerles muß mer Deutsch schwätze, und dees verschtandet se bloß, wann mer's handgreiflich macht.«
»Aber eine merkwürdige Gewandtheit haben Sie dabei entwickelt!« lobte Schulze.
»Dees will i meine! Was meinet Sie denn, warum die Rothäut' mi Tompa-ipo g'heiße hent, was so viel bedeute tut, wie Gewitterhand oder Blitzhand? Dees isch nur daher komme, daß i wie's Wetter unter sie 'nei g'fahre bin und Ohrfeige austeilt hab' wie der Blitz, wann s' net pariert hent; dui nuie Mode hat en gewaltig imponiert, und i glaub' alleweil, nur deswege hent se mi so bald zum Häuptling g'wählt.«
»Ha, ha!« lachte Schulze. »Da kann man doch sehen, wie man in diesem Lande zu Ehren kommen kann infolge von Eigenschaften, die bei uns nicht nach Gebühr geschätzt werden! Aber wie zum Kuckuck sind Sie denn als geborener Schwabe unter die Napo geraten?«
»Das ist sehr einfach,« erwiderte Tompaipo, der nun zeigte, daß er auch gebildetes Deutsch, wenn auch nicht »jebildetes Daitsch« reden konnte: »Ich bin als junger Kerl von achtzehn Jahren nach Brasilien ausgewandert, mutterseelenallein; denn ich hatte Vater und Mutter verloren und keine näheren Verwandten, auch schlossen sich mir keine Bekannten an. Zuerst trieb ich mich in den deutschen Kolonien herum; aber die Wanderlust ließ mich nirgends seßhaft werden; so kam ich bis an den oberen Amazonenstrom und wurde einmal in einen Kampf der Weißen mit den Napo verwickelt. Dabei hatte ich das Glück oder Unglück, wie man sagen will, einen Häuptlingssohn zu erschlagen, worauf sich die Rothäute in heller Wut auf mich warfen, mich gefangen nahmen und fortschleppten.
»Na! ich glaubte, meine schlimmste Stunde habe geschlagen, aber der Häuptling, den ich des einzigen Sohnes beraubt hatte, war kein kleinlicher Mensch, der nur an Rache gedacht hätte. Er hielt so eine Art Rede vor den versammelten Kriegern, worin er erklärte, sein Sohn sei in ehrlichem Kampfe gefallen, und der Weiße habe tapfer gefochten und nicht aus böswilliger Absicht, sondern nur aus Notwehr gehandelt; daß er den kriegsgeübten Sohn des Häuptlings überwunden habe, sei ein Zeichen seines Muts und seiner Stärke; wenn er ihm nun den Sohn ersetzen wolle, so solle er, als einer der Ihren, am Leben gelassen und gut gehalten werden — und dergleichen mehr.
»Ich zog natürlich diese Annahme an Kindesstatt dem unangenehmen Martertode vor und habe es nie bereut; der Häuptling war ein guter Mann und hat mich wahrhaft väterlich behandelt. Ich wurde ein echter Napo und bin es gerne; so ein Häuptlingsdasein in der Freiheit hat viel für sich. Unter Weiße komme ich höchst selten; so übe ich denn mein geliebtes Schwäbisch, an dem mein Herz noch hängt, in Selbstgesprächen, so oft ich allein bin.«
»Aber Sie haben auch den Götterglauben der Indianer angenommen?« erkundigte sich Friedrich. »Bei unserm ersten Zusammentreffen stellten Sie ihn ja über das Christentum.«
»Ach, was! Reden! Es macht mir nur Spaß, mich als waschechten Napo zu zeigen; diese Indianer glauben an einen unsichtbaren Gott, den Spender alles Guten, und an einen Teufel; ihre Religion ist gar keine so üble; aber meinen Christenglauben behalte ich unentwegt bei, wenn ich auch die religiösen Indianergebräuche ehre; und wenn tüchtige Missionare in diese von der Mission vergessenen Gegenden kämen, ich wäre der erste, der ihnen die Bahn zu den Napo ebnen würde.«
»Haben Sie nichts über Ulrich in Erfahrung gebracht?« forschte nun der Jüngling weiter, der den schwäbischen Napohäuptling bescheiden erst seinen Bericht hatte zu Ende bringen lassen wollen.
»Doch, doch! Es ist eine faule Sache!« und wieder halb und halb in sein Schwäbisch verfallend fuhr Blitzhand fort: »Ich sage Ihnen, es ist eine saudumme Geschichte, und der Meschtize ist ein Schpitzbub', wo ihn die Haut anregt! Aber i will's schon wieder ins Gleis bringen, seie Sie nur ohne Sorg': mehr kann i Ihne jetzt mit dem beschte Wille net sagen, 's isch e Geheimnis derbei, von dem i selber bloß d' Hälft' ahne; der Oberhäuptling, der Narakatangetu — e saudummer Nam'! — ischt von alle Napo der einzig, wo de ganze Dreck weiß, der schwätzt aber nix aus.«
Einigermaßen beruhigt folgte nun Friedrich mit Schulze dem vortrefflichen Häuptling ins Lager, wo die Indianer den Drachenbesieger, von dessen Heldentat sie sich inzwischen mit eigenen Augen überzeugt hatten, mit Jubel und ehrenden Tänzen empfingen.
Tompaipo hielt es für angezeigt, dem Helden zu Ehren ein Fest zu veranstalten, bei dem der Palmwein in Strömen floß.
Bei diesem Feste wurden Friedrich wahrhaft königliche Ehren bezeigt. Jedem Napo erschien es als eine hohe Auszeichnung, von dem Drachentöter einiger Aufmerksamkeit gewürdigt zu werden. Die roten Männer drängten sich an ihn heran und versicherten ihn, daß sie mit Leib und Leben zu seinen Diensten stünden.
Auch an Heldenliedern zu seinen Ehren fehlte es nicht, die von den Sängern des Stammes aus dem Stegreif gesungen wurden.
Am merkwürdigsten erschien Friedrich ein Sang, der ihn lebhaft an die Kyffhäusersage erinnerte, und den er später aus dem Gedächtnis folgendermaßen übersetzte:
Als die fremden Blaßgesichter
In das Reich der Sonne kamen,
Als sie unser Glück zerstörten,
Als sie unsre Schätze nahmen,
Als zu ihnen sich gewendet,
Weg von seinen roten Söhnen,
Cachimana, den die Sieger
Undankbar und falsch verhöhnen —
Zog der Inkakaiser Manko,
Bess're Zeiten zu erwarten,
In die Höhle Antasuyus,
In der Erde Zaubergarten.
Dort verbarg er seine Krieger
Und des Reiches Kostbarkeiten,
Dort umgibt den greisen Helden
Aller Glanz vergangner Zeiten.
Durch den Stein, an dem er sitzet,
Ist sein Bart im Lauf der Jahre
Durchgewachsen, und es schimmert
Silberweiß die Flut der Haare.
Also harret er der Stunde,
Die der große Geist bestimmet,
Wann erfüllt das Maß des Frevels
Und sein heil'ger Geist ergrimmet.
Dann erscheint der Inka Manko
Mit den roten Heldenscharen,
Alle Weißen zu vertreiben,
Die des Lands Verderber waren.
Und das stolze Reich der Inka
Wird er wieder neu errichten,
Herrlich wie in alten Zeiten:
Niemand wird es mehr vernichten.
Ja, dann kommen goldne Tage
Wieder für die roten Stämme,
Fest und neu erstehn am Meere
Wieder die zerbrochnen Dämme;
Herrlich schimmern die Paläste
Und es blühn die Lande wieder.
Recht und Treue, Glück und Frieden
Senken sich vom Himmel nieder.
Bis zu diesem Tage schlummert
Manko, in dem Fels verborgen;
Aber gestern kam ans Licht er,
Grüßte froh den goldnen Morgen;
Kam, um einem weißen Helden,
Wie noch keiner ward gesehen.
Kämpfend mit Jolokiamos
Wurm, allmächtig beizustehen.
Und er riß herab die Felsen,
Grollend wie im Wirbelsturme,
Und zerschmetterte das grause
Haupt dem niebesiegten Wurme.
Und den jungen weißen Helden
Will er reihn in seine Scharen,
Mit ihm will das Reich er teilen,
Wie er teilte die Gefahren.
Bald wird nun die Zeit erscheinen.
Bald der Sieg, den wir erwarten,
Denn der alte Inkakaiser
Stieg aus seinem Felsengarten.
Die Mestizen glaubten ihre Pläne geglückt; sie waren zwar in der Nacht, da sich die Knaben in die Höhle begeben sollten, im Lager verblieben, um ja kein Aufsehen zu erregen; doch war es Diego gelungen, Narakatangetus Entfernung zu beobachten, und nun zweifelte keiner mehr daran, daß Friedrich und Ulrich von dem schlauen Häuptling in der Höhle überrascht und aus einem Hinterhalte getötet würden; sie dachten eben nicht anders, als der Häuptling werde handeln, wie sie es an seiner Stelle getan hätten.
Daß Narakatangetu in der Nacht den gefesselten Ulrich in sein Zelt verbrachte, wußte kein Mensch im Lager; denn der Häuptling hatte seine Vorkehrungen derart getroffen, daß er unbemerkt hinweg und wieder zurückgelangen konnte; und nur die Mißachtung seiner Befehle hatte es Diego ermöglicht, sein Weggehen auszuspionieren.
Nun aber verbreitete sich alsbald am andern Tage im ganzen Lager die Kunde von Friedrichs unerhörtem Kampfe mit dem Drachen und seinem wunderbaren Sieg. Dadurch erfuhren die Mestizen, daß Friedrich nicht in die Höhle gegangen war, und alsbald begab sich Alvarez zum Häuptling Tompaipo und bat ihn um eine Unterredung unter vier Augen. Tompaipo bestellte den Mestizen auf den Platz am Fuße jenes Hügels, von dem aus Schulze und Friedrich die beiden belauschten.
Ehe er sich jedoch zu dem Stelldichein begab, war der Napohäuptling zu Narakatangetu gegangen, um zu erfragen, ob ihm etwas über Ulrichs Verbleib bekannt sei. Der große Morekuat teilte ihm denn mit, daß er auf Diegos Anzeige hin den Jüngling in der verbotenen Höhle überrascht und sein Leben bisher nur deshalb geschont habe, weil die Äußerungen des Gefangenen den Verdacht in ihm erweckt hätten, die Mestizen trieben ein falsches Spiel und hätten sogar selber schon die Höhle ausgekundschaftet; dem wolle er noch auf den Grund kommen; dann werde ihm aber doch nichts übrig bleiben, als Ulrich aus dem Leben zu schaffen, da er unmöglich dulden könne, daß ein Weißer Mitwisser des heiligen Geheimnisses der Omagua sei, wenn auch nur eines geringen Teiles desselben. Ulrich habe geschworen, daß sein Bruder von der Höhle noch nichts wisse, sonst hätte er auch diesen dingfest machen müssen, was ihm leid getan hätte.
Tompaipo ließ sich von Narakatangetu das Versprechen geben, daß er Ulrich kein Leid antue, ohne zuvor mit ihm noch einmal über den Fall zu reden, er hoffe, einen Ausweg zu finden. Der Morekuat erwiderte, es wäre ihm selber die größte Freude, wenn es sich ermöglichen ließe, den tapfern Jüngling zu retten, aber eine solche Möglichkeit sei undenkbar.
Hierauf begab sich Tompaipo an den Ort, an den er auf den Nachmittag Don José de Alvarez bestellt hatte.
Dieser erzählte ihm ziemlich das gleiche, was er auch Narakatangetu vorgespiegelt hatte, und verlangte, er solle Friedrich, der wie sein Bruder nur als Spion in die Gegend gekommen sei, unschädlich machen.
Durch wenige schlaue, anscheinend harmlose Zwischenbemerkungen brachte Tompaipo den Mestizen unmerklich so weit, daß er etwas mehr von seinem Anteil an Ulrichs verhängnisvollem Schritte verriet, als klug war. Aber Blitzhand wußte durch lobende Ausrufe den Spitzbuben zu der Meinung zu bringen, eben dadurch setze er sich dem Napohäuptling gegenüber in ein günstiges Licht. Daher kam ihm denn der Hagel von Ohrfeigen zum Schlusse so völlig unerwartet, daß ihm lange die nötige Besinnung fehlte, um sich dem Gewitter aus heiterem Himmel zu entziehen.
Dann aber eilte er schäumend vor Wut zu den Gefährten zurück, um sofort mit ihnen zu beraten, was nun zu geschehen habe. Sollte Friedrich nicht gewarnt werden und ihrer Rache entrinnen, vielleicht gar selber zum Rächer seines Bruders werden, so galt es rasch zu handeln, ehe er von ihrem Anteil an Ulrichs Tod Wind bekam.
Moiatu, der falsche Indianer, nahm daher noch am gleichen Abend an dem Festgelage in Tompaipos Lager teil. Weder Friedrich noch der Häuptling ahnten, daß er ein Genosse Don Joses war, obgleich Tompaipo gegen den verkappten Mestizen bereits Verdacht geschöpft hatte.
Das Fest dauerte bis in die tiefe Nacht hinein; der Häuptling zog sich gegen Mitternacht zurück. Friedrich, der sich schon lange nach Ruhe sehnte, aber die begeisterten Rothäute nicht durch eine vorzeitige Entfernung vor den Kopf stoßen mochte, folgte nun seinem Beispiel.
Schulze und Unkas, die sich den Palmwein redlich hatten schmecken lassen, lagen bereits in der Hütte im tiefsten Schlafe.
Sobald Friedrich sich entfernt hatte, schlich Diego ihm nach bis in die Hütte; hier eröffnete er dem erstaunten Jüngling, nachdem er sich von dem festen Schlafe der beiden andern Hütteninsassen überzeugt zu haben glaubte, er habe ihm wichtige Mitteilungen über den Aufenthalt seines Bruders zu machen.
Er erzählte nun dem hoch aufhorchenden Knaben, daß die Napo Don Friedung in einer Höhle gefangen hielten, und daß Ulrich gestern zur Befreiung seines Vaters dorthin gegangen, wahrscheinlich aber entdeckt und gefangen genommen worden sei. Jedenfalls befinde er sich noch mit dem Vater in der Höhle.
Moiatu erbot sich nun, Friedrich persönlich dorthin zu begleiten. Dies konnte vom Lager Tompaipos aus unbemerkt geschehen, so daß der Mestize für sich keine große Gefahr befürchtete.
Der falsche Indianer versicherte noch, sie würden die beiden gefesselt, aber unbewacht vorfinden. Bei einiger Vorsicht wäre übrigens auch eine Wache leicht zu überrumpeln.
Friedrich, so überraschend ihm all diese Mitteilungen kamen, glaubte doch keine Ursache zu haben, ihre Richtigkeit in Zweifel zu ziehen, hatte sich doch der Indianer, der sie ihm machte, stets besonders zutunlich zu ihm und Ulrich gezeigt.
So folgte er denn alsbald dem Betrüger. Dieser führte ihn in die Guacharahöhle. An der Stelle, wo die Steinmusik erzeugt wurde, machte Moiatu den Gefährten auf die schwankende Platte aufmerksam, damit er nicht zu Fall komme. Einen Augenblick stand Friedrich still, um den Klängen der Steinorgel zu lauschen. Es waren vier deutlich unterscheidbare Töne, die immer in derselben Reihenfolge wiederkehrten. Man meint, es wolle einer die Melodie »Gott erhalte Franz den Kaiser« oder »Deutschland, Deutschland über alles« spielen, dachte er bei sich, breche aber immer nach den vier ersten Tönen ab, um wieder von vorn anzufangen! — Er ahnte nicht, welche wichtigen Folgen diese Beobachtung später für ihn haben sollte.
Dann aber folgte er dem Beispiel Moiatus, der mit einem Satz über die gefährliche Platte wegsprang. Noch einige Schritte ging es in dem schmalen Gange weiter, dann blieb »Die große Schlange« stehen und untersuchte eingehend die feuchten Wände der Höhle, sie mit einer Fackel scharf beleuchtend.
»Hier ist es!« murmelte der verkappte Mestize, dann bat er: »Möge mein weißer Bruder die Leuchte halten und zurückschauen, ob niemand uns folgt.«
Diese Vorsicht gebrauchte Diego nur, damit Friedrich den Kunstgriff nicht sehen sollte, den er jetzt anwendete.
An der Wand der Höhle war nämlich hier ein Gesteinsauswuchs, der für den Uneingeweihten nichts Auffälliges hatte, weil ähnliche Gebilde überall wiederkehrten; doch hatte dieser kaum fingerbreit hervorstehende Vorsprung die Form einer plumpen Säule, kaum mannshoch und ziemlich breit.
Mit einer raschen Bewegung drückte Moiatu an einer bestimmten durch ein kleines Loch bezeichneten Stelle auf die Säule, in dem Augenblick, als Friedrich seiner Weisung zufolge zurücksah.
»Es folgt uns keine Seele!« sagte Friedrich.
»So möge mein Bruder mir voranleuchten,« bat Moiatu, indem er auf eine Öffnung wies, die genau die Größe der Säule hatte, durch die sie zuvor verschlossen gewesen war.
Höchlichst erstaunt, aber arglos, schritt Friedrich voran; da traf ihn ein gewaltiger Faustschlag in den Rücken, er fiel hin und die Fackel erlosch. Dies eben hatte der Mestize beabsichtigt, da er fürchtete, Friedrich könnte, wenn er Licht bei sich habe, am Ende doch das Geheimnis des Ausgangs entdecken. Dann verschloß der Schurke die Wand wieder mit einem ähnlichen Handgriffe, wie er sie geöffnet hatte. Es gelang ihm dies trotz der ihn umgebenden dichten Finsternis, da er vorsorglich, solange es noch hell war, die Linke auf die Stelle gelegt hatte, von der aus die Säule wieder in ihre alte Lage gebracht werden konnte.
Höhnisch auflachend entzündete Diego eine zweite Fackel, die er bei sich trug; er wußte, daß sich Friedrich nun in einem nicht sehr ausgedehnten Höhlenraum befand, dessen einzigen Ausgang er in der Dunkelheit kaum mehr finden würde und dann jedenfalls nicht zu öffnen verstünde; denn die Stelle, an der das seltsame Tor dem Drucke nachgab, war weniger als handbreit, und es war kaum denkbar, daß einer sie entdecken könne, der das Geheimnis nicht kannte, selbst wenn er nicht in Finsternis begraben wäre.
Friedrich war daher dem Hungertode preisgegeben.
Auf dem Rückweg wunderte sich Diego, daß Ulrichs Leiche nirgends zu sehen war; doch nahm er an, Narakatangetu werde sie entfernt haben.
»Die große Schlange« hatte sich getäuscht, wenn sie glaubte, Friedrichs Genossen seien im tiefsten Schlummer, als er dem Jüngling seine lügenhaften Eröffnungen machte. Der Naturforscher freilich schlief wie ein Sack; Unkas aber hatte auch im Schlaf ein so feines Gehör, daß er an dem geringen Geräusch, das Friedrichs Eintritt in die Hütte verursachte, erwacht war. Als er gleich darauf Moiatu eintreten sah, dem er schon lange mißtraute, beschloß er, sich schlafend zu stellen, um unverdächtig beobachten zu können, was der falsche Indianer im Schilde führte.
So belauschte er das ganze Gespräch, und von Anfang an war es ihm, als verberge sich hinter den wundersamen Mitteilungen der »Großen Schlange« irgend eine Schurkerei. Doch was konnte er machen? Er mußte dem jungen Deutschen freie Hand lassen, da er eine Warnung nicht hätte begründen können und sein offenes Auftreten Moiatu nur veranlaßt hätte, auf der Hut zu sein.
Er beschloß daher, den beiden heimlich nachzuschleichen, um im Notfalle Friedrich behilflich sein zu können. Es gelang auch dem gewandten Indianer, unbemerkt bis in die Höhle zu kommen, stets in angemessener Entfernung hinter Friedrich und dessen Führer; er war dabei so sehr auf der Hut, daß Moiatu, der scharf aufpaßte, ob ihnen auch keine Entdeckung drohe, sich nie so rasch und plötzlich wenden konnte, um in die Finsternis hinter sich zu leuchten, ohne daß Unkas sofort platt auf dem Boden gelegen wäre oder sich hinter irgend eine Deckung geduckt hätte.
In der Höhle selber fanden sich anfangs Verstecke genug, sobald aber der schmale Gang betreten wurde, mußte Unkas weiter zurückbleiben, denn hier konnte ihn nur noch die Finsternis verbergen. Als Moiatu stillstand und Friedrich die Fackel hoch hob, um möglichst weit nach rückwärts den Gang zu beleuchten, sprang Unkas lautlos einen Schritt zurück und legte sich wieder zu Boden. Das Licht der Fackel war viel zu schwach, als daß Friedrich etwas von dem regungslos Daliegenden hätte gewahren können. Eben wollte Unkas sich wieder erheben, als er sah, wie der Verräter den neu eröffneten Eingang in die Seitenhöhle hinter Friedrich schloß und dann den Rückweg antrat.
Der erste Gedanke, der Unkas' Hirn durchblitzte, war der, daß er dem Schurken einen vergifteten Pfeil zwischen die Rippen jagen sollte, denn er hatte vorsorglich seinen Bogen mitgenommen. Sofort aber erkannte er auch das Bedenkliche einer solchen Tat: wenn es ihm hernach nicht gelang, Friedrich zu befreien, so war vielleicht der einzige Mensch aus dem Leben geschafft, der das Geheimnis kannte, mittels dessen des Jünglings Gefängnis geöffnet werden konnte. Moiatu mußte für alle Fälle am Leben bleiben, durfte auch nicht ahnen, daß er belauscht worden war, so konnte ihm doch im Notfall möglicherweise sein Geheimnis mit List oder Gewalt entlockt werden.
Unkas eilte daher mit raschen Sätzen, stets unhörbar mit den nackten Zehenspitzen auftretend, den Gang zurück. Die klingenden Steine warnten ihn vor der Stelle, wo die bewegliche Platte ihn hätte zu Fall bringen können; denn er hatte die Warnung wohl gehört, die Moiatu Friedrich hier erteilt hatte. So erreichte er wieder den weiten Raum, der von den kreischenden Guacharo durchflattert wurde, und tastete sich bis nach einer Aushöhlung, in der er sich völlig verbergen konnte.
Es kam ihm zustatten, daß er sich auf dem Hinweg in dem schwachen Dämmerlicht, das die Fackel bis zu ihm herübersandte, das günstigste Versteck gemerkt hatte, denn Moiatu, der nach Ulrichs Leiche forschte, hätte ihn nun unbedingt entdeckt, wenn er sich nicht so gut hätte verkriechen können.
Kaum hatte »Die große Schlange« die Guacharohöhle verlassen, so tastete sich Unkas nach der Stelle zurück, wo Friedrich im Felsen verschwunden war; aber er mußte nach stundenlangen Abmühungen in der Dunkelheit die Hoffnung aufgeben, den genauen Punkt zu finden oder das Geheimnis zu erraten, mittelst dessen des Eingeschlossenen Befreiung zu bewerkstelligen gewesen wäre. Auch sein lautes Rufen wurde nur von den hallenden Wänden beantwortet.
In der nächsten Nacht schlich er sich wieder, diesmal mit einer Fackel versehen, in die verhängnisvolle Grotte. Er glaubte nun auch, mit Sicherheit die Stelle entdeckt zu haben, wo die geheime Türe sich befinden mußte, aber alle seine Versuche, sie zu öffnen, waren völlig umsonst.
Mit Schrecken dachte Unkas daran, wie der edle Jüngling in seinem Gefängnis bald alle Qualen des Hungers und der Verzweiflung werde durchmachen müssen, denen er höchstens einige Tage standhalten konnte; so beschloß denn der treue Indianer, für den jungen Weißen, an dem sein Herz mit Bewunderung und Liebe hing, alles zu wagen — und wenn es sein eigenes Leben kosten sollte.
Schulze war in Verzweiflung, als nun auch Friedrichs Verschwinden offenbar wurde; Unkas teilte seinem Herrn nur so viel mit, daß er der Sache auf der Spur sei, denn er fürchtete, wenn er mehr sage, könne eine Unvorsichtigkeit des Gelehrten alles verderben.
Auf Unkas' Bitte ließ Schulze seinem Diener völlig freie Hand, seine Maßregeln nach Gutdünken zu ergreifen.
Zunächst handelte es sich für den Indianer darum, Moiatu vorsichtig auszuforschen oder ihn heimlich zu belauschen.
Ein Zufall war ihm günstig: es gelang ihm, aus nächster Nähe, gut versteckt, eine Besprechung der drei Mestizen mit anzuhören. Von Friedrich war zwar hierbei nicht die Rede, aber Lopez berichtete, wie er durch schlaues Spionieren zu der unangenehmen Gewißheit gekommen sei, daß Ulrich noch am Leben sei, und zwar als Gefangener im Zelte Narakatangetus.
Nun kam den Verschwörern das Gefährliche ihrer Lage zum Bewußtsein: wenn der Häuptling Ulrich ausforschte und seinen Aussagen Glauben schenkte, so mußte es herauskommen, daß sie das Geheimnis der Höhle kannten, und dann wäre ihnen, so gut wie Ulrich, der Tod sicher.
Sie verabredeten sich daher, beizeiten die Flucht zu ergreifen und ihre Forschungen nach El Dorado zu günstigerer Zeit fortzusetzen, wenn die Napo den Ort verlassen hätten; zuvor aber sich Diego in Narakatangetus Abwesenheit in des Häuptlings Zelt schleichen sollte und Ulrich mit seinem Jagdmesser töten, dessen Spitze in den Saft der Bejuco de Mavacure getaucht war, der furchtbaren Giftliane, aus der das Curare, das »leise tötende Pfeilgift« der Indianer, bereitet wird; die rasche Wirkung dieser Strychninart ist durchaus zuverlässig, und eine besondere Gefahr schien somit bei dem Unternehmen ausgeschlossen.
Aber Unkas beeilte sich, dem Mörder zuvorzukommen: auch hierbei kam ihm ein unerwarteter Umstand zustatten. Tompaipo hatte sich aufs wärmste für Ulrich verwendet, Narakatangetu erklärte ihm jedoch, nach reiflicher Überlegung sehe er keinen sicheren Ausweg aus seiner Lage, wenn er nicht Ulrich töte. Er glaube jetzt wohl, daß der Knabe absichtslos zur Kenntnis des Geheimnisses gelangt sei, auch nichts weiter wisse als das Vorhandensein und die Lage der Höhle; aber wie sollte das Geheimnis, das seit Jahrhunderten unverbrüchlich gewahrt worden sei, länger bestehen, wenn man nicht unnachsichtlich jeden Unberufenen aus der Welt schaffe, der irgendwie die leiseste Spur davon entdeckt habe? Sicher ist sicher, und da mußte man sicher gehen. Auch der Mestizen Tage seien gezählt, und er lasse ihnen nur deshalb noch ihre Freiheit, weil aus solchen Leuten leichter durch List als durch Gewalt herauszubringen sei, ob sie noch weitere Mitwisser hätten: solange er dies nicht erkundet habe, wolle er sie nicht stutzig machen; freilich, lange zuwarten werde er auch nicht mehr.
Als Tompaipo Ulrichs Schicksal besiegelt sah, sann er, wie er ihn gegen den Willen des Oberhäuptlings befreien könnte. Hierbei verfiel er auf Unkas, dessen Anhänglichkeit an die Brüder er kannte. Er beschied den Indianer zu sich.
»Hat Unkas der weißen Knaben nicht geachtet, die seines Herren Hütte teilten?« redete er ihn an. »Der schlechte Diener denkt, was gehen mich meines Herren Freunde an? Ich bin nur meinem Herren zu Dienste verpflichtet.«
»Unkas denkt nicht so: seine Seele leidet mit seinem Herrn über das Verschwinden derer, die ihm wie Sonnenschein waren.«
»Und Unkas weiß nicht, wohin die Knaben gekommen sind?«
»Cachimana weiß es, und wenn er es Unkas ins Herz gibt, so wird Unkas ein treuer Mitwisser des Geheimnisses sein.«
»Unkas hat kein Vertrauen zu Tompaipo, und seine Reden gehen den Pfad der Schlange; der Häuptling der Napo ist aber ein Freund der Weißen, und seine Seele sehnt sich, den tapferen Drachentöter und seinen Bruder lebendig und glücklich zu sehen.«
»Warum redet der große Häuptling mit Unkas, warum redet er nicht mit Narakatangetu?«
»Weiß Narakatangetu die Geheimnisse Cachimanas?«
»Tompaipo nimmt seine Augen und Ohren mit und seinen scharfen Verstand, wenn er das Zelt des großen Morekuat betritt; warum stellt er sich blind und taub und unwissend, wenn er es redlich meint mit Unkas und den weißen Männern?«
»So weiß Unkas schon, daß Ulrich Narakatangetus Gefangener ist?« erwiderte Tompaipo überrascht, nachdem er auf so vielen Umwegen Unkas jene Äußerung entlockt hatte, die ihm das Vertrauen gab, er könne sich auf die Verschlagenheit des Indianers verlassen und zugleich auf seine liebevolle Teilnahme für die Brüder.
»Unkas weiß nicht so viel wie Tompaipo.«
»Unkas hat den Verstand von zehn Napo, und Tompaipo hat gehört, daß keine Gefahr ihn schreckt, wenn es gilt, den weißen Knaben zu helfen, sonst hätte Unkas nicht entdecken können, wer im Zelte des großen Napohäuptlings verborgen ist. Tompaipo will Ulrich retten, aber Narakatangetus Herz ist hart und unerbittlich.«
»Was kann Unkas tun für den Weißen? Er ist bereit, sein Leben für die Befreiung des Knaben zu geben!« erwiderte rasch der Indianer, der nun wußte, wozu ihn Tompaipo gebrauchen wollte.
»Tompaipo wird mit dem großen Häuptling einen Rat halten im Wald zwischen beiden Lagern, wenn die Sonne nicht mehr scheint und der Mond noch zögert.«
»Unkas weiß, was er tun wird, wenn Sonne und Mond es nicht sehen können.«
Hiermit war die Unterredung zu Ende, denn Tompaipo hatte seinen Zweck erreicht, und tatsächlich gelang es Unkas, sich in der Zeit, da Narakatangetu sich bei der nächtlichen Zusammenkunft fernhielt, in das Zelt einzuschleichen und Ulrich zu befreien.
Noch nicht lange hatten die beiden unbemerkt das Lager verlassen, als sich Diego, der auch von der Abwesenheit des Häuptlings Wind bekommen hatte, mit einem Giftdolche bewaffnet, wie eine Schlange durch das Lager wand, bis er das Zelt erreicht hatte, in dem er sein Opfer vermutete.
Unkas hatte bei seinem Befreiungswerk besonderes Glück gehabt: obgleich er darauf vorbereitet war, einen Wächter stumm machen zu müssen, fand er einen solchen im Zelte nicht vor. Denn der Indianer, der Ulrich bewachen sollte, vertraute auf dessen feste Bande und benutzte die Abwesenheit des Häuptlings, um mit Tetuyöt, der »Kleinen Eidechse«, zusammenzukommen; hat doch auch bei den Rothäuten die heimliche Liebe, von der niemand etwas weiß, ihren besonderen Zauber.
Unhörbar schlich sich die Rothaut vor das Lager hinaus und kroch in das Gebüsch, wo die Kleine Eidechse schon seiner harrte. Im Dunkel konnte er nichts von ihr entdecken, zumal sich das schalkhafte Kind verborgen hatte und sich an seinem vergeblichen Suchen belustigte. Die leisen Rufe des Geliebten ließ Tetuyöt unbeantwortet. Plötzlich aber schlang sie von hinten die Arme um seinen Hals, so daß er zusammenschrak.
Da kicherte sie vor Vergnügen, und nun begann ein heimliches Getuschel in zärtlichem Beisammensein. Es war nicht lauter Glück, von dem sie sprachen, es waren auch schwere Sorgen, über die sie sich unterhielten. War es doch die alte Geschichte: ein armer Krieger niedrigsten Rangs und das reizende Töchterlein des großen Häuptlings Narakatangetu waren einander zugetan und hatten sich Treue geschworen bis in den Tod.
»Wann wird die Sonne des Glücks uns scheinen?« fragte der Wächter. »Ach! wenn der Vater meines Lieblings unser Geheimnis entdeckte, die Nacht des Todes würde sich bald über meine Augen lagern.«
»Mein Vater liebt seine kleine Eidechse über alles,« tröstete Tetuyöt. »Geduld! der Tag wird kommen, da ich ihm die Einwilligung abschmeichle, ohne die mein Glück dahin wäre.«
So plauderten die beiden und genossen das Glück der heimlichen Stunde, die Welt um sich her vergessend.
Vor Mondaufgang kehrte jedoch der Wächter zurück und wollte sich von der Anwesenheit des Gefangenen überzeugen, als er zu seinem Schrecken den verhüllten Zeltraum leer fand, in dem Ulrich sonst lag. Zunächst durchsuchte er das ganze Zelt, überall umhertastend, da es finster war; dann begab er sich nochmals in den Verschlag, in der Hoffnung, in einem Winkel doch noch den Gefesselten zu finden. Als alles umsonst war, warf er sich auf den Boden, um an den Zelträndern hinkriechend zu untersuchen, ob irgend eine Lücke vorhanden sei, durch die der Gefangene hätte hindurchschlüpfen können, und die ihm die Richtung seiner Flucht offenbart haben würde.
Zu eben dieser Zeit glitt Diego, jedes leiseste Geräusch vermeidend, in das Zelt. Zu seiner Genugtuung fand er es leer. »Tetuyöt,« murmelte er höhnisch; war er es doch, der Tetuyöt verraten hatte, daß ihr Vater um diese Zeit entfernt weilen werde, und sie dadurch veranlaßte, dem Wächter ein Stelldichein zu geben.
Befriedigt von seiner eigenen Schlauheit, die alles so fein ausgekundschaftet und so geschickt eingefädelt hatte, glaubte er nun kühner zu Werke gehen zu können; er richtete sich auf und begab sich in den Verschlag des Gefangenen. Als er in der Dunkelheit die Gestalt des Wächters sich am Boden bewegen sah, dachte er natürlich, es sei Ulrich und stürzte sich auf den Liegenden. Dieser machte eine Wendung und fuhr erschrocken auf. Wie der Blitz packte er Diego bei den Füßen und umklammerte den Fallenden mit eisernen Armen. Diego hatte sich eines solchen Überfalls nicht versehen, da Ulrich an Händen und Füßen gefesselt war. Aber er hatte ja sein Messer, und wenn er auch keinen wuchtigen Stoß damit führen konnte, so genügte doch ein Ritz in des Indianers Haut, um diesen tödlich zu verwunden.
Arme Tetuyöt! deine süßen Träume von Glück und Liebe hat ein mörderischer Dolchstoß zunichte gemacht! Wie werden die Tränen deine Sonnenaugen verdunkeln, und dein junges Herz wird brechen wollen im Übermaße des Schmerzes!
Der Wächter verhielt sich auch nach dem Stiche noch so stumm wie sein Gegner; als sich aber kurz darauf die Todeskrämpfe bei ihm einstellten, preßte er den Mörder um so fester an sich; bald hauchte er den letzten Seufzer aus, allein Diego konnte sich aus der erstickenden Umarmung der Leiche nicht sofort befreien.
»Carajo!« murmelte er unter verzweifelten Anstrengungen. »Wer hätte gedacht, daß statt des gefesselten Knaben hier eine Rothaut läge mit dem freien Gebrauch der Arme?!«
Eine Zeitlang gab er seine Befreiungsversuche auf, um frische Kräfte zu sammeln; dann aber wälzte er sich mit der Leiche umher, bis er sich endlich mit einem gewaltigen Ruck von ihr losriß.
Nun wollte er hinausschleichen, aber die Füße versagten ihm den Dienst: bei seinen Bemühungen, sich der Umklammerung des Toten zu entreißen, hatte er sein Messer fallen lassen; als er sich hernach so wild mit der Leiche herumwälzte, war er mit der Hand in die Schneide geraten, ohne daß er in seiner Aufregung überhaupt etwas von der Verletzung gemerkt hätte.
Nun aber wirkte bereits das Gift, und als in diesem Augenblick Narakatangetu erschien und dem Eindringling mit der Fackel ins Gesicht leuchtete, brach Diego schon in Todeszuckungen zusammen.
Der Häuptling übersah mit einem Blicke die Sachlage. Er legte sich alles so zurecht, wie es den Anschein haben mußte: Moiatu-Diego hatte Ulrich befreit, warum? Das war ein Rätsel; vielleicht stand der Knabe doch in heimlichem Einvernehmen mit den Mestizen. Freilich war es dann unklar, warum eben Diego ihn verriet; andererseits, wenn er ihm feind war oder seine Aussagen fürchtete, warum befreite er ihn, statt ihn zu töten?
Aber Tatsache blieb es, Ulrich war fort, war frei. Wer sollte ihm dazu verholfen haben, wenn nicht der im Zelt betroffene Diego? Dieser war sofort nach der Tat von dem Wächter überrascht worden, den er mit dem vergifteten Messer tötete, während er sich im wilden Ringen selber mit seiner todbringenden Waffe verletzte.
So und nicht anders mußten sich die Vorgänge der Überlegung des zurückgekehrten Häuptlings darstellen.
Er rief sofort das Lager auf, dem Flüchtling nachzusetzen, aber der Spuren um das Lager her waren so viele, daß an eine Entwirrung nicht zu denken war, und so hatte die planlose Verfolgung, obgleich sie nach allen Seiten hin unternommen wurde und kein Schlupfwinkel undurchsucht blieb, nicht den geringsten Erfolg.
Freilich, Narakatangetu konnte sich nicht träumen lassen, wo sich Ulrich zur Zeit befand: daran, daß er in der Höhle sei, hätte er zuallerletzt gedacht, und dorthin hätte er ihm keinen nachgesandt!
Übrigens bewog dieser Vorfall den Häuptling, nicht länger mit der Verhaftung der beiden überlebenden Mestizen zu zögern; man faßte sie noch in der Nacht ab, in eben dem Augenblick, da sie ihre Flucht bewerkstelligen wollten.
ALS Friedrich sich in dem feuchten, dunklen unterirdischen Raume durch die Tücke eines Verräters eingeschlossen sah, tat er, was wohl jeder an seiner Stelle getan haben würde: er tastete an den Wänden hin, ob er nicht irgendwo einen Ausweg finden oder die Art entdecken könne, wie er den von Moiatu verschlossenen Eingang wieder öffnen könne.
Nichts aber verriet ihm dessen genaue Lage, und so tastete er sich mehrere Stunden lang an den feuchten Wandungen hin und wußte nicht, ob er sich in einem unendlich langen Gange oder in einem kleineren Raume befinde, in dem er sich immerfort im Kreise bewege.
Es läßt sich kaum etwas Grauenhafteres denken als das Gefühl, lebendig begraben zu sein. So mutig Friedrich sonst war, so kühn er selbst einer so entsetzlichen Gefahr getrotzt hatte, wie der Kampf gegen den gräßlichen Wurm sie mit sich gebracht hatte — hier in der beklemmenden Einsamkeit, in der undurchdringlichen Finsternis und im Angesichte eines schauerlichen Todes packte ihn ein nie empfundenes Grauen, und die Sehnsucht nach Licht und Leben regte sich ungestüm in seiner Seele.
Es ist kein Wunder, daß er in der ängstlichen Hast, einen Ausweg zu finden, gar nicht daran dachte, daß er doch ein Feuerzeug bei sich hatte. Erst als er, vom langen Umherirren ermüdet und bereits von quälendem Hunger geschwächt, sich auf dem schlüpfrigen Boden niederließ, fiel ihm das ein.
Man sagt vom Ertrinkenden, daß er sich an einen Strohhalm klammere. Friedrich empfand in der Tat eine Freude und neue Hoffnung bei dem Gedanken an sein Feuerzeug, das ihm doch nur wenig nützen konnte; es war ihm, als hätte er schon einen Ausweg aus seinem unterirdischen Grabe gefunden. Mit zitternden Händen suchte er die Streichhölzer hervor, und welche Wonne, als das kleine Licht des ersten Hölzchens die grauenvolle Nacht erhellte!
Er sah bei dem Schein, daß er sich allerdings in einem gewölbeartigen Raum befand, der nur von geringem Umfange war, ein Umstand, der seine rasch aufflackernde Hoffnung ebenso rasch wieder dämpfte.
Dann gedachte er der erloschenen Fackel, entzündete ein zweites Holz und fand sie auf dem Boden liegend. Alsbald eilte er sie aufzuheben und steckte sie mit einem dritten Zündholz an.
Nun waren Hunger und Müdigkeit vergessen, und ein neues Suchen begann: jeder Zoll der Wände, der Decke und des Bodens wurde sorgfältig abgeleuchtet, aber nirgends war etwas zu sehen, das auf eine verborgene Öffnung hingewiesen hätte, und als die Fackel heruntergebrannt war und erlosch, war Friedrich wieder so weit, daß er alle Hoffnung aufgab.
Die Erschöpfung ließ ihn in einen ohnmachtähnlichen Schlaf verfallen, in dem liebliche Träume ihn umgaukelten.
Als er erwachte, dauerte es eine geraume Weile, bis er wieder voll zum Bewußtsein seiner trostlosen Lage gelangte; der rasende Hunger mahnte ihn zuerst daran. Er ergab sich nun in sein Schicksal und bereitete sich auf einen langsamen, aber sicheren Tod vor. Seine Seele dem barmherzigen Gott empfehlend fand er im Gebet einen Trost, der ihm alle Angst vor dem Sterben nahm.
Als er diese Ruhe des Gemüts wiedergewonnen hatte, raffte er sich erst wieder aus seiner anfänglichen Gleichgültigkeit der Verzweiflung auf und achtete es für seine Pflicht, noch einen Versuch zu machen, ob er keinen rettenden Ausweg zu finden vermöchte. Freilich, Hoffnung hatte er keine! Was er beim Scheine der Fackel nicht fand, wie sollte er es in der völligen Dunkelheit finden? Seine wenigen Zündhölzer konnten ihm nichts weiter nützen, auch wollte er sie vorerst noch sparen.
Aber eben die Dunkelheit, die seine Lage so zu verschlimmern schien, sollte sich ihm als Retterin erweisen. Als er nämlich wieder tastend dicht an den Wänden hinschritt, glaubte er plötzlich, einen hellen Funken zu gewahren, nicht größer als einen Stecknadelknopf. Hätte er Licht besessen, so hätte dieser schwache Schimmer niemals sein Auge getroffen. Anfänglich glaubte er an ein Trugbild der überreizten Sehnerven unter dem Einfluß der Einbildung, die einem wohl etwas von dem vortäuschen kann, was man mit Anspannung aller Gedanken und Sinne sucht. Aber das Lichtpünktchen leuchtete fort und fort, stets an der gleichen Stelle, und Friedrich hatte bald festgestellt, daß es durch eine kaum merkliche Ritze fiel.
Wenn es noch eine Hoffnung gab, so war sie an diese Stelle gebannt. Friedrich blieb also hier stehen und untersuchte den Felsen rings um den winzigen Hoffnungsstern herum. Er fand nichts, aber er probierte und probierte, ob nicht durch irgend einen Druck oder Handgriff ein Nachgeben eines Teiles der Wand zu erzielen sei.
Er glaubte, sich an eben der Stelle zu befinden, durch die Moiatu ihn hier hineingestoßen hatte, und der Lichtschimmer schien darauf hinzuweisen, daß sich in der Guacharohöhle Menschen befanden. Friedrich fiel es nicht ein, zu überlegen, ob es freundlich oder feindlich gesinnte Leute sein mochten. Lieber Feinden in die Hände fallen, als in diesem schauerlichen Grabe noch länger zu verweilen.
Er rief auch aus Leibeskräften und stieß mit dem Flintenkolben gegen die Wand, ja, er gab einen Schuß ab, um sich vernehmlich zu machen; aber alles schien nur im Gewölbe unheimlich widerzuhallen und darinnen begraben zu ersterben, ohne daß die Schallwellen es vermochten, die dicken Steinmauern zu durchbrechen.
Friedrichs größte Sorge war jetzt, daß der schwache Lichtschein, dieses kaum sichtbare Pünktchen, erlöschen möchte und er dann vollends gar keinen Zusammenhang mit der Außenwelt, keinen noch so geringen Anhaltspunkt für seine Befreiungsversuche mehr besäße.
Da, auf einmal glitt einer seiner tastenden Finger in eine Vertiefung, und als hätte er auf einen elektrischen Knopf gedrückt, zeigte sich eine augenblickliche, wenn auch langsame Wirkung: ein Teil der Wand wich unter seinen Händen und drehte sich wie in Angeln nach innen; das Lichtpünktchen ward zum Streifen, der Streifen zum Band, und zuletzt zeigte sich eine breite Öffnung, durch die das Licht hereinflutete.
Friedrich befand sich vor einigen in den Felsen gehauenen Stufen, die er gleich einem freigelassenen Vogel emporflog; auf der obersten aber blieb er wie gebannt stehen.
Er stand unter einem hohen, verhältnismäßig schmalen Torbogen, der frei in einen großen Saal führte. Dieser Saal, dessen Decke aus einer Anordnung von Wölbungen bestand, die auf zahlreichen wundervoll gearbeiteten Säulen ruhten, war ganz in den nackten Stein gehauen. Da der Stein aber Bergkristall war, der hier ohne deckende Kruste zutage trat, so glitzerte und flimmerte alles in tausend Lichtern. Die Quelle der Beleuchtung war unsichtbar, es schien aber, als ob das ungeschwächte Sonnenlicht überall eindringe; denn keine künstliche Lichtquelle konnte wohl solche Tageshelligkeit verbreiten.
Die Wände und die Säulen waren nicht glatt, sondern mit zahllosen, wie zufälligen Unebenheiten bedeckt, die den Anschein erwecken konnten und wohl auch sollten, als handle es sich um Gebilde der Natur und nicht um ein Werk von Menschenhand; und alles — Wände, Säulen und Decke — wimmelte von Tiergebilden aus durchsichtigem Edelgestein: da hockten gelbe Kröten, da krochen grüne Leguane, da wanden sich rote Korallenschlangen an den Säulen empor; braune Skorpione und graue Spinnen schienen am Gewölbe zu hängen — und das alles blitzte und funkelte in buntem Glanz.
Aber nicht dieses märchenhafte Schauspiel war es, das Friedrichs Augen gebannt hielt: nicht ferne von dem Eingang, unter dem er sich befand, saß an einem rohen Steintisch ein Greis von hünenhafter Gestalt, umwallt von einem langen Mantel, der ganz aus leuchtenden, bunten Federn zusammengesetzt war; sein Haupt hielt er in die Hand gestützt; er schien zu schlummern. Lang wallten seine weißen Locken, und sein Bart flutete herab auf den Tisch und von diesem hernieder bis zum Boden, als sei er durch die Steinplatte gewachsen. Dieser herrliche Bart war ebenfalls schneeweiß; aber der Widerschein einiger rubinroter Schlangen an den nächststehenden Säulen verlieh ihm einen roten Schimmer.
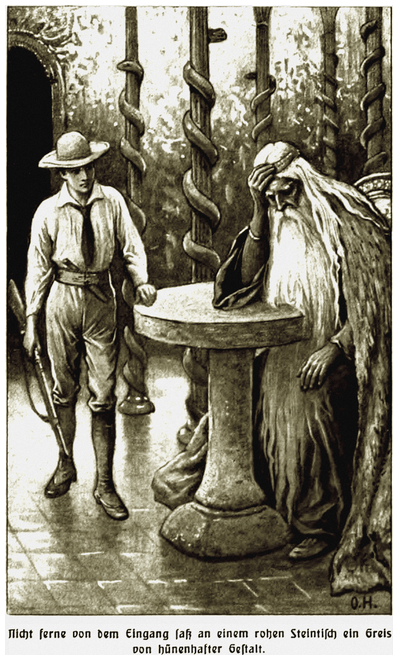
»Der alte Barbarossa, Der Kaiser Friederich, Im unterird'schen Schlosse Hält er verzaubert sich,« murmelte Friedrich vor sich hin. Es war ihm wie ein Traum, als befände er sich im fernen deutschen Vaterland und sei in die Höhle des Kyffhäuser geraten. Ja, so deutlich verwirklicht sah er vor sich die Barbarossasage, daß er sich nicht denken konnte, er befinde sich in Columbia, fast durch die ganze Erdkugel von Deutschland getrennt. Und hier unter der Erde hörten auch die Unterschiede von Natur und Klima auf: nur die fremdartigen Tiergebilde der Tropen, die den Raum zierten, erinnerten daran, daß an diesem Orte keine germanische Sagengestalt hausen könne, wenn sie auch an und für sich getreulich das Bild ins Leben umsetzte, das Friedrichs Einbildung sich seit frühen Kinderjahren von dem verzauberten Hohenstaufenkaiser im Kyffhäuser ausgemalt hatte.
FRIEDRICH stand noch unbeweglich da, immer und immer nur den wunderbaren Greis anstarrend. Da schien dieser zu erwachen; er hob das Haupt und sah mit Adlerblicken den Jüngling an.
Der Blick, der zuerst etwas hatte wie eine verzehrende Feuerflamme, wurde bald milder, fast freundlich, als der Alte in spanischer Sprache mit klangvoller Stimme zu reden begann:
»Wie kommt der weiße Knabe in die Höhle des Inka?«
»Ein Verräter führte mich in eine unbekannte Grotte, in der ich meinen Vater finden sollte, und verschloß mich auf unerklärliche Weise im Stein.«
»Und den Eingang zu meinem Saal, wer öffnete ihn dir?«
»Ein Lichtfunke hat ihn mir verraten, da ich schon zu sterben vermeinte, und eine Fügung des Großen Geistes ließ mich die Stelle finden, an der das Tor sich öffnen läßt.«
»Wer war der Verräter, der dich in den Felsen schloß?«
»Ein Napoindianer.«
»Gewiß einer der Häuptlinge? Jedenfalls Narakatangetu selber; denn er allein kennt das Geheimnis der Tore von allen Kindern der Sonne, die noch draußen wohnen in den Tälern des Ungemachs. Aber du darfst ihn keinen Verräter nennen, gewiß hast du Schweres verschuldet, daß er dich so hart strafte; und doch durfte er es nicht! In diese Höhle durfte er dich nicht führen! Ich verstehe es nicht; er wäre seit Jahrhunderten der erste der großen Morekuate der Omagua, der seinen heiligen Eid gebrochen hätte.«
»Ehrwürdiger Vater, Narakatangetu war es nicht, der mich hierherführte, es war ein Indianer ohne Würden, und einer Verschuldung bin ich mir nicht bewußt!«
»Ha!« rief der Greis, und seine Augen flammten. »Weiß jeder Knecht der Napo schon um das heilige Geheimnis? Ich werde von Narakatangetu Rechenschaft fordern über die Wahrung des Stillschweigens. Aber du sprichst wahr, eine Schuld hast du nicht. Die Jahrhunderte haben meinen Blick geschärft, zu lesen in der Seele der Menschenkinder. Du tust mir leid, Jüngling, aber wenn es Wesen gibt, die du liebst dort draußen in der Welt des Unrechts, so laß deine Seele auf ewig Abschied von ihnen nehmen, denn nimmermehr wirst du sie schauen. Du kennst das Geheimnis der Höhle des Inka; kein Mensch soll es aus deinem Munde erfahren. Aber blicke nicht so traurig? Was ist das Leben dort draußen? Siehe, ich wohne Jahr um Jahr in dieser Höhle, meist in völliger Einsamkeit, und es reizt mich nicht mehr, hinaufzusteigen, wenn ich es nicht täte von Zeit zu Zeit um meines Volkes willen.
»Auch du wirst dich gewöhnen an das Leben unter der Erde, und hast du dich bewährt, so will ich dir den Zugang gestatten zu den Gefilden des Friedens: da wirst du Freunde finden ohne Falsch, besser als alle, die du dort draußen zurückläßt.«
Aber Friedrich hörte des Greises Stimme nur noch wie aus weiter Ferne. Plötzlich übermannte ihn eine völlige Schwäche, es wurde ihm schwarz vor den Augen, und er vermochte nur noch unwillkürlich zu sagen: »Vater, ich habe Hunger!« Dann fiel er besinnungslos zu Boden.
Als er wieder zu sich kam, empfand er nichts von der Mattigkeit, die eine Ohnmacht zu hinterlassen pflegt, vielmehr spürte er eine Frische und Kraft, wie er sie nie besessen zu haben glaubte. Er sprang auf die Füße und reckte sich, während der Greis, der neben ihm stand, lächelnd auf ein kleines Kristallfläschchen wies: »Mein Sohn hat nie die Kraft des Lebenswassers erfahren?«
»Nein! Aber mir ist wahrhaftig, als hätte ich von dem kostbaren Elixir geschlürft, von dem alte Märchen und Sagen berichten.«
»So folge mir, es steht Speise für dich bereit.« Damit führte ihn der Greis in eine Nebenkammer, in der sich ein steinerner Tisch mit verschiedenen unbekannten Gerichten befand, daneben eine Menge der erfrischenden saftigen Früchte der Tropen, die Friedrich wohl bekannt waren.
Der Jüngling ließ sich denn das herrliche Mahl schmecken, und der Alte sah ihm wohlwollend zu, griff auch selber nach einigen Früchten, anscheinend, um ihm Gesellschaft zu leisten oder den Zuspruch zu unterstützen, an dem er es nicht fehlen ließ.
Dann mußte Friedrich ausführlich seine Schicksale berichten, die der Greis schweigend mit anhörte. Der Jüngling erzählte alles in schlichter Weise, und seine natürliche Bescheidenheit brachte es mit sich, daß er die Umstände, bei denen er selber eine glänzende Rolle gespielt hatte, wie namentlich den Kampf mit dem »Fabeltier«, gar nicht erwähnte.
Dann erbot sich der Alte, auch seinerseits einige Auskunft zu geben; doch erklärte er von vornherein, daß er viele große Geheimnisse vorerst noch nicht enthüllen könne. Was seine eigene Person betreffe, so möge sein Gast sich damit begnügen, in ihm einen alten königlichen Inka von Tahuantinsuyu, das heißt Peru, zu erblicken.
Friedrich befleißigte sich denn auch bescheidener Fragen über Dinge mehr äußerlicher Art, die hier unten sein Interesse erregten.
Er erkundigte sich nach der Kraft, die auf einen Druck des Fingers hin die gewaltigen Steintore zu bewegen vermöge, und erfuhr, daß es Wasserkraft sei. Dann wünschte er zu wissen, wie es möglich sei, die Räume hier unten taghell zu beleuchten?
»Was mein Sohn für künstliche Beleuchtung hält, ist das lautere Sonnenlicht.«
»Aber ich sehe doch nirgends Fenster oder große Kanäle, durch die das Licht eindringen könnte?«
»Es dringt auch durch keine Öffnung ein, sondern wird durch feste Stoffe geleitet.«
»Wie!? Die Sonne erleuchtet doch bloß durch Strahlung!«
»Was nennt ihr Strahlung?«
»Bei der Wärme unterscheiden wir zwei Arten der Vermittlung: die Leitung und die Strahlung. Die Leitung geschieht in der Weise, daß die Wärmequelle einem Körper Wärme mitteilt, die sich in ihm von Teil zu Teil fortpflanzt, indem die erwärmten Molekel die erhaltene Wärme nach und nach den benachbarten Molekeln abgeben. Bei der Strahlung wird ein Körper von der Wärmequelle aus unmittelbar aus der Ferne erwärmt, ohne daß die dazwischenliegenden Schichten des Raums, der Luft und so weiter durch eigene Erwärmung die Wärmeabgabe vermitteln.«
»Ihr seid in einer großen Täuschung befangen: eine Erwärmung durch Strahlung gibt es nicht. Die Wärme wird durch den Raum und die Luft stufenweise fortgepflanzt, wie in den festen Körpern. Nur daß die durchlässigen Körper sie viel rascher abgeben und weniger in sich selber aufspeichern als die undurchlässigen. Die von der Luft schnell und reichlich abgegebene Wärme speichert sich dann in den festen Körpern rasch auf, so daß ihre Erwärmung viel größer ist als die der Luft; und doch wird die Wärme ihnen durch diese mitgeteilt. Aber auch im Raum ist es der Stoff, der von Teil zu Teil die Wärme weitergibt, nur noch viel schneller als die Luft, so daß er fast gar nichts in sich zurückhält. Siehe, der Regen bildet in der Luft nur Tropfen, aber auf der Erde und in den Höhlungen der Erde sammeln sie sich zu Seen an. So sammelt sich die Wärme in den Körpern, die sie besser festhalten als die flüchtigen Stoffe der Luft und des Raumes. Auch bei festen Körpern ist ein großer Unterschied: verschiedene Körper, die der gleichen Wärmequelle in der gleichen Weise ausgesetzt sind, erwärmen sich sehr ungleichmäßig, die einen mehr, die andern weniger; es kommt ganz auf ihre Art an, in welcher Weise und mit welcher Geschwindigkeit sie die Wärme, die ihnen durch die sie berührenden Wärmeleiter vermittelt wird, annehmen, aufspeichern, weiterleiten und wieder abgeben.«
»Und das Licht?«
»Mit diesem ist es ganz gleich: es gibt keine Strahlung, sondern nur eine Leitung des Lichts durch den Stoff.«
»Aber das Licht pflanzt sich doch nur geradlinig fort!«
»Das scheint nur ein Ausdruck zu sein für eine Erscheinung, die ihr nicht versteht. Wenn ihr die Stoffe kennen würdet, die das Licht fortpflanzen, sobald sie nicht durch fremde Stoffe unterbrochen werden, ihr würdet das Licht wie das Wasser in Windungen fortleiten, ihr würdet es ansammeln, daß es euch Tag und Nacht leuchtete wie uns.
»Es gibt Stoffe, die geben das Sonnenlicht, das sie aufgespeichert haben, monate- und jahrelang ab, ohne daß sie in dieser Zeit wieder Sonnenlicht aufnähmen. Siehe, so leiten wir das Sonnenlicht auf krummen Wegen hier herab und speichern es in Steinen der Gewölbe auf, die es uns Tag und Nacht abgeben. Hier unten ist ewiger Sonnenschein! Aber euer Leben ist zu kurz, als daß ihr solchen Geheimnissen des Schöpfers auf den Grund kämet.«
DIE Halle, in der Friedrich gespeist hatte, wurde ihm von dem alten Inka zum Wohngemach überlassen; einen zweiten, dahinter befindlichen Raum durfte er sich als Schlafzimmer einrichten: dazu schien er auch bestimmt; denn er enthielt eine Art Bettlade aus einer Gesteinsart, die als schlechte Wärmeleiterin dem Holz nichts nachgab; auch floß eine Quelle durch die Halle, sowohl Wasch- als Trinkwasser liefernd. Ein breiter Gumpen, aus dem sie unterirdisch abfloß, bot eine herrliche Badegelegenheit. Die notwendigsten Ausstattungsstücke verschaffte der Inka seinem Schützling — oder Gefangenen — ohne daß dieser die Leute zu Gesicht bekam, die sie dem Greise überbrachten.
Von Friedrichs Schlafhalle aus führte ein Gang in den Berg hinein, und der alte Inka gestattete dem Jüngling ausdrücklich, darin zu wandern, so weit er nur wolle. Er wußte wohl, daß die einzigen Wege zum Tageslicht nach zwei verschiedenen Seiten nur durch den großen Saal führten, in dem er sich selber aufhielt; und beide Ausgänge, sowohl die Höhle, in die Friedrich durch den Mestizen eingeschlossen worden war, als einen andern Weg, von dem der Jüngling noch nichts wußte, ließ er mit Wachtposten beständig besetzen, seit sich ein Fremder hier unten befand.
»Du wirst der Wunder genug schauen,« sagte der Inka zu Friedrich, »wenn du die Gänge durchwandelst, die von deinen Hallen aus in den Berg führen, und gerade das wirst du erblicken, was euch Weißen am schönsten und begehrenswertesten erscheint, und wofür ihr Ströme Bluts vergießet und unsäglichen Jammer über andere und über euch selber heraufbeschwört: Gold und Silber in zahllosen Adern. Nirgends wohl finden sich beide Metalle so nahe beieinander wie in diesen uralten Bergwerken. Als wir sie vor langer, langer Zeit verließen, waren sie ausgebeutet; aber seit wohl dreihundert Jahren hat sie kaum eines Menschen Fuß mehr betreten; ich selber bin nie mehr hineingekommen, denn mich verlangt nicht, zu sehen, was mich und meine Brüder vor Zeiten ins Unglück brachte. Wenn wir übrigens solche Schätze brauchten, so hat der Berg der Adern noch genug, die kaum angegriffen sind. Weil aber die Edelmetalle da, wo die Natur sie bildet, mit der Zeit immer wieder von neuem erstehen, so werden auch dort unten in dem ausgebeuteten Bergwerk die Metalle seit dreihundert Jahren in solcher Fülle wieder angewachsen sein, daß sie dein Auge blenden und dein Herz erfreuen werden, wenn es auch, wie ich dir ansehe, die Gier nicht kennt, die so viele deiner Brüder vertiert.«
Da sich der Inka im übrigen wenig mitteilsam zeigte und Friedrich sich selbst überließ, so begann dieser alsbald mit der Besichtigung der Stollen. Zur Beleuchtung diente ihm ein sonnenhell strahlender Stein, der nach der Aussage des Greises aus dem Stoff bestand, der am dauerndsten und vollkommensten das Tageslicht aufspeichere, und der nur Licht und keine Wärme abgebe.
Um nicht geblendet zu werden, mußte der Jüngling den Stein auf seinem breiten Hute befestigen. So machte er zuerst kurze Ausflüge in die Bergwerke, dann immer ausgedehntere, wobei er sich seinen Weg genau merkte. Dieser bot übrigens gar keine große Gefahr des Verirrens, da die weitverzweigten Seitenhöhlen immer schmäler waren als die Hauptgänge und alle von einem besonders geräumigen Stollen abzweigten. Bei seiner Rückkehr von solchen Ausflügen fand Friedrich jedesmal Speise und Trank in Menge für sich bereitgestellt.
Die Bergwerke, die er zu seiner Unterhaltung durchwanderte, boten ihm einen feenhaften Anblick. Auf der einen Seite, bergauf zu, funkelte alles von lauterem Gold, wobei eine Abwechslung fast nur durch die Form der Gänge und die größeren und kleineren Hallen, von denen sie unterbrochen wurden, geboten ward. Da und dort trat aber auch dunkel das nackte Gestein zutage und erhöhte durch den Gegensatz die Herrlichkeit des Goldglanzes.
Auf seinen Entdeckungsfahrten durch dieses wahre Dorado gelangte Friedrich immer höher hinauf, oft führten Hunderte von Stufen aus einer Schicht in eine höher gelegene. Zuletzt gelangte er in einen schmalen Kanal, in dem das Metall ganz verschwand und die nackte Erde die Wände bildete, so daß es schien, als habe ein großes Tier sich hier eine Höhle gegraben. Diese Vermutung wurde Friedrich zur Gewißheit, als er eine weitere Aushöhlung erreichte, in der ganze Haufen abgenagter Knochen lagerten, und als er zuletzt über sich eine Öffnung gewahr wurde, die offenbar ans Tageslicht führte.
Leider konnte er sie nicht erreichen, da der Aufstieg zu glatt und steil war. »Wenn ich nur jemand hätte, auf dessen Schultern ich klettern könnte,« dachte er, »so käme ich gewiß da hinaus und auf den Gipfel der großen Hochebene, die von außen unersteiglich schien; und wer weiß? Wenn etwas Wahres daran sein sollte, daß mein lieber Vater von den Napo in diesen Höhlen gefangen gehalten wurde — dort oben könnte ich ihn vielleicht finden!«
Er nahm sich vor, irgendein Werkzeug zu suchen, und wenn es nur ein geeigneter Stein gewesen wäre, mit dem er sich die wenigen Stufen graben konnte, die erforderlich schienen, um dort hinauf zu gelangen.
Er war sich wohl bewußt, daß dies gegen den Willen des alten Inka war, aber er war dem Greise gegenüber keinerlei Verpflichtung eingegangen. Welches Recht hatte denn der Alte, ihn gefangen zu halten und ihm zu verwehren, nach dem Vater zu suchen?
Dieser Weg zum Gipfel des Berges war jedenfalls dem Inka völlig unbekannt; er hing nicht ursprünglich mit dem Bergwerk zusammen, sondern war das Werk eines Tieres und offenbar erst viel später angelegt, nachdem das Bergwerk längst aufgegeben worden war. Und da nach der Aussage des Greises seit dreihundert Jahren kein Mensch sich mehr um die verlassenen Stollen bekümmerte, konnte auch keiner um diesen eigentümlichen Zufall wissen, der die Verbindung eines alten Schachtes mit der Oberwelt hergestellt hatte.
Ehe Friedrich jedoch seinen Plan ausführte, wünschte er auch die unteren Teile des Bergwerks zu durchforschen; er hatte eine Hoffnung, die er sich kaum eingestand, so verwegen schien sie ihm selber. Konnte nicht auch dort irgendwo der Zufall einen Ausgang geschaffen haben, den er als erster entdecken sollte? In solch einem Falle hätte er vor allen weiteren Schritten zunächst Schulze und Tompaipo aufsuchen können, um zu erforschen, ob sich inzwischen sein Bruder wieder eingefunden habe, oder ob etwas über dessen Schicksal in Erfahrung gebracht worden sei.
Jedenfalls verschlug es nichts, wenn er das untere Bergwerk vor allem andern genau untersuchte: an Zeit fehlte es ihm ja hier am allerwenigsten. Wenn er aber den beabsichtigten Aufstieg bewerkstelligte, so wußte er nicht, was ihn dort oben erwartete, und ob er überhaupt wieder zurückkehren werde. Darum schien es ihm am geratensten, die Ausführung dieser Absicht noch zu verschieben. Bot das untere Bergwerk keinen Ausgang, so war ihm sein Weg von selbst vorgezeichnet.
MIT diesem Entschluß kehrte Friedrich in seine Wohnräume zurück, um sich durch einen Imbiß und einige Stunden Schlaf zu seiner neuen Entdeckungsreise zu stärken.
Der Jüngling hatte bereits alle Zeitrechnung verloren. Eine Uhr hatte er wohl bei sich, aber sie war stehen geblieben, und hier unten konnte er nicht einmal wissen, ob es Tag oder Nacht sei.
Wie lange er damals in der engen Höhle eingeschlossen war, ahnte er nicht, und welche Zeit seither vergangen war, noch weniger. Wie es jedem geht, der in kurzer Zeit viel erlebt und viel Neues sieht, war er geneigt, die verflossene Zeit für weit größer zu halten, als sie in Wirklichkeit war; es schien ihm manchmal, als befinde er sich schon seit Wochen hier unten! Daß dies nicht in Wirklichkeit der Fall sei, konnte er wohl ausrechnen, wenn er nur zählte, wie oft er in der Unterwelt geschlafen hatte; dennoch glaubte er, es möchten immerhin etwa sechs Tage sein, seit er Moiatu in die Höhle gefolgt war. In Wahrheit war es aber nicht einmal so lange.
In der Nacht vom 7. auf den 8. März hatte Moiatu seinen Schurkenstreich an ihm verübt; kaum zwanzig Stunden später war Friedrich in den Saal des Inka gelangt. Am 9. und 10. März machte er seine ersten kurzen Entdeckungsreisen in das Bergwerk, stets mehrere an einem Tag — oder in einer Nacht. Am Vormittag des 11. März entdeckte er den Gang, der ihm Aussicht bot, ins Freie auf den Berggipfel zu gelangen. Nun war es am gleichen Tage, etwa abends 8 Uhr, als er sich wieder auf den Weg machte; er nahm vorsorglich einige Mundvorräte mit, um auch bei einer großen Ausdehnung der Bergwerke nach nördlicher Richtung ihre Endpunkte erreichen zu können, ohne durch Hunger zur Umkehr genötigt zu werden; schlafen konnte er ja überall.
Es war eben die Nacht, in der Ulrich durch Unkas befreit wurde.
Der untere Teil des Bergwerks, den Friedrich nun durchwanderte, zeigte keine Spur von Gold; dagegen flimmerte alles um ihn her von klarstem Silber, und er war fast geneigt, diesen Anblick für weit herrlicher zu halten als den des roten Goldes, weil er seinen Blick für das Schöne nicht durch den Gedanken an den Geldwert beeinflussen und trüben ließ.
Unterwegs überlegte Friedrich, daß es eigentlich eine tolle Hoffnung von ihm sei, es möchte sich ein merkwürdiger Zufall in ähnlicher Weise zweimal an gleicher Stelle wiederholen; überdies, gewann er viel durch eine Rückkehr ins Lager der Napo? Er wollte ja doch unter allen Umständen, ob er nun Ulrich fand oder nicht, seiner ersten Entdeckung späterhin nachgehen, und zwar ehe der Inka sein Entweichen ahnen konnte. Endlich, war es überhaupt denkbar, daß Ulrich wiedergefunden worden sei? War es nicht viel wahrscheinlicher, daß er in ähnlicher Weise wie er selbst in die Höhle eingeschlossen wurde und vielleicht auf andern Wegen zu den Höhen gelangt war, wo Friedrich den Vater suchen wollte? Es konnte doch etwas Wahres an der Erzählung des falschen Moiatu gewesen sein; immerhin schien es nicht ausgeschlossen, daß der Weg von den Goldminen aus zur Oberwelt auch zu einer Wiedervereinigung mit Ulrich führen konnte.
Doch was Friedrich einmal begonnen hatte, führte er auch durch; und so durchforschte er vorerst jeden Seitengang der Silberminen bis auf die geringsten Abzweigungen. Er fand bald heraus, daß diese Silberbergwerke gar nicht tief hinabführten; einige Schächte, die senkrecht in die Tiefe zu gehen schienen, waren allerdings völlig verschüttet. Immerhin waren die Stollen so vielverzweigt, daß der Jüngling schon über fünf Stunden gewandert war, als er endlich an einer Stelle, wo der Haupttunnel jäh aufhörte, den letzten Seitengang erreichte.
Auch dieser bot nichts, was Friedrichs Hoffnung hätte Nahrung geben können, und schon wollte der Enttäuschte umkehren, da er das Ende des Stollens vor sich sah — als er im Hintergrunde einen dunklen Punkt bemerkte; dieser erwies sich bei näherem Zusehen als ein Erdloch, durch das der Jüngling sich mühevoll hindurchzwängte. Er sah aber bald, daß er nichts gewonnen hatte; es handelte sich nur um eine größere Auswaschung des Erdbodens, die das spärlich von oben herabsickernde Wasser nach und nach gebildet haben mochte. Unten verschwanden die dünnen Wasserfäden in unscheinbaren Spalten, die vielleicht in die verschütteten unteren Teile des Bergwerkes führten.
Friedrich war im Begriff, sich wieder durch das enge Loch in die Silberminen zurückzubegeben, da — horch! Was war das? »Deutschland, Deutschland — Deutschland, Deutschland« ... Das war ja deutlich die Melodie der Orgelsteine, die ihm in der Guacharohöhle aufgefallen war; kein Zweifel, die Orgelsteine befanden sich unmittelbar zu seinen Häupten, über sie tropfte das Wasser hier herab, sich mit andern Tropfen zu dünnen Fäden vereinigend, und vielleicht war die Decke, die sich über seinem Kopfe schloß, lange nicht so undurchdringlich, wie sie aussah.
Der durch diese Entdeckungen und Vermutungen ebenso überraschte wie erregte Jüngling, der in dem niedern Raume nur gebückt stehen konnte, stemmte sich nun mit aller Kraft gegen den Stein, der den vom Wasser ausgehöhlten Kamin nach oben zu verschloß, und siehe da! es war nur eine dünne Platte, die sofort nachgab. Dennoch stand Friedrich nicht hoch genug, um sie völlig hinwegheben zu können; da vernahm er einen Ruf von oben: »Friedrich!« — »Hier bin ich!« antwortete er, und wenige Sekunden darauf wurde die Platte von oben her abgehoben.
ALS Unkas Ulrich glücklich aus dem Lager geführt hatte, in dem dieser gefangen gehalten worden war, riet er ihm zu sofortiger Flucht.
Ulrich aber wollte von einer Flucht ohne seinen Bruder nichts wissen. Da erzählte ihm Unkas dessen trauriges Schicksal und sprach die Vermutung aus, daß der Unglückliche wohl schon dem Hunger erlegen sein müsse.
Ulrich erklärte sofort, sich in die Höhle begeben zu wollen, um nach dem Bruder zu suchen; da er sich dies nicht ausreden ließ, begleitete ihn Unkas, mit einer Fackel versehen, dorthin. Bei den Orgelsteinen vermied es Ulrich wohlweislich, auf die Platte zu treten, die ihn das erste Mal zu Falle gebracht hatte. Bald war auch die Stelle erreicht, wo nach Unkas Aussage Friedrich von Moiatu eingeschlossen worden war. Aber auch Ulrich vermochte, trotz aller Bemühungen und allen Kopfzerbrechens, nicht herauszufinden, wie die Eröffnung dieses Sesams zu bewerkstelligen sei. Er verzweifelte schließlich am Erfolg, und es war nur ein Ausruf des Verzagens, als er mit schmerzlicher Stimme rief: »Friedrich!« Ach! der Bruder konnte ihn durch den dicken Stein hindurch nicht hören, auch wenn er noch am Leben war!
Aber da erscholl die Antwort: »Hier bin ich!« und zwar vom Eingang des Ganges her. Ulrich war es, als höre er eine Geisterstimme; doch schwellte eine freudige Ahnung seine Brust; er wandte sich um und sah in der Nähe der Orgelsteine einen hellen Lichtglanz aus dem Boden hervorbrechen.
»Dort, dort!« rief Unkas, als ob Ulrich nicht auch so viel sähe wie er.
Beide eilten außer sich vor Freude auf die Stelle zu und hoben rasch die Platte auf, deren schwankende Lage ihnen ja schon früher aufgefallen war, ohne daß sie etwas Besonderes darunter vermutet hatten; nun sahen sie im ausgewaschenen Boden ein Loch, das zuvor völlig von der Platte verdeckt gewesen war, und das auch nur infolge des einsickernden Wassers, vielleicht erst seit kurzem, durchgebrochen sein konnte.
Der Lichtschein, der hier heraufleuchtete, blendete sie zuerst vollständig; dann aber sahen sie Friedrichs Kopf auftauchen, und im nächsten Augenblick war der Wiedergefundene mit ihrer Hilfe dem Boden entstiegen und lag in Ulrichs Armen.
Unkas tanzte vor Entzücken einen wilden Indianertanz um die beiden herum, so daß er beinahe in das Loch gefallen wäre.
Nachdem der erste Freudenrausch vorüber war, erzählten die Brüder einander ihre Schicksale. Ulrich besonders war höchlich erstaunt, wie er von den Geheimnissen und Wundern der Inkahöhle und den Gold- und Silberminen hörte; als Friedrich ihm seinen Entschluß mitteilte, auf dem Gipfel des Gebirges nach dem Vater zu forschen, machte er zwar zuerst Einwendungen, da er neue Gefahren für den Bruder befürchtete; mußte jedoch einsehen, daß Friedrich von seinem Vorhaben nicht abzubringen war. Das Unternehmen lockte übrigens Ulrich selber, und so erklärte er ihm, ihn sofort begleiten zu wollen.
»Moiatu,« sagte er, »hat zwar schändlich an uns gehandelt und uns stark belogen; aber etwas Wahrheit war jedesmal in seine Lügen gemischt; so machen es ja die echten Ränkeschmiede, sie benutzen die Grundlage der Wahrheit, um ihr Lügengebäude darauf zu errichten, weil es dann viel eher Bestand hat und ihre Opfer täuscht. Darum halte ich es für gar nicht unwahrscheinlich, daß auch etwas Wahres an dem sein kann, was er von der Gefangenhaltung unseres Vaters in dieser Gegend sagte.«
»Ein Umstand besonders macht mir dies sehr einleuchtend,« meinte Friedrich, »nämlich der, daß Moiatu, der uns doch zuvor gar nicht kannte, überhaupt von unserem Vater etwas wußte und sogar seinen Namen nannte, wie er auch über die Schicksale seines Rancho Nueva Esperanza genau unterrichtet war; dazu kommt noch, daß der alte Miguel uns so bestimmt in diese Gegend wies.« Wie konnte er ahnen, daß der vermeintliche Indianer ein Spießgeselle des schurkischen Alvarez und Miguel durch die Mestizen bestochen worden war.
So wurde denn die Entdeckungsreise beschlossen und Unkas angewiesen, die Platte wieder an ihre alte Stelle zu rücken, wenn die Brüder hinabgestiegen seien. Zu zweit konnten sie ja diese jederzeit wieder emporheben, wenn einer am andern emporkletterte. Dann sollte Unkas die nächsten acht Tage die Lama und alles zur Flucht bereit halten und täglich zweimal unauffällig an einen bestimmten Platz in der Nähe der Schlucht kommen, die zur Guacharohöhle führte. Seien die Brüder nach acht Tagen dort noch nicht erschienen, dann würden sie wohl nicht so bald wiederkehren. Unkas wollte sich durchaus nicht von ihnen trennen, sondern alle Gefahren mit ihnen teilen; allein die Brüder hielten ihm seine Pflichten gegen Schulze vor, dem er auch Kunde von ihnen bringen sollte. Er könne ihnen auf diese Weise viel mehr nützen, während seine Begleitung bei ihrem jetzigen Unternehmen keinen großen Wert für sie haben könnte.
So schied denn Unkas traurigen Herzens von ihnen und verschloß die Öffnung, durch die sich seine weißen Freunde hinabbegeben hatten.
Friedrich wies dem Bruder in den Silberbergwerken ein bequemes Plätzchen an, da Ulrich des Schlafes zunächst am meisten bedürftig war; dann zog er sich in seine unterirdischen Gemächer zurück, sowohl um Vorräte für sich und den Bruder zu holen, als auch um nicht durch sein langes Ausbleiben des geheimnisvollen Greises Verdacht zu erwecken.
Die Umstände sollten sich für seine Pläne so günstig als nur möglich gestalten; denn kaum war er in seine Wohnhalle getreten, als der ehrwürdige Inka eintrat und ihn folgendermaßen anredete: »Dein Vater muß über einen Mondwechsel diese Stätte verlassen; doch hat er dafür gesorgt, daß es seinem Sohne an nichts mangeln wird. Hat aber mein Sohn so viel Gefallen an den Gold- und Silberhöhlen, daß er sich bei ihrer Erforschung länger aufhalten will, so rate ich ihm, sich mit genügendem Mundvorrat zu versehen; das wird ihm auch zustatten kommen, wenn er sich einmal verirren sollte, was ja auch vorkommen kann; doch wird er sich schließlich immer zurückfinden, da die Gänge, so zahlreich sie sind, nicht verworren, sondern sehr regelmäßig angelegt wurden, wie in allen Bergwerken der Inka.«
Damit entfernte sich der Greis. Friedrich aber belud sich mit Eßwaren und suchte den Bruder wieder auf, den er in tiefem Schlafe fand. An seiner Seite gönnte er sich nun auch einige Stunden Ruhe, und als sie beide fast zu gleicher Zeit erwachten, war es etwa um die Mittagszeit des l2. März.
Nun stärkten sie sich durch Speise und Trank, nahmen für alle Fälle noch etwas Vorrat mit, und traten alsdann ihre Entdeckungsreise an.
ULRICH war geblendet von dem feurigen Gefunkel der goldenen Gänge, die sie durchwanderten.
»Wenn von diesen Schätzen etwas bekannt würde,« sagte er, »so würden Hunderttausende nach Columbia strömen und ihr Glück hier machen.«
»Ja,« erwiderte Friedrich, »wenn Reichtum das Glück ausmachen könnte.«
»Du weißt wohl, wie ich es meine! Leider kennen ja die meisten Menschen kein höheres Glück als den Besitz dieser glänzenden Metalle.«
Nach etwa zweistündiger Wanderung war der »Fuchsbau« erreicht. So bezeichnete Friedrich die nach oben führende Höhle, obwohl er wußte, daß es schon ein unheimlich großer Fuchs gewesen sein müßte, der solch ein Loch hätte ausgraben können. Im Kamin angelangt, erkletterte Friedrich Ulrichs Schultern, und gelangte auf diese Weise unschwer ins Freie. Dann half er dem Bruder ebenfalls herauf.
»Wir müssen uns die Stelle ganz genau merken,« mahnte Ulrich. »Wer weiß, ob wir nicht in die Lage kommen, fliehen zu müssen, und dann froh sein werden, uns rasch wieder hierher zurückzufinden.«
»Schwer wird das Merken wohl nicht werden,« meinte Friedrich, »denn es hat den Anschein, als befänden wir uns zwischen den Wurzeln eines Riesenbaumes, der kaum seinesgleichen haben dürfte.«
Er hatte mit dieser Vermutung zum Teile recht, sie krochen unter dem Stamme eines Baumes vor, der einen gewaltigen Umfang zu haben schien; das dichte Wurzelwerk, das ihre Köpfe hoch überragte, erlaubte ihnen noch keine Übersicht. Hier verbarg Friedrich den leuchtenden Stein, der ihnen in der Tageshelle überflüssig war.
Jedenfalls aber bedurfte es besonderer Merkmale, um den Eingang der Höhle wiederzufinden, der in dem Gewirre der Wurzeln völlig versteckt war; ein Unkundiger hätte ihn von außen nur durch einen unwahrscheinlichen Zufall entdecken können.
Ulrich schnitt denn auch auf Schritt und Tritt Zeichen in die hohen Wurzeln und bezeichnete auf diese Weise den Weg.
Endlich traten sie zwischen den Wurzeln heraus und befanden sich in einem Wald.
Es dauerte aber eine geraume Weile, bis sie sich überhaupt klar darüber waren, daß es ein Wald sei, der sie umgab, daß diese ungeheuren rauhen Türme, die sich zum Himmel erhoben, wirkliche Bäume seien; denn das waren Stämme von einem Umfang von achtzig bis hundert Metern und einer Höhe bis zum Doppelten des Umfangs! Was wollten dagegen die Eukalypten Australiens besagen? War nicht der Affenbrotbaum Afrikas ein Zwerg gegen diese Riesen? Und selbst die Mammutbäume Kaliforniens, die bis zu siebzig Meter im Umfang und weit über hundert Meter Höhe erreichen, konnten sich noch lange nicht mit diesen Wunderbäumen messen.
Ganz überwältigt von ehrfürchtigem Staunen sahen unsere Freunde an diesen Giganten empor zu den Wipfeln, die in unendlicher Ferne, von Ästen getragen, die selber Stämmen von fabelhaften Größenverhältnissen glichen, ein dämmerndes Dunkel über die Gründe breiteten.
Zwischen den Säulen des Wunderdomes standen Bäume, deren Höhe und Durchmesser sonst überall Aufsehen erregt haben würden, hier aber den Eindruck niederen Buschwerks und junger Nachtriebe machten.
Nicht stumm und tot war es in diesem märchenhaften Walde, wenn man auch nicht die gellenden Schreie der Affen noch das schrille Gekreisch der Papageien vernahm; ein Vogelkonzert erscholl in den Lüften, ein Gesang von solch ungemein herzergreifender Lieblichkeit, daß unsere Freunde sich gestanden, nie etwas gehört zu haben, das solchen Klängen auch nur entfernt ähnlich gewesen wäre.
Und dieses goldene Singen in der sonst lautlosen Stille erhöhte die Feierlichkeit der Stimmung, die die Jünglinge ergriffen hatte, so daß es ihnen wirklich war, als befänden sie sich in einem heiligen Tempel, den der Schöpfer selber besonders geschaffen hätte.
Zu seinen Ehren,
Um uns zu lehren,
Wie sein Vermögen sei mächtig und groß!
Plötzlich rief Ulrich aus: »Der Phönix, der Phönix!«
Ganz in ihrer Nähe schwebte einer der gefiederten Sänger herab und ließ sich auf einer schlangenförmig sich emporbäumenden Wurzel nieder, und da saß er nun, in einer Höhe von kaum zwei Metern, so daß sie ihn genau betrachten und bewundern konnten.
Er wendete anmutsvoll das Köpfchen hin und her, das mit einer wunderbar goldgrün glänzenden Haube von starren seidenartigen Federn in Halbkugelform gekrönt war.
Die klugen, entzückend schönen Augen blickten lebhaft nach den Jünglingen. Über die schwarzblinkenden Schwingen und den schwarzweißen Schwanz wallte das Deckgefieder in schmalen, lanzettförmigen, smaragdgrünen Zungen schillernd hernieder. Ein zarter scharlachroter Flaum bedeckte leuchtend Hals und Brust, und über den Rücken, zwischen den teils schwarzen, teils weißen Steuerfedern des Schwanzes hindurch strömten feingefiederte, schmale und außerordentlich lange Federn von einem unbeschreiblich herrlichen goldgrünen Glanze; einen Meter lang hingen die beiden längsten dieser Federn in graziösem Schwunge hinab und wiegten sich anmutig in der Luft.
Bei jeder Bewegung wechselte das entzückende Farbenspiel des Gefieders, je nach Auffallen des Lichtes: einmal erschien es braunviolett, dann tief stahlblau, dann wieder blitzte ein metallisches Blaugrün auf, das schließlich in goldiges Smaragdgrün überging. Und dazu das rosige Glühen der Purpurbrust mit ihrem zitternden Flaum!
Nun flog der Vogel wieder auf: ach! wie prächtig wogte und wallte dies strahlende Gefieder, wie leuchtend zog der Kometenschwanz dem bunten, lebendigen Meteore nach!
In den Urwäldern Venezuelas hatten die entzückten Jünglinge geglaubt, die Kolibri wiesen die herrlichste blitzende Farbenpracht auf, die überhaupt auf Erden denkbar sei, was der Regenbogen und die funkelnden Edelsteine an Farben und Glanz besäßen, das sei allein auf ihrem Gefieder vereinigt. Nun sahen sie ein Wunder der Schönheit und Lieblichkeit, das jene fliegenden Juwelen unendlich übertraf, einen Glanz und eine Farbenpracht, die keine menschliche Phantasie sich vorzuzaubern vermöchte!
»Ja, das ist der Vogel Phönix!« sagte Friedrich, als der Märchenvogel wie ein Traumbild entschwunden war. »Das ist der sagenhafte Bennu der Ägypter, der wunderbare Bülbül aus Tausendundeiner Nacht; es ist der Quezal, der heilige Sonnenvogel Mexikos, dem selbst unsere so nüchterne Wissenschaft den Namen Paradiesvogel beilegte. Dieser schönste unter den Vögeln, dem die Natur nichts Ähnliches an die Seite zu stellen hat, war im alten, herrlichen Aztekenreiche das Sinnbild des gefeiertsten Gottes, Quezalcoatl.
»Von diesem Vogel ging eine schöne Sage unter den Mexikanern, zur Zeit, da Cortez ihr Reich eroberte. In Tlapallan, dem Lande des Sonnenaufgangs, das wir Europa nennen, wohnte der Gott Quezalcoatl, und es herrschte dort das goldene Zeitalter ewiger Blüte und ewigen Friedens. Aber von den Menschen beleidigt, verließ der Gott seine Heimat und zog sich zurück nach den glücklichen Inseln der Seligen, Atlantis. Und weil er seine Freude darin fand, die Welt zu beglücken, fuhr er von dort auf einem blumenbekränzten Kanu, das aus einer perlmutterschimmernden Riesenmuschel bestand, an die Gestade Mexikos.
»Er hatte ein schönes, mildes Gesicht, und freundliche Sanftmut und Leutseligkeit leuchteten aus seinen blauen Augen. Sein Antlitz war weiß und von blondem Vollbart umrahmt; blutige Tier- und Menschenopfer waren ihm ein Greuel; er verlangte nur Blumen und Früchte. Wohlgerüche aller Art erfüllten seinen Pfad mit lieblichen Düften, und Vögel von nie gesehener Schönheit, von sonnigem Glanz und strahlender Farbenpracht waren seine Begleiter.
»Mit seiner Ankunft begann eine goldene Zeit; die Menschen hatten ohne alle Arbeit und Mühe alles im Überfluß: die reichsten Ernten, die herrlichsten Früchte; und die Baumwolle wuchs auf den Bäumen in allen Abstufungen der Regenbogenfarben.
»Da führten die Menschen ein sonniges Dasein: Friede und Liebe beglückten sie, und sie taten einander alles zur Freude und nichts zuleide.
»Aber der Gott Tezcatlipoca, der Beherrscher der Nacht, war eifersüchtig, daß man ihm nicht mehr diente; er gab Quezalcoatl einen Zaubertrank, der ihn mit unnennbarer Sehnsucht nach seiner Heimat, den Seligen Inseln, erfüllte. Und er fuhr wieder von dannen, und Elend, Mord und Blutvergießen verheerten das Land und brachten Gram und Verzweiflung den unseligen Menschenkindern.
»Der Sonnenvogel Quezal allein blieb zurück als Erinnerung an die selige, goldene Zeit; aber auch er verschwand aus den Städten der Menschen und wohnte fortan in der Wildnis des Urwalds.«
»Welch schöne Sage!« rief Ulrich entzückt.
»Ich glaube,« sagte Friedrich, »es spiegelt sich darin die Erinnerung an uralte Zeiten, da die ersten Weißen, wahrscheinlich Germanen, zu den Roten kamen und ihnen eine blühende Kultur des Friedens brachten, so ganz anders als die späteren goldgierigen und blutdürstigen spanischen Eroberer. — Das merkwürdigste am Vogel Quezal scheint mir aber, daß es unmöglich ist, ihn in der Gefangenschaft zu halten: er stirbt darin unbedingt nach kürzester Frist, und dadurch wird er so recht zum Sinnbild der Freiheit.«
UNTER diesen Gesprächen waren die Brüder im Walde vorgedrungen bis zu einer Hecke von dichtem Buschwerk, die ihn zu umsäumen schien. Nicht ohne Schwierigkeit gelang es ihnen, das Gestrüpp zu durchbrechen; kaum aber öffnete sich ihnen der Blick ins Freie, als sie wie angewurzelt stehen blieben.
Der Anblick, der sich ihnen hier bot, übertraf aber auch alles, was sie bisher je geschaut hatten, oder was sich ihre Phantasie, von goldenen Sagen angeregt, je hatte ausmalen können.
Vor ihnen dehnte sich ein weiter blauer See, wahrhaftig ein Himmelsauge in seiner Lieblichkeit und seinem stillen Frieden. Seine grünen Ufer mit ihren goldenen Fluren und Büscheln mächtiger Urwälder gleich ragenden Inseln dazwischen lachten die verzückten Beschauer an. Sanfte Hügel und reizende Täler zeigten sich im Hintergründe, und in weiter Ferne schloß eine hohe Felsenmauer mit wildgezackten Zinnen das Ganze ab; an den Ufern des Sees aber, auf den Hügeln und am Eingang der Täler zeigten sich eine Unzahl freundlicher Dörfer und herrlicher Städte mit buntbemalten Steinhäusern, das märchenschöne Landschaftsbild mit ihren leuchtenden Farben belebend. Silberne Bäche und schäumende Wasserfälle vereinigten sich zu schimmernden Flüssen, die in malerischen Schlangenwindungen dem See zueilten, in den sie sich ergossen. Alles machte einen solchen Eindruck der Frische, des Friedens und des Glückes, als sei hier ein Paradies in völliger Unberührtheit zu schauen, wie es rein und vollkommen soeben aus des Schöpfers Händen hervorgegangen war.
Aber alles wurde überstrahlt von einer Riesenstadt, die sich in nächster Nähe unserer Freunde an die südlichste Ausbuchtung des Sees schmiegte, ihn gleichsam umarmend, da sie sich noch eine Strecke auf dem westlichen und östlichen Ufer hinzog.
Und diese Stadt blitzte und flimmerte so feurig im Sonnenschein, daß nur so kerngesunde Augen wie diejenigen Ulrichs und Friedrichs ihren Glanz überhaupt zu ertragen vermochten. Alle Häuser schienen aus Gold erbaut oder doch vollständig übergoldet zu sein. Aus gediegenen goldenen Platten bestanden die Dächer, die meist flach waren, zum Teil aber auch giebelförmig. Mächtige goldene Kuppeln ragten aus dem Häusermeer empor, prächtige Paläste mit hohen Türmen und zierlichen Türmchen erhoben sich über die niederen Häuser.
Und wie kunstvoll waren diese Bauten ausgeführt! Trotz all des Goldglanzes keine Einförmigkeit: hier zeigten sich schön geschwungene Bogen, auf wuchtigen Pfeilern ruhend, dort trugen schlanke Säulen die einzelnen Stockwerke. Die Fenster glitzerten von Kristall, Verzierungen aus Silber und Edelsteinen schmückten die Außenwände; goldene und silberne, smaragdgrüne und rubinrote Bilder von Menschen und Tieren belebten die weiten, mit Gold- und Silberplatten mosaikartig gepflasterten breiten Straßen und weiten Plätze.
Friedrich fand zuerst die Sprache wieder. »Wir schauen das Goldland der Omagua,« sagte er ergriffen, »den See und die Stadt Manoa, die sagenhaften Stätten, die wie eine lockende, trügerische Luftspiegelung so vielen Helden und Abenteurern Jahrhunderte hindurch vorschwebten und stets wie ein Nebelbild vor ihren sehnsüchtigen Blicken entschwanden.«
»So wäre denn Wirklichkeit, was man längst für Phantasie und Fabeln erklärte?« erwiderte Ulrich. »Was sage ich?! Es ist Wirklichkeit, daran ist nicht zu zweifeln; wir sehen es ja mit eigenen Augen. Aber wahrhaftig, es ist mir selber, als schaute ich eine ferne Luftspiegelung oder befände mich in einem Traum befangen und alles müßte binnen kurzem in Nebel zerrinnen. — Aber, sieh doch! Was ist das?«
WIE auf Befehl liefen gleichzeitig aus allen Buchten des Sees buntbewimpelte Kähne und Boote, mit Blumengirlanden geschmückt und mit schön gewachsenen Männern und Frauen besetzt, in den See hinaus, der nun wie mit einem Zauberschlage ein Bild des bewegtesten Lebens bot.
Gleich darauf fuhr ein großes, prächtiges Schiff, mit vergoldeten, geschnitzten Figuren geziert, aus dem Hafen der Goldstadt in den blauen Spiegel hinaus, umtanzt von kleinen dicht bemannten Booten. Zarte rosenrote Segel blähten sich an den schlanken Masten der großen Galeere. Vorn auf dem Verdeck war ein mit Edelsteinen geschmückter silberner Thronsessel errichtet, auf dem ein hochgewachsener, schön gebauter Jüngling mit edlen Gesichtszügen saß, am ganzen Leibe mit flimmerndem Goldstaub bedeckt.
»El Dorado!« rief Friedrich aus. »Allein, wie ist mir? Ich meine, diese Gestalt und dieses Antlitz schon einmal gesehen zu haben. Aber es muß natürlich Täuschung sein; auf die Entfernung lassen sich ja die Gesichtszüge nicht so genau unterscheiden.«
In der Mitte des Sees kamen alle die bunten Gondeln zusammen und boten in ihrer Vereinigung ein prächtiges Schauspiel. Immer noch wurde ihre Zahl vermehrt durch das Hinzukommen der Boote, die einen weiteren Weg zurückzulegen hatten.
Bald drängten sich Hunderte der blumenreichen, sanft schaukelnden Pirogen um das majestätische Schiff in der Mitte. El Dorado erhob sich, und Jungfrauen boten ihm zierlich geflochtene Körbe, bis zum Rande mit Edelsteinen gefüllt, jeder mit einer besonderen Art. Und nun warf der Dorado die kostbaren, blitzenden Steine mit vollen Händen hinab in den See unter dem tausendstimmigen Jubel der Menge. Wie ein Funkenregen sprühten sie hinab, die Diamanten, Rubine, Saphire, Topase, Smaragde, Granaten, Hyazinthen, Berylle, Chrysolithe, Opale, Onyxe, Amethyste, Türkisen und Heliotrope, und zuletzt sprang El Dorado selber vom Schnabel des Schiffes ihnen nach und spülte in den Fluten des Sees den Goldstaub von seinem Leibe ab. Dann schwang er sich an einem Bastseil wieder zu seinem Throne empor, und die Männer und Frauen auf seinem Fahrzeuge stimmten einen feierlichen Sang an, der in Jubeltönen endigte.
Hierauf ruderten die Pirogen sämtlich wieder dahin zurück, woher sie gekommen waren.
Ulrich und Friedrich, ganz versunken in den Anblick des Prachtschiffes des Dorado, besonders die rosigen Segel bewundernd, die wie zarte Blätter der Heiderose, von der Sonne durchschimmert, leuchteten, bemerkten nicht, daß einige der Heimkehrenden, auf die Jünglinge am Ufer weisend, unter lebhaften Gebärden einander von Boot zu Boot etwas zuriefen und dann geradeswegs der Stelle des Ufers zusteuerten, an der die Brüder standen.
MEHRERE Dutzend kräftig gebauter Indianer sprangen ans Ufer und drangen auf die Knaben ein, die sich ergriffen sahen, ehe sie nur recht die feindliche Absicht der Ankömmlinge erkannt hatten.
Die Männer sahen nicht grimmig und wild aus; traurig und mitleidig blickten sie vielmehr auf die schönen weißen Jünglinge.
Einer von ihnen redete sie in wohlklingender, aber den Brüdern völlig unverständlicher Sprache an; ein anderer zog ein Messer aus dem Gürtel und machte damit eine nicht mißzuverstehende Bewegung, aus der unsere Freunde deutlich genug erkannten, welches Schicksal ihnen bevorstehe.
»Hier ist nichts anzufangen,« raunte Ulrich dem Bruder zu. »Ich begreife, daß unser Eindringen in dieses Paradies genügt, um uns des Todes schuldig zu machen; denn ohne solch unerbittliche Strenge wäre es ja dem glücklichen Volke hier oben nie möglich gewesen, das Geheimnis seines Aufenthalts Jahrhunderte hindurch zu wahren.«
»Und wenn es entdeckt würde,« fügte Friedrich bei, »so fürchten sie, wohl nicht mit Unrecht, daß ihre goldene Zeit zu Ende wäre, wie es den Mexikanern und Peruanern ging, als sie von den Spaniern entdeckt wurden.«
»Also, eines steht fest: sie wollen uns töten.«
»Und ebenso fest steht, daß sie ganz recht haben.«
»Meinetwegen, von ihrem Standpunkt aus! Wir jedoch haben hinwiederum das Recht, unser Leben zu retten.«
»Gewiß! Aber die Reihen stehen so dicht wie Mauern um uns herum. Es gibt nur zwei Wege zur Flucht: über die Köpfe weg oder unter den Beinen durch.«
»Wählen wir den letzteren«, riet Ulrich.
Und blitzschnell rissen sich die Knaben von den Männern los, die sie an den Armen gepackt hielten, bückten sich zu Boden, so daß die verblüfften Indianer meinten, sie in der Erde verschwinden zu sehen, und fuhren mit den Köpfen zwischen die Füße der Nächststehenden mit solcher Gewalt, daß sie sich Bahn brachen; zugleich schnellten sie ein paarmal mit dem Rücken empor; dadurch verloren die Leute, unter denen sie wegkrochen, den Halt ihrer Füße und taumelten zur Erde.
Als auf diese Weise in wenigen Sekunden der vier- bis fünffache Kreis der sie Umzingelnden durchbrochen war, schlüpften die Entkommenen in das Dickicht und eilten dann auf Leben und Tod der Stelle zu, wo sie den Eingang in die Goldminen wußten.
Aber die Indianer hatten sich rasch von ihrer ersten Verblüffung erholt und jagten nun den Flüchtlingen nach. So vorzügliche Renner unsere Freunde auch waren, mit der Gelenkigkeit dieser Naturkinder konnten sie entfernt nicht wetteifern; und da sie nur einen geringen Vorsprung hatten, waren sie bald eingeholt.
»Verteidigen wir unser Leben, um es so teuer als möglich zu verkaufen,« rief Ulrich, als er sah, daß die Feinde ihnen auf den Fersen waren; und er riß das Gewehr von der Schulter.
»Ich bitte dich, vergieße kein Blut!« rief Friedrich seinerseits, ihm in die Arme fallend. »Einen Wert hätte es ja doch nicht bei der Menge unserer Verfolger.«
»Wer weiß, ob sie nicht so sehr eingeschüchtert worden wären, daß wir hätten entkommen können,« murrte Ulrich. »Sieh! es sind kaum noch zehn Schritte bis zu dem Baum, der den Höhleneingang verbirgt.«
»Und wenn auch! Wenn wir nur kein Menschenleben auf dem Gewissen haben!«
Ein weiterer Streit war übrigens müßig; denn die Indianer warfen ihnen bereits Schlingen über den Kopf und fesselten ihnen die Arme in der Weise, daß die zugezogenen Lasso ihnen diese fest an die Seiten preßten.
»Halt, halt, halt!« rief da eine atemlose Stimme. »Das geht einfach nicht! Ach, was sind das für riesige Bäume, wissenschaftlich ganz unhaltbar! Aber ihr dort, wollt ihr wohl gleich die jungen Herren freigeben? Nanu, wird's bald?!«
Als Unkas in der Nacht heimgekehrt war, hatte er dem Professor sofort von Ulrichs Befreiung und dem Wiederfinden Friedrichs berichtet. Schulze machte ihm die größten Vorwürfe, daß er die beiden nicht zurückgebracht habe und sie ein gefährliches Unternehmen ohne Schutz habe antreten lassen, und er erklärte sofort, sie beide müßten den Gefährdeten folgen.
Unkas war gleich dabei. Sobald sie sich unbemerkt entfernen konnten, drangen sie um die Mittagszeit, mit Fackeln versehen, in die Guacharohöhle und von dort bei den Orgelsteinen in das Silberbergwerk ein, den Eingang hinter sich verschließend. Sobald sie in den Hauptstollen gelangt waren, eilten sie in ihm weiter, und ohne zuvor den Weg zu wissen, den die Jünglinge eingeschlagen hatten, gingen sie sozusagen der Nase nach, fanden aber auf diese Weise gerade die rechte Richtung.
So kam es, daß beide, Schulze voran, eben in dem Augenblick an der Erdoberfläche auftauchten, als ihre jungen Freunde gefesselt worden waren. Der Professor war empört, daß diese gutmütig aussehenden Rothäute auf seine Befehle gar nichts gaben, im Gegenteil, statt ihre Gefangenen freizulassen, obendrein noch ihn und Unkas fesselten.
»Nein, das ist schändlich!« rief er. »Wie kann man nur so ganz anders handeln, als man aussieht! — Was wollen denn die Gutedel mit uns?«
»Das Leben wollen sie uns nehmen,« erwiderte Friedrich.
»Oho! da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden,« schrie Schulze. »So geht man doch nicht mit dem Leben seiner Mitmenschen um, und so mir nichts, dir nichts bläst man keine Leuchte der Wissenschaft aus!«
»Sie vergessen, daß die Leute unsere Sprache nicht verstehen und für die Zoologie, im besonderen für die Darwin-Häckelsche Entwicklungstheorie, kein Interesse haben dürften,« hielt ihm Ulrich entgegen.
»Ach, Herr Ulrich, Herr Friedrich, ich habe Sie in der Eile und Aufregung gar nicht ordentlich begrüßt! Wie mich's freut, Sie wiederzusehen! Kommen Sie, lassen Sie sich doch die Rechte drücken!«
»Herzlich gern,« lachte Ulrich. »Aber leider befindet sich meine Rechte gegenwärtig bereits in allzu gedrückter Lage: das dürfte auch auf die Ihrige zutreffen.«
»Ach, in der Tat, wie zerstreut ich bin! Das macht alles die große Erregung! Also die Linke, bitte!«
Nun mußte auch Friedrich lachen, und Schulze merkte, daß er wieder einen Unsinn geschwatzt hatte. Aber schon wurde seine Aufmerksamkeit völlig abgelenkt: sie waren an den Saum des Waldes gelangt, und zwar an eine Stelle, wo ein Fußpfad die Randhecke durchbrach; und da lachte ihnen der See Manoa und die ganze paradiesische Landschaft an seinen Ufern entgegen, Glück und Frieden atmend. Und die Goldstadt Manoa funkelte im Abendsonnenglanze noch herrlicher, als sie kurz zuvor unsern Freunden erschienen war.
Da war Schulze sprachlos; und als sie nun gar in die Stadt geführt wurden und die ganze Pracht ihrer Straßen, Häuser und Paläste aus nächster Nähe anstaunen konnten, da waren sie alle drei so hingerissen von dem unvergleichlichen, wechselvollen Schauspiel, daß sie an ihr Schicksal gar nicht mehr dachten.
Ein Bote war ihnen vorangeeilt, um die Richter der Stadt von dem unerhörten Vorfall in Kenntnis zu setzen, daß vier Fremdlinge in das Land gedrungen seien, die man hierher bringe. So fanden sie denn auf dem Hauptplatz bereits eine ungeheure Menschenmenge versammelt, durch die bei ihrer Ankunft ein flüsterndes Brausen ging, dem aber alsbald wieder lautlose Stille folgte.
In der Mitte des Platzes waren zwölf hohe Thronsessel errichtet; zehn davon aus rubinrotem Stein, die zwei mittleren aber, die die anderen hoch überragten, der eine aus Silber, der andere aus Gold. Letzterer war unbesetzt, während auf den elf anderen ebensoviel hochgewachsene Greise thronten, wahre Riesen, deren schneeweiße Bärte bis über ihre Knie wallten.
In der einen dieser ehrwürdigen Gestalten erkannte Friedrich sofort den alten Inka aus der Höhle. Dieser saß auf dem silbernen Stuhle und redete unsere Freunde in spanischer Sprache folgendermaßen an:
»Fremdlinge,« sagte er, »wir sitzen über euch zu Gericht, und unser Urteil steht fest, ehe es noch ausgesprochen ist. Keine Verteidigung kann euch nützen. Wir sind nicht grausam und verabscheuen das Blutvergießen. Seit dreihundert Jahren ist auf diesen Höhen kein Mensch eines gewaltsamen Todes gestorben, ja, seit zwei Jahrhunderten ist überhaupt keiner gestorben, und wir haben schon lange keine Grabstätten mehr hier. Aber kein Fremder darf diesen Grund betreten, sonst ist ihm der Tod gewiß. Ihr seid die ersten, die hier eindrangen, ihr seid die ersten, die sterben müssen. Ihr tut uns leid, unser Herz weint in uns; aber wir sind es unserm großen, glücklichen Volke schuldig, unerbittlich zu sein.
»Wie ihr euch hier einschleichen konntet, ist mir ein Rätsel: nach allen Seiten fallen unersteigliche Felsmauern in das Land unter uns ab, und unsere Städte und Dörfer, unsere Fluren und Wälder sind von einem natürlichen Wall umgeben, der den Vögeln allein kein unüberwindliches Hindernis bietet. Nur einen Weg gibt es hier herauf, und ihr müßt unerfindliche List und Gewandtheit entwickelt haben, um euch unbemerkt an den Wächtern vorbeizuschleichen, die ihn bewachen. Künftig werden wir ihn besser verwahren. Aber euer Leben ist verloren; euch kann niemand retten, und umsonst ist alles, was ihr sagen könntet.«
Der Greis wechselte einige Worte in fremder Sprache mit seinen Mitrichtern; dann erhob er sich von seinem Sitze und begann den Gefangenen eigenhändig die Bande zu lösen, nachdem er einem Manne in der Nähe ein Zeichen gegeben hatte.
Dieser schüttete aus einem Fläschchen eine Flüssigkeit in ein Becken und tauchte die Spitze eines langen Messers hinein.
Unsere Freunde errieten nur zu gut, daß ihnen mit dem vergifteten Dolche ein rasches Ende bereitet werden sollte. An eine Flucht war aber diesmal nicht zu denken; denn wie eine Mauer umschloß sie die dicht gedrängte, tausendköpfige Menge.
Als der Inka Friedrichs Bande löste, sagte er schmerzlich: »Jüngling, ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir ist um dich; aber warum ließest du dich von der Neugier verblenden und hast auch noch andern die Wege gewiesen? Ich hoffte, du solltest einmal einer der Unsrigen werden, aber deine Jugend hat dich zur Torheit verführt. Wie sollte ich dir noch trauen?«
»Inka,« erwiderte Friedrich, »nicht Neugier hat mich getrieben, sondern allein die Hoffnung, meinen Vater zu finden, von dem mir gesagt wurde, ihr haltet ihn gefangen,« und wie zum Schwure erhob er die Rechte.
»Wir halten hier niemand gefangen,« sprach der Greis traurig. »Du bist betrogen worden, und nun kostet es dich dein junges Leben!«
Der Greis wollte sich umwenden, um dem Manne mit dem Messer das Zeichen zu geben, zuzustoßen, während die Leute ringsumher sich abwandten oder ihre Gesichter verhüllten; denn niemand wollte die Fremden sterben sehen. Ja, man hörte ein Aufschluchzen, das bewies, wie mild und menschlich dieses Volk fühlte.
Im Augenblick aber, da der Inka sich von Friedrich wegwenden wollte, fiel sein Blick auf dessen erhobene Hand, und wie gebannt blieb sein Auge an ihr haften.
Er hatte wohl öfter gesehen, daß Friedrich einen Ring trug, hatte ihn aber nie weiter beachtet oder gar näher in Augenschein genommen. Nun sah er ihn aus nächster Nähe, und zwar die Seite an der Innenfläche der Hand, so daß ihm die grünlich schillernde Goldschlange mit halb erhobenem Kopf und funkelnden Rubinenaugen entgegenblitzte.
»Wie kommt der weiße Karai zu der Schlange der Inka?« rief er mit unverhohlenem Erstaunen.

»Ein roter Jüngling schenkte mir den Ring vor wenigen Tagen.«
»Das ist kein Ring, der an einen Fremden verschenkt wird. Nur einem Bruder oder einem Freunde auf Tod und Leben kann ein Sohn der Sonne solches Geschenk machen. Sage mir, woher hast du den Ring?«
»Es ist, wie ich sagte.«
Die Menge war aufmerksam geworden, und der alte Inka rief in der Landessprache einige Worte, die wohl bedeuteten, der fremde Knabe trage den Schlangenring des Kapak Inka Intiptschurin, das heißt des »einzigen Kaisers, des Sonnensohns«, und man möge diesem Mitteilung machen, daß er erscheine und die Sache aufkläre.
Eine gewaltige Bewegung ging durch die Menge und dauerte an, bis der kaiserliche Herrscher erschien. Es war dies ein jugendlicher hochgewachsener Mann von edlen, herzgewinnenden Gesichtszügen, eben derselbe, der als El Dorado, als der Vergoldete, zwei Stunden zuvor dem See Manoa die tägliche Opferspende dargebracht hatte.
Ehrfürchtig ließ ihm die Menge den Weg frei, und Friedrich erkannte sofort in dem Nahenden den Jüngling, dem er gegen den ungeheuren Lindwurm Beistand geleistet hatte.
Kaum hatte der junge Inka Friedrich erblickt, als er auf ihn zueilte und ihn freudig umarmte; dann aber bestieg er sofort den goldenen Thronsessel und redete die Menge an. Die Worte lauteten, wie er unsern Freunden später mitteilte, etwa folgendermaßen:
»Meine Brüder und Schwestern, meine Söhne und Töchter, euer Kapak Inka hielt sich dem heutigen Gerichte fern, weil er kein Todesurteil sprechen mochte und auch kein Sterben mit ansehen konnte. Nun komme ich, das Urteil zu sprechen: keine Hand meiner Getreuen darf sich wider diese Fremden erheben, ihnen irgend ein Leid anzutun, denn sie sind geheiligt durch den Schlangenring des Sohnes der Sonne.
»Als der Sohn der Sonne vor wenig Tagen hinabging in das Land außerhalb, um nach hundert Jahren wieder zu schauen, wie es dort unten aussehe, da drohte ihm der Tod, der aus unsern Gefilden verbannt ist. Menschen und alle wilden Tiere hätten dem Sohne der Sonne nichts anhaben können, aber er wurde bedrängt von dem Unüberwindlichen, dem Wurm Cupays, des Feindes aller Menschen, an einem Ort, wo es kein Entrinnen für den Sonnensohn gab.
»Und nie mehr hätten die Kinder der Sonne ihn geschaut in ihrer Mitte noch ihm zugejauchzt, wenn er seine Opfergaben versenkt in den Schoß des heiligen Sees, wenn nicht Illja Tekze Patschakamak selber ihm Hilfe gesandt hätte durch diesen jungen Helden, der für den Inka, den er nicht kannte, sein Leben dem sicheren Verderben preisgab; denn wie konnte er hoffen, einen Sieg zu erkämpfen, der noch nie einem Menschen gelungen war? Allein, er hat den Sieg behalten über den entsetzlichen Wurm Cupays, weil Patschakamak mit ihm war.
»Schauet ihn an, diesen jugendlichen Helden, der kaum den Knabenjahren entwachsen ist: er hat eine Großtat vollbracht, wie sie noch keinem Menschen gelungen ist, eine Tat, die bisher für unmöglich gehalten wurde. Und dort, der wackere Mann mit dem Barte, stand ihm nach Kräften bei.
»Schauet ihn an, und ehret und liebt ihn, diesen Liebling des höchsten Gottes, diesen teuersten Blutsfreund eures Kaisers: als er den Sohn der Sonne, der ihm ein Fremder war, dessen Rang und Namen er nicht kannte, in Todesgefahr erblickte, hat er keinen Augenblick gezögert, sein junges Leben für ihn zu opfern. Einem Ungeheuer, desgleichen er nie geschaut hatte, ging er zu Leibe, ohne Furcht und Zagen. Wer hat größeren Mut, wer hat selbstlosere Liebe, wer zeigte je höheren Edelsinn als dieser mein Bruder?
»Darum hat ihm der Sohn der Sonne seinen heiligen Ring geschenkt als dem treuesten seiner Freunde, dem er ewigen Dank schuldet, und als dem tapfersten Helden der Erde und aller Zeiten. Wer ihm Freund ist, ist Freund dem Sohn der Sonne, wer ihm ein Leid tut, verschuldet sich an der heiligen Majestät. So müssen auch seine Gefährten den Schutz des kaiserlichen Ringes genießen.«
Ein gewaltiger Jubel brach nach diesen Worten in der Volksmenge aus. Alle drängten sich heran, denn jeder wollte den Retter ihres geliebten Kaisers umarmen, und auch Schulze, Ulrich und Unkas bekamen ihren guten Teil von den stürmischen Umarmungen ab. Da aber nur die Nächststehenden sich dieses Vergnügen leisten konnten, nötigte der junge Inka Friedrich zur Besteigung seines goldenen Thronsessels, damit ihn alle wenigstens sehen könnten. Und erneuter Jubel brach aus, als das Volk den weißen Helden an der Seite des Kaisers sitzen sah.
Aber schon dämmerte es, und die Menge verlief sich, ihre Wohnungen aufsuchend.
Friedrich jedoch und seine Begleiter mußten dem Sohne der Sonne in seinen kaiserlichen Palast folgen, wo sie als seine Gäste fürstlich bewirtet wurden.
AM andern Morgen empfing der alte Inka unsere Freunde, und nachdem er sich erkundigt hatte, wie sie geruht hätten, hielt er ihnen folgende Ansprache:
»Meine Söhne sind Freunde meines Sohnes, und ihr Leben ist sicherer hier oben als es je dort unten sein kann. Aber sie kennen nun das heilige Geheimnis der Omagua, das dort unten nur einer wissen darf von den Lebenden, und das dort keiner weiß außer dem großen Morekuat der Napo, Narakatangetu. Die andern Häuptlinge der Napo wissen nur, daß Manoa hier oben verborgen liegt, sie kennen aber nicht die Geheimnisse seines Zugangs.
»Meine Söhne dürfen nun nicht mehr hinab, sie müssen hier oben bleiben; aber Patschakamak hat ihnen einen klaren Verstand gegeben, daß sie die Unmöglichkeit einsehen, den Weg wieder zurückzugehen, den sie gekommen sind, denn er ist nun so stark bewacht, daß ein ganzes Heer seine Zugänge nicht erzwingen könnte. Meine Söhne werden jedoch schauen, wie herrlich unser Reich hier oben ist, sie werden sein Glück und seinen Frieden genießen und nicht mehr zurückbegehren in die Täler des Elends, der Leidenschaften und des Blutvergießens, und ihr greiser Vater wird ihnen das Geheimnis des Lebens und das Geheimnis des Glücks offenbaren.«
Als der Greis sie hierauf verließ, sagte Friedrich: »Der Alte befindet sich in einem Irrtum; er meint nicht anders, als es sei uns gelungen, durch sein unterirdisches Schloß auf dem einzigen Wege, den er kennt, einzudringen. Ob er nun glaubt, ich habe mich hinausgeschlichen und euch geholt oder ihr habet gleich mir den Zugang genügend gekannt, um zu mir zu gelangen und dann mit mir emporzusteigen, das weiß ich nicht; jedenfalls denkt er so wenig an eine andere Möglichkeit, daß er es nicht einmal der Mühe wert findet, uns zu befragen. Wie sollte er auch ahnen, daß zwei so merkwürdige Zufälle durch die verlassenen Bergwerke, einen Weg gebahnt haben, die er selber nie besucht hat, und deren einzigen Zugang er zu kennen glaubt, nämlich den, der von seinem unterirdischen Palast aus durch die Hallen führt, die er mir zur Wohnung anwies?«
»Wir dürfen ihn ja nicht über seinen Irrtum aufklären,« sagte Ulrich, »sonst berauben wir uns jeder Möglichkeit, wieder von hier zu entkommen.«
»Aber wir wollen doch nicht so gleich wieder fort?« schaltete Schulze etwas besorgt ein. »Dieses Land scheint mir wie kein anderes wert, durchforscht zu werden; wir könnten da Dinge zu sehen bekommen, die wir nie mehr im Leben schauen werden.«
»Sie haben recht,« erwiderte Ulrich. »Aber vor allem handelt es sich auch darum, unsere Flucht so lange hinauszuschieben, bis wir vor jeder Überraschung sicher sind. Bleiben wir einige Wochen in aller Ruhe da, so wird man uns nicht mehr besonders beachten, man wird meinen, wir haben uns in unser Schicksal ergeben, wir wollten gar nicht mehr fort. Wir werden ohne Aufsicht im Lande umherstreifen können, da man ein Entweichen für ausgeschlossen hält; und wenn sie einmal gewohnt sind, daß wir oft mehrere Tage auf unsern Ausflügen fortbleiben, so wird unsere Flucht, wenn wir sie einmal bewerkstelligen, lange Zeit gar nicht bemerkt werden, und so sind wir vor einer wirksamen Verfolgung sicher.«
Dies wurde allgemein anerkannt, und alle, Unkas mit eingeschlossen, gelobten, strengstes Stillschweigen über ihr kostbares Geheimnis zu bewahren.
In den ersten Tagen ihrer Anwesenheit in Manoa leistete ihnen der alte Inka häufig Gesellschaft und erzählte ihnen auf ihre Fragen hin gar manches aus alter Zeit. Wie lebte er auf, wenn er vom Glanze des Inkareiches berichtete, wie verfinsterten sich seine schmerzlich bewegten Züge, wenn er auf die spanische Eroberung und die Grausamkeit und Zerstörungswut der Konquistadoren zu sprechen kam.
»Man sagt,« hub Friedrich eines Tages an, »die Völker von Peru seien ursprünglich wild und barbarisch gewesen, und erst die Ankunft der Inka habe Gesittung, Kultur und Glück dem Lande gebracht. Woher kamen denn diese Inka?«
»Mein Sohn fragt Großes,« sagte der Alte. »Wer weiß die Ereignisse vergangener Tage? Es wird viel davon erzählt, doch nicht immer stimmen die Kunden überein, und manches bleibt dunkel.
»Nachdem das große Wasser alle Lande bedeckt hatte und sich wieder verlief, bevölkerten sich die verödeten Länder von neuem, und Ophir, der Urenkel des Mannes, den ihr Noah nennt, zog ein in Tahuantinsuju, und seine Nachkommen lebten daselbst wohl ein halbes Jahrtausend in Glück und Frieden und großer Einigkeit, den Weltenschöpfer anbetend.
»Sechshundert Jahre nach der Flut aber brachen fremde Völker ein und verheerten das Land, das bald von einem wilden ungesitteten Menschenschlage bewohnt war. Daß dies früher anders gewesen war, beweisen die vielen wunderbaren Überreste aus einer Zeit, lange ehe die Inka hierherkamen. Wer die Ruinen von Tiahuanako gesehen hat, wird es erkennen; dort findet man viele kunstvolle Steinbilder, gewaltige Mauern, große Tore, dreißig Fuß breit, fünfzehn Fuß tief und sechs Fuß hoch, aus einem einzigen Blocke gehauen, daneben zahlreiche Höhlen und Grotten — unterirdische Wohnungen. Kein Mensch weiß, mit welchen Kräften diese Steine in eine Gegend gebracht wurden, in der weit und breit weder Felsen noch Steinbrüche zu finden sind. Aber das Geschlecht, das diese Wunderbauten schuf, war verschwunden, und Elend und Blutvergießen bedrückten die unglücklichen Nachkommen eines glücklichen Volkes.
»Da hatte der Sonnengott Mitleiden mit diesen blinden Menschenkindern und sandte ihnen seine eigenen Söhne, um sie zu beglücken. Nach Mexiko kam der milde Gott Quezalcoatl selber in einer Riesenmuschel gefahren, nach Tahuantinsuyu aber, das ihr Peru nennt, kam Intiptschurin, der Sohn der Sonne, mit den Seinigen. Einige sagen, diese Sonnenkinder seien von der glücklichen Insel Atlantis gekommen, um Licht zu bringen in die Finsternis der Völker.
»Die Eingeborenen aber erkannten sie als Göttersöhne und unterwarfen sich ihnen. Und die Sonnenkinder gründeten die Königsstadt Kuzko. Dort herrschten die großen Könige Manko Kapak, Tupak Kapak, Inti Kapak Pirua Amaru, Kapak Sayhua Kapak, Kapak Tinia Jupanki, Ayar Tacko, der Besieger der Riesen, Huaskar Titu, Kispi Titu, Titu Jupanki Patschakutek, Titu Kapak, Paullu Tikak Pirua, Lloke Tesag Amanta, Cayo Manko Amauta und achtzig weitere Könige, die ihr Volk beglückten und das Reich an Glanz und Umfang mehrten.
»Auf diese Könige folgten die großen Inka, von deren Regierung und Heldentaten viel zu erzählen wäre. Wenn es euch lüstet, Wunder zu vernehmen, so mangelt es uns ja nicht an Zeit; wir werden noch manchen Tag finden, da ich euch alte Geschichten berichten kann. Der letzte Inka, der vor der Ankunft der Spanier starb, Huayna Kapak, war ein so gewaltiger Held und von seinem Volke so geliebt, daß die Weißen niemals das Land gewonnen hätten, wäre er noch am Leben gewesen.
»Doch lasset euch erzählen von dem Glanz und dem Glücke des Inkareiches.«
ALLE Völker, die dem Reiche der Inka unterworfen waren, mußten bekleidet gehen, und je nach Rang und Reichtum gingen die Leute in kostbarem Schmuck; die strenge Aufsicht, die sich bis in die Häuser hinein erstreckte, verbannte aus diesen Schmutz und Liederlichkeit, aber auch Üppigkeit: zweimal täglich fanden die einfachen Mahlzeiten statt. Dafür herrschten auch so sichere Zustände im Lande, daß keine Türe verschlossen wurde.
»Die Untertanen gehorchten freudig und willig dem Inka als dem Sonnensohne, denn sie wußten, daß er nur ihr Bestes suchte. Der Kaiser hielt sich in strengster Gerechtigkeit an die unumstößlichen Gesetze. Und die Gesetze waren so vollkommen, daß auch die Spanier voller Bewunderung waren für ein Staatswesen, dem sich nichts Ähnliches in ihrer Heimat an die Seite stellen ließ. Unübertrefflich war die Ordnung, die Weisheit der Regierung und der Gehorsam des glücklichen Volkes. Hunderte und Tausende an den entferntesten Grenzen des Reiches führten die Befehle des Inkas, die rasch an sie gelangten, mit einer Genauigkeit aus, als handelten sie nach Geboten der unabänderlichen Notwendigkeit.
»Dieses Reich hatte Verbrüderungsgesetze, nach denen alle einander beistehen mußten, ja, füreinander arbeiteten. Es hatte Wohlfahrtseinrichtungen und öffentliche Vorratshäuser, daraus empfingen Greise, Sieche und Schwache, Fremde, Pilger und Reisende Nahrung und Kleidung, wie sie's bedurften, und bei Mißernten und in Kriegszeiten konnte kein Mangel eintreten; eine Hungersnot kam nie vor; überall herrschte Wohlstand, ja, Überfluß.
»Die Hausgesetze verboten den Müßiggang und regelten die Arbeit; öffentliche Arbeiten wurden gemeinsam und unentgeltlich ausgeführt; am Feld- und Gartenbau nahm jeder teil, vom Herrscher bis zum geringsten Untertan. Durch Feldgesetze wurde der Grundbesitz aufs genaueste verteilt, nachdem durch Feldmesser alles abgemessen worden war.
»Diebstahl und Habsucht waren unbekannt, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit selbstverständlich, Mäßigkeit strenges Gesetz. Mord oder Unsittlichkeit wurde mit dem Tode bestraft. Den jungen Ehepaaren mußte die Gemeinde ein Haus bauen; für die Witwen mußte sie sorgen bis zu ihrer Wiederverheiratung. Eine Frau sah man nie ohne Beschäftigung, auch während der Unterhaltung und auf Besuch spann sie oder strickte oder betrieb sonst eine Handarbeit.
»Auf Anstand und gute Sitte wurde streng gehalten; nie hätte man ein Weib tanzen sehen, und der Tanz der Männer war ernst und würdevoll, kein ausgelassenes oder widerliches Umherhüpfen und Gedrehe.
»Die Inka und alle Mitglieder des Kaiserhauses legten ihre Ehre darein, durch fleckenlosen Wandel dem Volke voranzuleuchten.
»Und ein ausgezeichneter Post- und Nachrichtendienst war eingeführt, alle sechstausend Schritte standen Posthäuser; dort harrten die Schnelläufer der Botschaften oder Briefe, die ihnen von einem Posten überbracht wurden, um sie mit Windeseile dem nächsten Amte zu übermitteln. Unverbrüchlich wahrten sie die Amtsgeheimnisse. Feindliche Einfälle und dergleichen wurden von diesen Stationen aus in kürzester Frist durch Feuerzeichen dem ganzen Reiche bekanntgegeben.
»Das Wild, das die Weißen später ausgerottet haben, war durch Jagdgesetze geschützt: nur alle vier Jahre durfte in der gleichen Gegend gejagt werden. Die Vögel, die den Dung lieferten, waren gesetzlich geschont. Steinwälle umgaben jedes Feld, und mächtige Terrassenmauern ermöglichten es, selbst die steilsten Abhänge anzubauen; dem Meere sogar wurde Ackerland abgerungen und mit hohen Mauern aus Luftziegeln eingedämmt: das alles ist nun wieder zur Wildnis geworden!
»Der Inka begann eigenhändig die Bestellung der Felder, die Aussaat und die Ernte; zuerst wurden die Äcker der Armen bebaut und abgeerntet, dann kamen die der Vornehmen und zu allerletzt die der Inka, weil das Wohl der Untertanen dem Herzen des Herrschers näher lag als sein eigenes.
»Singend wurde alle Arbeit getan als ein Werk der Freude und nicht als eine Last, und keiner arbeitete für sich allein — alle halfen einander; wie das alle Mühe erleichterte und erheiterte, wie das den Wetteifer anspornte! Nur dem Faulen bot keiner hilfreiche Hand, damit er gezwungen sei, zu arbeiten, um nicht Hunger zu leiden.
»Um den Feldern Wasser zuzuführen, wurden gewaltige Wasserleitungen angelegt; an unersteiglichen Felswänden führte man die Kanäle entlang, Berge wurden durchbohrt, Täler überbrückt, Sümpfe ausgetrocknet — und alle diese Werke haben unsere Väter vollbracht, da sie geschmiedetes Eisen doch nicht kannten!
»Persönlich überwachte der Inka diese wichtigen Arbeiten, und immer wieder kam er, ihren Fortschritt zu sehen und die Arbeiter zu ermuntern.
»Hoch oben in den Bergen wurden die Lama und Alpaka in Herden zu Tausenden und aber Tausenden gezüchtet.
»Alle Handwerke standen in unserem glücklichen Lande in höchster Blüte, nach Neigung und Anlagen wurde den Kindern der Beruf bestimmt; die Weber verwoben die Wolle der Lama und das Seidenhaar der Fledermäuse zu den feinsten Stoffen, die Teppichweber stellten Matten, Decken und Teppiche mit kunstvollen Mustern her, die Töpfer, Polierer, Steinmetzen, Gold- und Silberarbeiter waren an Geschicklichkeit und Kunst der Entwürfe den höchsten Schwierigkeiten gewachsen, und ihre Werke zeichneten sich teils durch entzückende Zierlichkeit, teils durch erstaunliche Großartigkeit aus.
»Gold und Silber häuften sich in den Tempeln und in den Königstädten an, und die Spanier glaubten in Kuzko die Goldstadt Manoa gefunden zu haben, obgleich die Schätze, die sie fanden und für unermeßlich hielten, nur noch ein spärlicher Rest waren und für 1200 Millionen Gold, Silber und Edelsteine schon hierhergebracht und im heiligen See versenkt worden waren.
»Die Edelsteine schnitten unsere Künstler mit einer Feinheit, als seien die Steine weiches Wachs, und schon in Tumpez waren die Weißen geblendet von der Pracht der goldenen und silbernen Menschen- und Tierbilder. Da staunten sie in den Gärten des kaiserlichen Palastes mitten unter den Gewächsen der Natur Bäume und Gesträuche aus jenen Sonnen- und Mondglanzmetallen an, die bis auf das feinste Blattgefieder künstlich nachgebildet waren. In den Sälen des Schlosses standen aus lauterem Edelmetall und bunten Edelsteinen gefertigte Männer, Frauen und Kinder, Tiere und Vögel; aus den goldenen Fußböden wuchsen gleichsam erzene Kräuter und Blumen, aus den goldenen Wänden Zweige und Pflanzen aller Art, auf denen sich künstliche Schmetterlinge und Kolibri wiegten; Schnecken und Eidechsen, Käfer und schillernde Schlangen schienen umherzukriechen, und jedes dieser Stücke war einzeln angefertigt, daß man es loslösen und genau betrachten konnte; ja, da schien alles zu blühen und zu leben, zu flattern und zu kriechen, zu zwitschern und zu singen — und doch, was war das gegen die Wunder der Kaiserpaläste von Kuzko oder Quito? Dort thronte der Sohn der Sonne in Pracht und Herrlichkeit, und auch seine geringsten Geräte waren aus Silber und Gold, mit Edelsteinen geziert. Aber nichts ist mehr vorhanden von all dieser Kunst: die Eroberer schmelzten es ein und prägten Münzen daraus!«
»Erhabener Inka,« bemerkte Friedrich, des Greises begeisterte Schilderung unterbrechend, »findet sich diese herrliche Kunst nicht wieder in deinem unterirdischen Palaste und hier in Manoa?«
»Ach!« erwiderte der Alte, wehmütig lächelnd. »Es finden sich hier nur noch Überreste oder schwache Abbilder der einstigen Herrlichkeiten; doch das war ja auch nur Tand, das Auge zu ergötzen. Größer dünkt mich die Kunst der Baumeister, die gewaltige Steine aufeinander türmten, Steine, die so genau behauen waren, daß man die Fugen zwischen ihnen nicht sehen kann und nur, weil die Kanten der Blöcke zur Zierde schräg abgeschnitten sind, zu erraten vermag, wo sich die Stelle befindet, an der sich zwei Steine scheiden.
»Und erst die gewaltigen Straßenbauten, diese breiten gepflasterten Wege, die, mit Seitenmauern versehen, auf hohen Dämmen die Ebenen durchzogen und im Gebirge, in den Felsen gehauen, mit breiten Stufen die steilsten Wände erklommen, die durch den Schnee der Hochgipfel und durch die Urwälder führten, Hunderte von Tagereisen weit! Sie hatten ihre Meilenzeiger, ihre Paläste und Herbergen, Schutz Hütten und Vorratshäuser und wurden so rein gehalten, daß kein Steinchen noch Grashalm auf ihnen gefunden werden konnte. Solche Straßen durchzogen in Menge das ganze Reich — nun aber sind sie zerstört und zerfallen!
»Wir besahen erhabene Karten des Landes, aus Ton gebildet, Stadtpläne — so genau, daß jedes Haus, jede Straßenbreite, jeder Flußlauf daraus ersichtlich waren und die Weißen sich nicht genug über solche Kunstwerke verwundern konnten.
»In die Kippu-Kamayoke, die farbigen Schnurbündel, konnten wir mittels einfacher Knoten Rechnungen, Geschichten, Gedichte, Gesetze und Verordnungen eintragen wie in Handschriften, und nur durch peinlichste Rechnungsführung mit Hilfe dieser Schnüre vermochten unsere Beamten lange Zeit den Untergang aufzuhalten, den die blutsaugerischen Erpressungen der Spanier sonst alsbald über einzelne Provinzen gebracht hätten; so aber rechneten sie miteinander ab und verteilten die Last des Schadens auf die Einwohner des ganzen Reiches.
»Wir waren bewandert in der Sternkunde und in der Heilkunde, wir hatten Maler, Dichter, Musiker und Schauspieler.
»Die Inka liebten den Frieden und suchten ihn zum Heile des Volkes zu erhalten; aber sie hatten auch ein Heerwesen, dem kein feindliches Volk auf die Dauer zu widerstehen vermochte. Überall waren die mächtigsten Festungen angelegt, in die sich das Heer, wenn es je eine Niederlage erlitt, werfen konnte. Kranke und Verwundete schickte man sofort nach der Heimat und zog Ersatz für sie heran. Die Inka hielten auf strengste Mannszucht. Plünderung wurde unnachsichtlich mit dem Tode bestraft, sowohl beim gemeinen Soldaten als beim höheren Offizier. Niemals wurde es unterlassen, dem Gegner zu dreien Malen Frieden anzubieten, ehe man zum Angriff überging; wo es nur möglich war, wurde Blutvergießen vermieden. Nach dem Sieg gab man die Gefangenen frei und erstattete ihnen all ihr Eigentum zurück, für das eroberte Land wurde väterlich gesorgt, und durch Güte und Milde gewann man in kürzester Frist die früheren Gegner zu treuen Landeskindern, die bald einsahen, wie viel besser sie es unter der neuen Herrschaft hatten, unter der sie ihre barbarischen Sitten ablegen mußten. Zuweilen wurden freilich die Besiegten im Innern des Reiches angesiedelt und das eroberte Gebiet zur Sicherung der Grenzen mit treuen, zuverlässigen Bewohnern der alten Provinzen besetzt.
»Auch unsern Glauben nahmen die Besiegten stets bald an. Wir glauben an einen unsichtbaren Gott von Ewigkeit, Illja Tekze; seine Namen sind Huirakotscha, Patschayatschik und Patschakamak, doch nur der Inka darf seine Namen nennen, darum nennt ihn das Volk Cachimana wie den guten Geist der Omagua. Weil er der Unsichtbare ist, hatte er keinen Tempel, nur erst spät wurde ihm ein Heiligtum im Tale von Irma errichtet.
»Sein Sohn Inti, der Sonnengott, hatte goldene Tempel, und sein Diener ist Illjapa, der Donnergott; seine Gemahlin und Schwester Kilja oder Copa ist die Mondgöttin, die Himmelskönigin, ihr dienen die Sternenjungfrauen.
»Der Feind aller Menschen aber, bei euch Satan genannt, ist Cupay, den das Volk hier auch, wie die Omagua, Jolokiamo heißt.
»Hier leben wir in der mittleren Welt, Hurin Patscha; die Seele aber ist unsterblich und kommt, wenn sie gut war, nach dem Tode zur ewigen, seligen Ruhe in die obere Welt, das Reich des Friedens, Hanan Patscha. Später wird dann auch ihr Leib auferstehen, um mit ihr vereinigt zu werden. Die Gottlosen aber kommen in die qualvolle Wohnung des bösen Geistes, nach Uku Patscha oder Cupappahuacin.
»Aber wenige fürchteten den Bösen, denn das Volk war gut, und weil es so gut war, war es glücklich, fröhlich in seiner Arbeit, jubelnd bei seinen Festen mit ihrem Schaugepränge, Musik und Schauspielen. Ja! es war eine goldene Zeit, und heute noch sehnen sich unsere roten Brüder dort unten zurück nach der segensreichen Herrschaft der Inka und halten fest an der Sprache, die im ganzen Reiche gesprochen werden muhte, der Kitschuasprache, der vollkommensten und wohllautendsten aller Sprachen, die auch wir hier oben reden.
»Aber dieses Volk, dem Rachgier und Grausamkeit fremd waren, das stets nachgiebig war und bereit zu verzeihen, friedfertig und liebenswürdig, mitleidig und barmherzig gegen alle Notleidenden, geneigt auch den unverschämtesten Forderungen sich willfährig zu zeigen, ehrerbietig gegen alle, die es für vornehmer oder gelehrter hielt, gehorsam, demütig und lernbegierig, treu und dankbar in allen Dingen, versöhnlich, gutmütig und sanftmütig, fleißig und genügsam, zufrieden und voller Geduld — dieses glückliche, hochherzige Volk sollte Cupays ganze Bosheit schmecken lernen!«
»WIE ist es nur möglich,« fragte Ulrich den Greis, der, in trübe Erinnerungen versunken, schwieg, »daß ein mächtiges und so wohl geordnetes Reich mit Hunderttausenden der tapfersten Einwohner von einer Handvoll Abenteurer, wie sie Franz Pizarro befehligte, erobert werden konnte?«
»Wenn ein Verhängnis kommen soll, so ist wohl alles möglich, und wenn die Erde bebt und die Häuser zerstört, wenn der Cotopaxi seine Schlammströme über blühende Städte ergießt, daß die Menschen darin ersticken, so kommen hernach die weißen Gelehrten und streiten darüber, wieso das möglich sei.«
»Jawohl,« unterbrach Schulze. »Das ist eine interessante Frage, und namentlich die mächtigen Schlammfluten des Cotopaxi sind so gut wie gar nicht aufgeklärt; die einen denken an Wasseransammlungen im Innern des gewaltigen Vulkans, während andere glauben, es handle sich um das Schmelzen der Eis- und Schneemassen des vergletscherten Gipfels, wenn die glühenden Lavaströme aus den Flanken des merkwürdigen Berges brechen.«
»Seht!« fuhr der Inka fort. »So sind meine weißen Brüder; aber der Unglücklichen, die von den brodelnden Wogen verschlungen werden, denken sie kaum. Ich sage euch aber, diese selber fragen sich nicht: ›Wie ist das nur möglich?‹ sondern das Unheil ist da, und das ist ihnen mehr als genug; was könnte es ihnen nützen, wenn sie auch genau wüßten, wodurch es entstand? Doch eine Antwort auf eure Frage zu geben, kann ich drei Punkte nennen: erstens hatten die Spanier Rüstungen von blankem Eisen, an denen die meisten Pfeile der Unsrigen abprallten, sie besaßen Pferde und Feuerrohre, und das alles flößte den harmlosen Einwohnern des Landes eine ehrfürchtige Scheu ein, so daß sie in den Ankömmlingen übermenschliche Wesen zu sehen glaubten) zweitens traten die Eroberer zunächst als Freunde und Gottesboten auf, bis sie uns sicher machten; drittens herrschte gerade ein unseliger Zwist im Reiche der Inka, den die Spanier hinterlistig auszunützen verstanden.
»Dieser Zwist war die Folge einer Schuld, und noch größere Schuld folgte ihm. Ja, nicht unverschuldet sollte das Unglück über die Inka hereinbrechen; das Volk aber mußte schuldlos mit seinen Herrschern leiden!
»Inti Kussi Hualpa, der als Kaiser über das große Inkareich Tahuantinsuyu den Namen ›tugendreicher schöner Jüngling‹ oder Huayna Kapak erhielt, war der größte unter den Inkaherrschern; er eroberte das mächtige und herrliche Königreich Puitu, von den Spaniern Quito, später Nueva Grenada und jetzt Ecuador geheißen. Da nahm er zur Befestigung seiner neuen Herrschaft die Tochter des verstorbenen Königs von Puitu, die schöne Prinzessin Tuta Pallja, zur rechtmäßigen vierten Gemahlin. Es war ein Frevel gegen die Familiengesetze, daß er sie zur Coya, das heißt gesetzmäßigen Kaiserin, erhob; denn das sollten nur Mitglieder der Inkafamilie werden, sie aber gehörte dem Stamme Quillaco an und war keine Sonnentochter. Die neue Gattin schenkte ihm einen Sohn Hualpa Titu Yupanki, der sich später Atahualpa nannte. Diesem vererbte Huayna Kapak der Große das Königreich Puitu, während dem rechtmäßigen Kronprinzen Huaskar das Reich Tahuantinsuyu verblieb.
»Noch vor dem Tode des großen Huayna Kapak sah man gepanzerte Fremde von weißer Haut an den Küsten des Reiches vorbeifahren. Da erinnerte sich der Inka alsbald der Prophezeiung seines großen Ahnen Huirakotscha, der geweissagt hatte, einst würden fremde Eroberer das Inkareich zertrümmern. Huayna Kopak aber befahl, wenn die Fremden erschienen, solle man sie gastlich aufnehmen und ihnen freundlich entgegenkommen, denn dies sei der Wille seines Vaters, des Sonnengottes, der ihm im Traume erschienen sei. Dann verschied er.
»Atahualpa begehrte in seinem Ehrgeiz das ganze Erbe seines Vaters; unversehens ließ er sein Heer gegen Kuzko anrücken und besiegte bei Ambato seinen Bruder Huaskar, der nur in der Eile ungeübte Mannschaften zusammenraffen konnte; ihn selber nahm er gefangen; mehr als sechstausend Leichen bedeckten das Schlachtfeld.
»Dann beschick Atahualpa sämtliche Mitglieder der Inkafamilie nach Kuzko, angeblich, um mit ihnen zu beraten, wie das Reich zwischen ihm und Huaskar zu teilen sei. Die Inka erschienen gehorsam, mehrere Tausende an der Zahl; Atahualpa aber ließ sie sämtlich gefangennehmen und hinrichten — von Felsen stürzen, ertränken, enthaupten oder aufhängen. Kaum dreißig entrannen dem gräßlichen Blutbade und versteckten sich in den Schluchten des Gebirges Antafuyu. Dann wurde auch nach den Frauen und Kindern gefahndet, sowie nach den vornehmen Anhängern Huaskars, und alle, die Atahualpas Häschern in die Hände fielen, wurden vor Huaskars Augen grausam hingemordet; ja, seine eigenen Kinder und Gemahlinnen mußte er so hinrichten sehen: das war die blutige Schuld Atahualpas. Und eben um diese Zeit kam Francisco Pizarro mit den Spaniern ins Land.
»Nur 177 Mann hatte der kühne Häuptling bei sich, mit denen er sich in das nach Zehntausenden zählende Heer Atahualpas begab, obgleich er wußte, daß der Inka bei der Vorzüglichkeit seines Nachrichtendienstes Kunde haben mußte von den entsetzlichen Grausamkeiten, die die Weißen schon an seinen Landeskindern verübt hatten. Den Leuten, die an Huaskar hingen, spiegelte der schlaue Abenteurer vor, er ziehe diesem rechtmäßigen Kaiser zu Hilfe.
»Auf einer Inkastraße, deren prächtige und vorzügliche Anlage weit alles übertraf, was die Weißen in ihrer Heimat selber besahen, zogen sie durch fruchtbare Täler, durch erstaunliche Urwälder, deren prächtige Blütendolden die Helme der Reiter streiften, und siehe da! die Tambo, die Vorratshäuser, die alle fünf Wegestunden die Straße säumten, öffneten sich den Fremdlingen auf Befehl des Inkas.
»Obgleich überall freundlich ausgenommen und im Namen des Inkas willkommen geheißen, ließ doch Pizarro mehrere Eingeborene gräßlich foltern, um von ihnen Auskunft über die Stärke des Inkaheeres und Atahualpas Gesinnungen gegen die Spanier zu erpressen. Er erfuhr, daß der Kaiser fünfzigtausend Krieger bei sich habe und die Weißen erwarte, um sie zu vernichten.
»Doch Pizarro, der überall erklärt hatte, er eile als Bote des mächtigsten Kaisers, Karls V., in das Kriegslager Atahualpas, wollte keine Feigheit zeigen: er erklomm die steilen Felswände des Antafuyu, woselbst wenige Indianer ihn mit seiner ganzen Truppe hätten vernichten können. Auf den eisigen Höhen, auf denen mehrere der leichtbekleideten Indianer, die Pizarro mitgenommen hatte, erfroren, kamen den Spaniern Boten Atahualpas aus Caxamarca entgegen und hießen sie im Namen ihres Herrn willkommen. Pizarro prahlte mit der Macht seines Kaisers und den Siegen seiner eigenen geringen Truppe, die schon mächtigere Herrscher als Huaskar oder Atahualpa vernichtet habe, versicherte aber, mit friedlichen Absichten zu kommen und nur, wenn er angegriffen werde, sich als Feind zu zeigen.
»Als die Spanier das Gebirge Antafuyu hinabstiegen, kamen sie in das blühende Tal von Caxamarca und staunten über die prächtige Stadt, die grünumzäunten Gärten, noch mehr aber über das gewaltige Zeltlager Atahualpas; sie erschraken ins Herz hinein vor der Macht des Inkas und der Menge seiner Zelte; doch ließen sie sich nichts merken, denn zur Umkehr war es zu spät. Darum ritten sie mit keckem Mute in die Stadt, die völlig menschenleer war, von ihren zehntausend Einwohnern verlassen.
»Die Stadt mit ihren breiten gepflasterten Straßen, mit ihren großen Palästen, die aus einem einzelnen Saale bestanden, mit ihren aus Stein oder Luftziegeln erbauten Häusern, die mit rotem und weißem Stuck verziert waren, überraschte die Weißen mehr als alles, was sie bisher geschaut hatten. Überall herrschte die größte Reinlichkeit.
»Pizarro schickte nun eine Gesandtschaft in Atahualpas Lager und verbrachte seine zwei Geschütze auf die mächtige verlassene Festung, die die Stadt und die Umgegend beherrschte.
»Die Gesandten Pizarros bewunderten die Ordnung und Bewaffnung des Heeres, besonders aber das Gold und Silber, das ihnen von den Streitkolben, Äxten und Speeren der Indianer entgegenblitzte. Diese hinwieder sahen mit Grauen die Panzerreiter und die gepanzerten Schlachtrosse nahen; doch rührten sie keine Hand, wie Atahualpa geboten hatte.
»Der Inka empfing die Boten kalt und hielt ihnen vor, welche Unmenschlichkeiten sie an seinen Untertanen und Häuptlingen begangen hätten; dagegen habe ihm einer seiner Beamten gemeldet, es sei ihm gelungen, drei Christen und ein Pferd zu töten.
»Hernando Pizarro, Franciscos Bruder, erwiderte, dies sei eine Lüge, denn kein Indianer vermöge einen Christen zu töten, und zehn spanische Reiter vermöchten ein ganzes Indianerheer zu vernichten. Atahualpa versprach, am andern Tage Pizarro zu besuchen.
»Wie die Gesandten dem Spanier von der Stärke, Bewaffnung und Mannszucht des Indianerheeres berichteten und sorgenvoll meinten, es sei keine Rettung mehr für sie möglich, da mehr als zweihundert Indianer auf einen Spanier kämen, beschloß der tollkühne Pizarro, sich der Person des Inkas zu bemächtigen.
»Als daher am andern Tage Atahualpa seine Ankunft mit großem Gefolge meldete und verlangte, es solle ihm in einem durch eine steinerne Schlange kenntlichen Hause würdige Unterkunft bereitet werden, legte Pizarro einen dreifachen Hinterhalt und ließ Atahualpa ankündigen, er werde ihn als Freund und Bruder empfangen.
»Atahualpa erschien mit mehreren Tausenden der Vornehmsten seines Reiches und fünftausend unbewaffneten Kriegern in der Stadt. Vor ihn trat der Bischof Vicente de Balverde und erklärte ihm die christliche Religion von der Schöpfungsgeschichte an, den Inka auffordernd, sich zu bekehren. Auch berichtete er, daß der Papst, als Statthalter Christi auf Erden, die Welt unter die christlichen Könige verteilt habe, wobei das Reich Tahuantinsuyu dem mächtigsten Herrscher der Welt, Kaiser Karl, dem Könige von Spanien, zugefallen sei. Wenn sich nun Atahualpa friedlich unterwerfe, so werde man ihn auf dem Throne belassen, wo nicht, so werde sein Thron gestürzt, seine Tempel und Götzen aber sollten zerstört werden.
»Atahualpa erwiderte heftig, nachdem er die lange Rede stillschweigend angehört hatte, er selber sei der mächtigste Kaiser der Welt, wolle gern mit Kaiser Karl ein Freundschaftsbündnis schließen, von seinem Glauben aber wolle er nicht lassen und vom Papst, der fremde Reiche verschenke, nichts wissen. Dann fragte er den Mönch, woher er denn alles wisse von Gott und Christus. Dieser reichte ihm eine Bibel und sagte: »Hier steht's«. Der Inka durchblätterte das Buch und erwiderte: »Mir sagt es nichts!« womit er es zu Boden warf.
»Da rief der Mönch zur Rache, weil das heilige Buch geschändet sei; Pizarro erschien, und unter Trompetengeschmetter, Gewehrsalven und Kanonenschüssen brachen die Spanier durch die Menge, die wehrlosen Menschen zusammenhauend, unter den Hufen der Rosse zerstampfend und mit den Musketen erschießend. Keiner der Indianer hob auch nur den Arm zur Abwehr, denn der Inka hatte vor seinem Einzug befohlen, sich auch im Falle eines Angriffes nicht zu verteidigen. Eine große Anzahl entkam durch die Flucht, da eine der den Platz einschließenden Ziegelmauern, dem Gedränge nachgebend, einstürzte und so einen Ausweg eröffnete.
»Schwer war es, zum goldenen Thronsessel des Kaisers zu gelangen; denn stets bildeten wieder seine Getreuen mit ihren Leibern einen Schutzwall um ihn. Endlich konnte er ergriffen werden, wobei ihm die rohen Soldaten allen Schmuck vom Leibe rissen. Nach einer halben Stunde bedeckten über zweitausend Leichen und fünftausend Verwundete den Mordplan, darunter vor allem die Verwandten des Inkas und die Vornehmsten seiner Umgebung. Von den Christen war nur Pizarro durch einen auf Atahualpa einschlagenden Spanier an der Hand leicht verwundet worden.
»Das Heer des Inkas floh alsbald nach Puiru; Atahualpa aber zeigte sich gelassen und freundlich gegen die grausamen Sieger. Lama und Frauen wurden zu Tausenden von den Spaniern nach Caxamarca getrieben. Die Gefangenen wurden teils zu Sklaven gemacht, teils in Freiheit gesetzt. Reiche Goldbeute im Werte von Millionen wurde gemacht; doch versicherte der Inka, dies sei nur ein geringer Teil der Schätze, die er mit sich geführt habe.
»Da der Inka sah, daß es den Spaniern mehr um Gold als um sein Seelenheil zu tun war, versprach er, einen sechseinhalb Meter langen und fünf Meter breiten Saal bis zu einer Höhe von fast drei Metern mit Goldgefäßen füllen zu lassen, falls man ihn freilasse; doch sollten die Spanier die Gefäße nicht zerschlagen; einen zweiten Saal werde er bis zur Decke mit Silber anfüllen. Pizarro versprach ihm alsbald die Freiheit gegen solches Lösegeld.
»Der gefangene Huaskar verstand es, sich mit Pizarro in Verbindung zu setzen, und versprach ihm noch größere Schätze, wenn er ihm wieder zu seinem Throne verhelfen wolle. Davon erfuhr Atahualpa und gab den ihn besuchenden Getreuen den Befehl, Huaskar aus der Welt zu schaffen, was denn auch unverzüglich geschah.
»Gegen ihr Versprechen schmelzten die Spanier all die kostbaren Geräte, Statuen und Tierbilder ein, und täglich gewannen sie etwa eine Million an Goldwert. Als das versprochene Lösegeld Atahualpas durch Tausende von Indianern mühevoll herbeigeschleppt war, ließ Pizarro den Inka unter den nichtigsten Vorwänden erdrosseln. Die Schwestern, Frauen und Dienerinnen des unglücklichen Kaisers aber gaben sich selbst den Tod.
»Die Mörder des Inkas sind später keines natürlichen Todes gestorben; das Volk jedoch fuhr fort, den fremden Eroberern unterwürfig und freundlich entgegenzukommen, weil es sie für übermenschliche Wesen hielt und den Befehlen Huayna Kapaks folgte; aber die Sanftmut dieser Armen sollte ihnen blutig gelohnt werden: zu Tausenden erlagen sie der Goldgier der Spanier, sei es, daß sie als Sklaven unmenschliche Arbeit in den Bergwerken verrichten mußten, sei es, daß sie in grausamer Weise hingeschlachtet wurden. Nichts war den Christen heilig, sie kannten keinen lebendigen Gott, sondern nur einen metallenen.
»Da erhob sich ein überlebender Sohn Huayna Kapaks, der kriegerische Inka Manko, um die geliebten Brüder von ihren Blutsaugern zu befreien; er belagerte die Hauptstadt Kuzko, in der sich die Spanier niedergelassen hatten, verstärkt durch große Zuzüge neuer Abenteurer. Die Indianer setzten die Stadt in Brand, aber der Haukaypataplatz war so groß, daß sämtliche Christen, obgleich von einem Flammenmeer umgeben und unter der großen Hitze leidend, dort ausharren konnten, bis das Feuer keine Nahrung mehr fand.
Pizarro begab sich in die neue, von ihm gegründete Hauptstadt Ciudad de los Reyes, jetzt Lima genannt. Alle Hilfstruppen, die er nach Kuzko schickte, wurden in einem Engpaß umzingelt und mittels herabgestürzter Felsstücke meist bis auf den letzten Mann aufgerieben. Allein Hungersnot zwang den Inka Manko, den größten Teil seines Heeres zur Bestellung der Felder zu beurlauben.
»Nun brach unter den Spaniern selber aus Eifersucht und Goldgier ein Krieg aus: sie zerfleischten sich; aber auch Tausende von Eingeborenen kamen dabei ums Leben, und blühende Gefilde wurden in Einöden verwandelt. Der Inka jedoch überfiel die Spanier, wo er konnte, und brachte ihnen die größten Verluste bei; und wo eine Schlacht zwischen den Christen geschlagen wurde, stürzten sich hernach die Indianer auf das Schlachtfeld, töteten die Verwundeten und nahmen Waffen und Rüstungen weg. Auch verbrannten sie, wo es ihnen möglich war, die Wohnungen der Ansiedler, verwüsteten ihre Felder und trieben ihre Viehherden in unzugängliche Schluchten. Die Spanier aber rächten sich an schuld- und wehrlosen Eingeborenen; und als Pizarro die schöne Gattin Mankos in seine Gewalt bekam, ließ er sie zu Tode peitschen.
»Endlich legte Pizarro überall feste Plätze mit Ringmauern und Türmen an und besiedelte sie mit bewaffneten Spaniern. Dies machte die kühnen Einfälle des Inkas forthin unmöglich, und er zog sich in ein fernes Gebirgstal zurück.
»Pizarro wurde ermordet, und sein Nachfolger knüpfte mit Manko Unterhandlungen an; man sagt, ein Spanier, Gomez Perez, habe dann beim Kegelspiel im Zorne den Inka mit einer Kugel erschlagen; allein Manko war nur betäubt, obgleich die Spanier später nichts mehr von ihm erfuhren. Gomez Perez und alle seine Begleiter fielen der Wut der Indianer, die den Inka auch für tot hielten, zum Opfer. Darum hat keiner genauere Botschaft den Christen bringen können: das war vor dreihundertachtundfünfzig Jahren.«
NACH einer Pause fuhr der Greis wieder fort: »Ein Sohn Mankos, Xairi Tupak Yupanki, ließ sich von den Weißen durch friedliche Versprechungen locken, sich unter sie zu begeben; kurze Zeit darauf gaben sie ihm Gift. Auch sein Bruder Kusi Titu Kispe Yupanki wurde von einem christlichen Priester, den er freundlich aufgenommen, und von dem er sich sogar mit seiner Gemahlin hatte taufen lassen, später vergiftet.
»Der spanische Vizekönig Francisco de Toledo beschloß, um das Volk, das voller Verehrung an den Inka hing, ganz unter das spanische Joch zu bringen, die Nachkommen der Inka sämtlich auszurotten; er verbannte sie in die schlimmste Fiebergegend, wo innerhalb eines Jahres achtunddreißig starben von neununddreißig, die seinem Befehle Folge geleistet hatten.
»Noch lebte aber der jüngste Sohn des Inkas Manko, Tupak Amaru, das heißt ›die glänzende Schlange‹. Dieser entkam der Verfolgung des Vizekönigs und gelangte zu seinem Vater, der sich zu den Omagua zurückgezogen hatte. An seiner Statt wurde sein Vetter gleichen Namens, der ihm sehr ähnlich sah, von den Spaniern ergriffen und nach ungerechtem Richterspruch auf dem Haukaypataplatz in Kuzko hingerichtet. Nun glaubten die Spanier, die Inka vernichtet zu haben.
»Seht, weiße Männer! In Tahuantinsuyu lebte ein glückliches Volk sorglos und zufrieden, reich an Gütern des Erdenlebens, an Schätzen des Wissens und an allen Tugenden: die Tücke der Weißen, die freundliches Entgegenkommen mit blutiger Grausamkeit lohnten, hat sein Glück vernichtet! Wo die Eroberer durchzogen, wurden blühende Dörfer wie durch Feuerbrand verheert, fruchtreiche Gelände wurden zur Wüste, die reichen Herden fielen der Vernichtung anheim; Gesetz und Ordnung, Wohlstand und Kultur, Güter, die in Jahrhunderten angesammelt und zur höchsten Blüte gebracht worden waren, in wenig Jahren wurden sie zertrümmert! Kein größerer Eroberungszug wurde von den Spaniern unternommen, der nicht mindestens zehntausend begleitenden Indianern das Leben kostete; Dörfer, die bei der Ankunft der Spanier vierzig- bis fünfzigtausend Einwohner zählten, hatten deren nach wenigen Jahren kaum noch ein paar Hundert! Das Volk war bereit, die Fremden gastlich auszunehmen und alles willig von ihnen zu lernen und anzunehmen, was diese vor ihm voraushatten; aber die herzlosen Barbaren kamen nur, um zu zertrümmern und zu rauben: vergangen ist all das Große, Schöne und Gute und nie durch nur annähernd so Herrliches ersetzt worden; Elend und Mühsal wurden meinem Volke zuteil, das heute noch unter Seufzern und Klagen singt und sagt von der entschwundenen Herrlichkeit des großen Inkareiches.
»Die einzige Rache, die es an den Feinden nahm, war, daß es deren Goldgier betrog; die Schätze der Kaiserstadt Kuzko sind, wie zuvor die Schätze der Azteken, in den See Manoa versenkt worden; die unerschöpflichen Gold- und Silberminen wurden verschüttet und verborgen, so daß kaum die Eingeweihten sie noch zu finden vermöchten; die reichen Edelsteinlager wurden verheimlicht, und die Goldfahrer, die Manoa suchten, wurden getäuscht und irregeführt.
»Hier herauf hat sich der Rest unseres Glückes geflüchtet, wir haben das Felsengebirge auf allen Seiten unzugänglich gemacht, das sanftansteigende Tal, das früher heraufführte, vermauert, daß eine natürliche Felswand es abzusperren scheint; einen einzigen Zugang haben wir übrig gelassen im Innern der Erde, wohlverborgen und gut bewacht; und das Geheimnis dieser Stätte, wie auch die andern Geheimnisse, die ich genannt habe, werden seit Jahrhunderten gehütet in unverbrüchlichem Schweigen.
»Wären die Weißen als Freunde gekommen, sie hätten bis auf den heutigen Tag von uns Gold und Silber und Edelsteine freiwillig erhalten können, millionenmal mehr, als sie je mit Gewalt dem Lande raubten; denn uns diente es nur zu Schmuck und Augenweide, ihnen ist es ihr ein und alles; aber unsere Reichtümer kosteten uns unser Blut und unser sonniges Glück; darum haben wir sie verborgen und verschlossen vor der Gier der Christen: das war die Rache der Sonnenkinder. Aber die Zeit wird auch noch kommen, wo das weiße Elend ein Ende nimmt und das rote Glück wieder emporblüht!«
»Du sprachst davon, daß sich Manko und Tupak Amaru bei den Omagua aufhielten,« begann Friedrich mit gespannter Aufmerksamkeit, als der Greis innehielt, »was ist aus ihnen geworden?«
Der Greis richtete sich hoch auf, seine Augen blitzten und seine Wangen färbten sich mit jugendlichem Feuer, als er antwortete: »Inka Manko ist es, der zu seinen weißen Brüdern geredet hat, und der hier eintritt, ist sein tapferer Sohn, der Inka Tupak Amaru, ›die glänzende Schlange‹!«
Verwirrt blickten unsere Freunde von einem zum andern. Der junge Inka lächelte, als er ihre Verblüffung sah.
»Dreihundertundfünfzig Jahre sind verflossen seit den Tagen jener Inka ...« stammelte Ulrich.
»So ist es! Aber Manko hat das Geheimnis des Lebens und der Jugend entdeckt: er ist ein Greis von mehr als vierhundert; sein Sohn ist um wenige Jahrzehnte jünger; aber Tupak Amaru bleibt wie ein Jüngling, bis es ihm selber gefällt, alt zu werden.«
Nun erst erschienen einige frühere unverständliche Äußerungen des Alten unseren Freunden in ganz neuem Licht; aber was er sagte, war doch zu wunderbar, als daß sie ihm hätten ohne weiteres Glauben schenken können. Unkas allein schien trotz seines Staunens keinen Zweifel zu hegen; Friedrich war auch nicht abgeneigt, dem Inka zu vertrauen; Schulze aber lächelte spöttisch, und Ulrich wußte nicht, was er sagen sollte.
Manko beobachtete diese Wirkungen seiner Worte mit sichtlichem Behagen: er las den Anwesenden alle ihre Gedanken vom Antlitz. »Später,« sagte er, »sollt ihr hierüber mehr erfahren, an geeigneterem Orte; nun höret noch von unseren Plänen und Hoffnungen.
»Als ich das Geheimnis des Lebens gefunden hatte, sammelte ich um mich die Tapfersten der Omagua und siedelte sie an den Ufern des Sees Manoa an; den Tüchtigsten erhielt ich Jugend- und Lebenskraft durch Jahrhunderte, ebenso den Besten derer, die schon diese Stätten bewohnten; nach und nach zog ich auch andere der kriegerischsten und edelsten Stämme in dieses Paradies; so die Tayronen und die Reste der Aturen: hier leben alle die Stämme, von den man dort unten glaubt, sie seien vom Erdboden verschwunden. Von denen, die drunten sind, weiß nur immer der Oberhäuptling der Napo unser ganzes Geheimnis; die andern Häuptlinge wissen wenig davon, und ihre roten Krieger wisse nur so viel, daß der Inka Manko irgendwo verborgen lebt, und daß er einst mit großer Macht wiederkommen wird, den Roten das Reich zurückzuerstatten.
»Die Weißen verderben sich selber und zerrütten ihre Kraft durch Leidenschaften und Feindseligkeiten untereinander; hier oben aber sammelt sich ein stets sich mehrendes jugendstarkes Volk an, reich an Weisheit und Tugenden und unüberwindlich, sobald es sich wider die Feinde erheben wird. Ist die Zeit gekommen, so bedarf es nur eines Winkes von mir oder meinem Sohne, und alle freien Indianer werden sich zusammenscharen und die Städte und Länder der Weißen von einem Meer zum andern einnehmen. Nur soweit es nötig erscheint, werden sie Blut vergießen; denn keine grausame Rache begehren wir, sondern allein die Wiederherstellung des alten Reiches, die Zurückführung der goldenen Zeiten soll es gelten.
»Sollte der Widerstand der Weißen zu stark sein — so würden die Krieger von Manoa den roten Brüdern zu Hilfe erscheinen und dann sind die Weißen verloren; denn gegen die Vernichtungskräfte, deren Kenntnis wir haben, sind auch die Schießwaffen der Christen nichts wert.
»Und wenn die Arbeit geschehen ist, wenn Tupak Amaru das Reich seiner Väter und viele andere dazu in Besitz genommen hat, dann werden wir das Land überfluten wie ein Meer und das alte Inkareich wieder in neuer Herrlichkeit aufbauen; besser und segensreicher noch als zuvor werden seine Gesetze und Einrichtungen sein, und wer eine Zuflucht sucht vor Unfrieden und Elend, vor Sorgen und Not, vor Haß und Verfolgung, vor Krankheit und Alter, der wird hereinkommen in unser Friedensreich und wird freundliche Aufnahme finden; und Glück und Liebe, Gerechtigkeit und Menschlichkeit werden von selber alle unsere Untertanen zu treuen Gliedern des blühenden Staates machen; dann wird die Sehnsucht der roten Söhne dieses Landes erfüllt sein, dann werden die Edelsten unter den Weißen sich mit ihnen verbrüdern: das ist die Hoffnung der Sonnenkinder!«
DER Inka war zu Ende und verließ das Gemach, während sein Sohn stillschweigend verweilte.
»Das alles ist ja Mumpitz!« rief Schulze aus. »Ich wollte ja schließlich noch glauben, daß der Alte seine dreihundert Jährchen auf dem Rücken hat, meinetwegen auch vierhundert; ist doch solche Langlebigkeit als wunderbare Ausnahme zu gut bezeugt, als daß sie sich einfach leugnen ließe: Thomas Parre starb im Alter von einhundertzweiundfünfzig Jahren und wäre vielleicht noch viel älter geworden, hätte er seine einfache Lebensweise beibehalten; Joseph Surrington wurde einhundertsechzig Jahre alt, und ein Indier soll gar ein Alter von dreihundertfünfunddreißig Jahren überschritten und in dieser Zeit sich öfters verjüngt haben. So unleugbar die beiden ersten Fälle sind, so glaube ich doch nicht an den dritten; und ebensowenig kann ich glauben, daß dieser junge Mann hier mehr als drei Jahrhunderte gelebt haben soll!«
»Herr Professor, denken Sie an das Fabeltier!« mahnte Friedrich.
»So ihr meinem Vater nicht wolltet glauben,« ergriff nun Tupak Amaru das Wort, »wollt' ich euch leicht Ding' erzählen, daraus ihr solltet erkennen, daß ich Francisco Pizarro noch habe mit Augen geschaut.«
»Woher verstehst du denn Deutsch?« forschte nun Friedrich.
»Hab's gelernet von einem edlen teutschen Mann, Hutten mit Namen, so von den Hispaniern Urre genennet worden; ist aber gar lange her, doch dieweil mir sein' Sprach' gefallen, hab' ich mir die Wort' wohl gemerket dreihundert Jahr' her.«
»Ein merkwürdiger Fall,« murmelte Schulze, »da hört sich ja alle Wissenschaft auf! Und was mir besonders verdächtig erscheint,« fügte er laut hinzu, »dieser alte Inka Manko, wie er sich nennt, redet ja nur gelegentlich in der bilderreichen Sprache der Indianer; seine geschichtlichen Berichte aber verrieten ein so modernes, gebildetes Spanisch, daß er mir gar nicht wie ein echter Indianer vorkommt.«
Tupak Amaru lachte.
»Gar viel mag ein Menschenkind lernen, so die Zeit ihm nicht mangelt!«
Dies konnte der Professor nicht bestreiten. Freilich, welch umfangreiches Wissen kann sich ein gescheiter Mensch schon bei der kurzen Lebensdauer, die uns beschieden ist aneignen! Wieviel mehr, wenn er einige Jahrhunderte hindurch in ungeschwächter Geistes- und Körperkraft Wissen auf Wissen häuft!
Schulze sollte aber noch andere Wunder kennen lernen.
Der junge Inka machte sich eine Freude daraus, seinen Freunden alle Merkwürdigkeiten Manoas zu zeigen. Besonders staunten sie auch über die reichen Gold- und Silberminen und die unerschöpflichen Edelsteingruben, die in der Umgegend überall zutage traten, anscheinend aber gar nicht ausgebeutet wurden. Im Verkehr mit dem Inka, wie überhaupt mit den Roten, bedienten sich unsere Freunde der spanischen Sprache, soweit Tupak Amaru nicht selber mit seinem mittelalterlichen Deutsch begann.
»Ich hätte gedacht,« bemerkte Ulrich, »daß hier Tag und Nacht mit Bienenfleiß gearbeitet werden müsse, um die vielen Schätze zu sammeln, die du tagtäglich dem See opferst.«
Der Inka lachte. »Das bißchen Goldstaub, mit dem ich meinen Leib vor den feierlichen Abendfahrten bedecke, ist bald beschafft; aber die vielen Edelsteine wären gar nicht zu haben, so reich diese Bergwerke sind, wenn wir sie nicht selber mit leichter Mühe herstellten; in wenig Jahren wäre der Berg erschöpft, wollten wir ihm täglich ganze Körbe voll Juwelen entnehmen, Gold und Silber verstehen wir ebenfalls künstlich zu erzeugen; doch hat diese Kunst für uns wenig Wert, da hier das Edelmetall so reichlich zutage liegt!«
»Das wäre ja der Stein der Weisen,« rief Schulze aus, »und der Stein der Weisen ist ein wissenschaftliches Unding! Wie wolltet ihr auch gefunden haben, wonach bei uns das ganze Mittelalter in unwissenschaftlicher Verblendung vergebens suchte?!«
»Herr Professor, Herr Professor — das Fabeltier!« mahnte Friedrich wieder.
»Nun ja!« sagte Schulze ärgerlich. »Das Tier habe ich gesehen; aber der Stein der Weisen — nee! Alles lasse ich mir nun doch nicht aufbinden!«
»Es ist aber nach dem gegenwärtigen Stande unseres Wissens gar nicht mehr so undenkbar, was Tupak Amaru behauptet«, entgegnete Friedrich. »Das hochmütige Auslachen der Alchimisten war von der Wissenschaft sehr verfrüht und etwas kindisch. Erst neuerdings gelang es ja Professor Fittica in Marburg, Phosphor in Arsen umzuwandeln. Damit ist nachgewiesen, daß die Unwandelbarkeit der Elemente, die bisher als ein wissenschaftlicher Grundpfeiler der Chemie galt, in der Tat kein Naturgesetz ist, und es hat nichts Unglaubliches mehr, wenn einer behauptet, Wasser in Wein verwandeln zu können, eine Arbeit, die der Weinstock im Sommer stündlich leistet, wie ja jede Pflanze fortwährend, und zwar in Zeit weniger Minuten, die vom Boden aufgenommenen Stoffe in die ihr eigenen Säfte umsetzt. Sobald sich nun die Elemente als zusammengesetzt und wandelbar erweisen, ist auch die Herstellung von Gold oder Silber aus Blei und andern unedlen Metallen keine Unmöglichkeit mehr.
»Die Chemie verdankt ihren Ursprung lediglich der Alchimie. Nun hatte bald die junge Wissenschaft in überlegener, altkluger Weise nur noch Spott und Verachtung für ihre altehrwürdige Mutter übrig, wie ja das Ei oft klüger sein will als die Henne. Schön war das keinesfalls und wissenschaftlich auch nicht. Es ist der übergescheiten Tochter zu gönnen, wenn ihre Übereilung eine gründliche Beschämung für sie wird!«
Der junge Inka ließ die beiden streiten und lud sie nur ein, mit Ulrich heute abend nach seiner Doradofahrt in sein eigenes Arbeitszimmer zu kommen.
Voller Neugier und Spannung folgten die drei der Einladung.
Das Laboratorium machte den richtigen Eindruck einer Alchimistenhöhle, nur daß es wie ein Palast an den Wänden mit Gold- und Silberzieraten ausgestattet war.
In einigen Tiegeln brachte Tupak Amaru Blei, Zinn und Kupfer zum Schmelzen; dann nahm er verschiedene metallglänzende Pulver zur Hand, für jedes Metall ein besonderes, und in kürzester Frist hatte er reines Gold und Silber aus den unedlen Metallen hergestellt. Daran konnte selbst Schulze nicht mehr zweifeln, denn er hatte den augenfälligen Beweis dafür.
»Wie aber seid ihr denn nur auf diese Zauberei verfallen?« rief er, außer sich vor Staunen.
Der junge Inka erwiderte in dem ihm geläufigen Spanisch: »Wißt ihr nichts vom Wachsen des Goldes?«
»Doch,« sagte Schulze. »Es ist die merkwürdige Tatsache, daß an Orten, wo nachweislich zuvor kein Gold war, namentlich an völlig ausgebeuteten Stellen in Goldbergwerken, später Gold gefunden wird.«
»Und ihr seid dieser Erscheinung nie auf den Grund gegangen?«
»Nein! Sie ist wissenschaftlich noch nicht erklärt.«
»Ihr seid merkwürdige Leute! Suchen Jahrhunderte hindurch Gold zu machen und beobachten nicht, wie die Natur zu Werke geht. Freilich, euer Leben ist auch gar zu kurz; kaum habt ihr angefangen, etwas zu lernen, steht ihr bereits am Rande des Grabes, und eure Nachfolger müssen erst mühsam wieder den Grund ihres Wissens bei sich selber legen und werden dabei durch die Irrtümer ihrer Vorarbeiter getäuscht und behindert. Nun, wir haben beobachtet, in welcher Weise und unter welchen Bedingungen die Natur bei Erzeugung der Metalle zu Werke geht, und welche Stoffe sie dabei verwendet. Genau so lernten wir die Edelsteine herstellen; es ist gar nicht so schwierig: die Natur arbeitet mit sehr einfachen Mitteln und unter so natürlichen Bedingungen, daß sie jederzeit künstlich geschaffen werden können, sobald man weiß, auf was es ankommt.«
»Aber die Natur,« wandte Schulze ein, »braucht doch Jahrtausende, um Metalle und Edelsteine zu erzeugen?«
»O nein! Freilich, je nachdem die Stoffe und Bedingungen in schwächerem oder reicherem Maße vorhanden sind, braucht sie längere oder kürzere Zeit; der Mensch aber hat es in der Hand, alles nach Belieben zu steigern, und kann demnach die Umwandlungen in kürzester Frist vollziehen.«
»In der Tat,« bemerkte Friedrich, »hat man doch früher erklärt, das Entstehen der Steinkohle erfordere Millionen von Jahren; jetzt hat man in Nordamerika versumpfte Waldungen entdeckt, in denen die Umwandlung sich unter den Augen des lebenden Geschlechts innerhalb weniger Jahre vollzieht. Oben sind die Bäume noch Holz, unten im Wasser schon echte Steinkohle.«
Und Ulrich fügte bei: »Soviel ich gelesen habe, ist man auch darauf gekommen, kleine Diamanten durch eine Explosion, also innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde, zu erzeugen: die Hauptsache scheint, wie Tupak Amaru sagt, nur die Kenntnis der nötigen Stoffe und der Bedingungen zu sein, unter denen sie vereint werden müssen — natürlich im richtigen Verhältnis.«
Schulze bat nun den Inka dringend, ihnen das Geheimnis zu enthüllen. Dieser aber verwies sie auf spätere Zeit; dagegen schenkte er Friedrich von all seinen Pulvern eine ziemliche Menge, damit er selber damit Versuche anstellen könne; auch Schulze bekam ein Pulver, das Quecksilber in Gold verwandelte.
»Diese Pulver sind an unserer Entdeckung die eigentliche Erfindung,« sagte er dabei. »Sie enthalten alles, was zur Umwandlung der einzelnen Metalle nötig ist, und erzeugen selbsttätig die notwendigen natürlichen Bedingungen des Vorgangs. Für jedes Metall aber bedarf es eines besonderen Pulvers: das gleiche Pulver vermag nicht Kupfer und Blei in Gold zu verwandeln, sondern für Kupfer das eine, für Blei ein anderes; ebenso muß wieder für jede Metallart ein besonderes Pulver hergestellt werden, wenn man Silber erzielen will.«
»Ich erinnere mich,« sagte Friedrich, »daß mein Vater erzählte, der niederländische Gelehrte van Helmont habe im siebzehnten Jahrhundert von einem Unbekannten ein Pulver erhalten, mit dem er aus Quecksilber reines Gold darzustellen vermochte: das war wohl das gleiche Pulver, das Herr Professor Schulze soeben erhielt?«
»Gewiß!« erwiderte Tupak Amaru. »Wir gaben hier und da etwas von unsern Pulvern an Europäer ab, denen wir gewogen waren. Das Geheimnis aber haben wir bewahrt: denn einmal macht Gold die meisten Menschen elend statt glücklich, und sodann würde es alsbald allen Wert verlieren, wenn seine künstliche Herstellung in größerem Maßstabe betrieben würde, wie es ja auch bei uns, die wir es im Überflusse haben, gar keinen Verkehrswert besitzt.«
Auf Wunsch unserer Freunde führte der Inka sie auch noch in die Hütten, wo die Edelsteine bereitet wurden, und sie sahen unter ihren Augen Tausende der herrlichsten, und zwar tadellos echter Edelsteine aller Arten und Farben entstehen; ja durch besondere Mischungsverhältnisse schuf man Arten, wie sie bis jetzt noch nicht in der Natur entdeckt wurden. Es gelang auch mit Leichtigkeit, Steine von Apfelgröße und darüber zu erzielen und ihnen gleich bei der Entstehung beliebige Formen zu geben.
Die von all dem Glanze geblendeten Deutschen kamen nicht aus dem Staunen heraus.
EINES Tages saßen unsere Freunde mit dem alten Inka Manko im »Märchenwald«, wie sie den Wald mit den gewaltigen Bäumen nannten, der ein Lieblingsaufenthalt des Greises war. Mit ihm bewunderten sie das Gefieder des Sonnenvogels Quezal und lauschten entzückt seinem Sang.
Der Inka hatte im Laufe der Jahrhunderte diese scheuen Vögel derart zu zähmen gewußt, daß sie in Scharen um ihn her flogen und sich wohl auch auf seiner ausgestreckten Hand niederließen. Nicht müde konnte man werden, den wunderbaren Glanz der feinen wallenden Federn anzustaunen und Auge und Ohr zu laben an der Pracht der Farben und dem Wohllaut der Stimme dieser wahrhaftig paradiesischen Vögel.
Schulze, der mit Vorliebe den alten berühmten Inka in der »bilderreichen« Sprache der Indianer — aber auf Spanisch natürlich! — anredete, hub heute also an: »Ehrwürdiger Vater, erhabener Sohn der Sonne! Oft lauschten deines unwürdigen Knechtes dicke Ohren den Belehrungen der Weisheit, die deinen greisen Lippen entströmten, und Bewunderung erfüllte seine Seele vor der Größe deines unvergleichlichen Gehirnkastens, darin das Wissen langer Jahrhunderte aufgespeichert liegt. Hier ist ein Wunder, das mein wissenschaftliches Verständnis übersteigt: wolle dich herbeilassen, deinem unwissenden Sohne zu erklären, wieso diese Bäume solch gewaltige Größe erreicht haben, wie sie in keinem Konversationslexikon noch Lehrbuch der Botanik zu finden sind?«
»Weil meine weißen Söhne der Weisheit begierig sind,« erwiderte der Greis, »so will ich ihnen kundtun die größten Geheimnisse der irdischen Schöpfung Patschakamaks, die Geheimnisse des Lebens.
»In der Priesterstadt Manoa herrschte seit unvordenklichen Zeiten ein edles Geschlecht, lange, ehe die Inka ihre Herrschaft bis hierher ausdehnten, ja lange, ehe der Name der Inka auf Erden bekannt war. Ihre Könige waren Priester und hatten die älteste Weisheit der Urväter bewahrt, und durch scharfen Verstand und göttliche Eingebung lernten sie viel Verborgenes in der Natur erkennen. So erkannten sie auch die Kräfte, die das Wachstum der Bäume beherrschen, und die Ursachen, die ihr Absterben bedingen. Durch Kunst in der Nachhilfe der Natur gelang es ihnen, diese Riesenbäume zu rascherem Wachstum in Höhe und Umfang zu bringen als alle andern Bäume der Erde; zugleich entfernten sie die Ursachen, die den Tod ihrer Pfleglinge herbeiführen konnten. Jedes lebende Wesen scheidet Gifte aus, die seinem Leibe verderblich und zuletzt tödlich sind; und weil die Pflanze an ihrem Orte stehen bleibt, häuft sich das Gift in der Erde an, und sie muß immer weiter ihre Wurzeln ausstrecken, um ihre Nahrung aus einem Boden zu saugen, der von ihren Giften noch frei ist. Wenn zuletzt die Wurzeln nicht weiter können, weil ein Hindernis sie aufhält, oder wenn sie in eine Erde kommen, die keine genügende Nährkraft für sie besitzt oder auch von Pflanzen ähnlicher Art schon vergiftet ist, so stirbt die Pflanze ab.
»Jedes Gift aber hat sein Gegengift, ja, es kann durch geeignete Zusätze in ein Nahrungsmittel eben des Wesens verwandelt werden, das es ja aus den aufgenommenen Nährstoffen abgesondert und umgewandelt hat. So haben jene alten Weisen die Mittel gefunden, dem Boden eine fortwährende gesunde Nährkraft für die Bäume zu verleihen, die nun hier seit wohl dreitausend Jahren zum Himmel streben und Jahresring um Jahresring ansetzen, Ringe von außerordentlicher Dicke. Einmal wird ja auch die Zeit kommen, wo alle Kunst versagt oder ein großes Naturereignis diesen uralten Wald vernichtet; aber nach menschlichem Ermessen wäre sein unaufhörliches Bestehen und Weiterwachsen nichts Unmögliches. Doch alles Irdische ist vergänglich!«
»Ja, ja, es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen!« sagte Schulze nachdenklich. Er mochte wohl an seine eigene himmelstürmende Wissenschaft denken.
»Diese Bäume«, fuhr Manko fort, »lehrten mich das Geheimnis des Lebens. Als ich mich hierher zurückgezogen hatte und das Wunder dieses Waldes betrachtete, sann ich über das Lebensrätsel nach. Sehet, die Bäume setzen Ring um Ring an, sie wachsen, solange sie leben; der Mensch aber, ohne seine Nahrung noch Lebensweise zu verändern, hört zu einer gewissen Zeit auf zu wachsen, und ebenso fängt er nach einiger Zeit an zu altern, und zuletzt zerfällt seine Lebenskraft, und er stirbt. Weiße Freunde, die Inka hatten im Laufe der Zeiten viel Wissen aufgehäuft; von den Ältesten der Omagua lernte ich noch manches Geheimnis, und siehe! da ich nachforschte und prüfte und sann, was die Ursachen jener Lebensrätsel seien, ließ mich Patschakamak die Geheimnisse entdecken, warum der Mensch zu wachsen aufhört, warum er altert, warum seine Lebenskraft versiegt. Und so groß das Rätsel zu sein scheint, ist es einmal gelöst, so gibt es nichts Leichteres, als jenen Ursachen zu begegnen. Ich könnte einem Menschen, solange er sich im Wachstum befindet, die Mittel geben, daß er weiter wächst, wie der Baum, und zum Riesen würde; ich habe auch unter den Völkern hier oben einen Stamm von Riesen heranwachsen lassen: sie sind die Wächter des Felsenwalles, der unser Land umgürtet. Ich kann dem Menschen Mittel geben und das Verhalten angeben, um nicht zu altern: deshalb findet ihr so wenig Greise unter uns. Ich war schon alt, da ich die Geheimnisse entdeckte, und das Alter läßt sich nicht wieder verjüngen: das heißt, es mag auch dies möglich sein, allein die Wege hierzu sind mir bis jetzt verborgen geblieben. Ich begehre auch keine Verjüngung, denn meine Kraft bleibt immer jugendfrisch. Die Napohäuptlinge, die das Geheimnis Manoas kennen, nehmen wir in ihrem Alter bei uns auf; sie sind die Richter, die über euch zu Gerichte saßen. Meinem Sohne aber habe ich die Jugend erhalten durch die Jahrhunderte und so den meisten der Bewohner dieses Landes. Das Höchste und Kostbarste, das ich fand, war, die Lebenskraft stets auf derselben Höhe zu halten, daß sie nicht abnimmt, sondern sich gleich bleibt durch alle Zeiten.«
»So hast du den Tod für euch aus der Welt geschafft?« fragte Ulrich.
»Nein!« erwiderte der Inka. »Ein Unglück könnte jeden von uns töten; da es aber Verbrecher bei uns nicht gibt, wilde und giftige Tiere nicht da sind, so haben die Todesfälle schon lange, lange Zeit aufgehört.«
»Wir haben eine Sage,« begann nun Friedrich nachdenklich, »eine Sage von einem Menschen, der nicht sterben kann; man heißt ihn den ewigen Juden: seine einzige Sehnsucht ist der Tod, und seine größte Qual sein unzerstörbares Leben. Er sucht den Tod, und der Tod flieht ihn.«
»So ist es bei uns nicht,« sagte der Greis lächelnd. »Nur Schuld und Leid bringt solchen Lebensüberdruß; freilich auch des glücklichen, heiteren Lebens mag man müde werden, doch nicht also, daß man es hassen würde und als Qual empfände. Wir verschönern einander das Leben und bleiben gerne beieinander, zumal wir einer Hoffnung leben, das alte Inkareich wieder aufblühen zu sehen; dann, ja dann, wenn wir es gefestigt schauen, eine glückliche Menschheit vereinend in Lust und Frieden, dann werden wir gerne die Augen schließen und ruhen von langer Lebensarbeit; denn niemand hindert uns, den gleichen Weg zu gehen wie andere Menschen. Es ist unser freier Wille, daß wir die Mittel brauchen, die den Verfall der Kraft hindern, und jederzeit könnten wir auf sie verzichten, wenn wir zu sterben begehrten. Aber ich sage euch, ein paar hundert Jahre vergehen wie im Traum; denn man lernt immer Neues und kommt im Wissen, in Erkenntnis und Erfahrung immer rascher voran und gewinnt Schätze der Weisheit, die in einem gewöhnlichen Menschenalter nimmermehr zu erreichen wären. Der gesunde Mensch hat von Natur eine mächtige Lebenslust, einen unbändigen Lebenstrieb. Ach! wie viel gehört dazu, diese Lebenslust zu brechen, wie viel Schuld, wie viel Leiden, daß man im Alter schon von achtzig oder neunzig Jahren den Tod herbeisehnt!«
»NOCH eines!« fragte nun Ulrich. »Kommen bei euch gar keine Krankheiten vor?«
»Nur selten wird hier oben ein Mensch von einem Leiden befallen. Die meisten Krankheiten sind eine Folge eigener Fehler oder fremder Verschuldung und Bosheit, es sei denn, daß man in ungesunden Ländern wohnte. Außerdem gibt es freilich auch Leiden, die von Cupay, dem Feinde aller Menschen, kommen, und die sich durch keine Vernunft noch Tugend vermeiden lassen; aber wir haben ein sicheres Heilmittel für alle Krankheiten des Leibes.«
»Oho!« sagte Schulze, der schon wieder in seinen Gelehrtenwahn verfiel. »Da hört sich doch alle und jede Wissenschaft auf! Ein Allerweltsmittel gibt es nicht: das ist immer Schwindel oder Einbildung und Kurpfuscherei.«
»Ein Universalheilmittel aller Krankheiten gibt es doch,« erwiderte der Inka ernst; »aber freilich nur ein einziges: das ist die gesunde Lebenskraft selber, die in ihrer höchsten Steigerung alle Krankheiten überwinden muß. Das Mittel, das wir besitzen, und das neben den uns allein bekannten Schutz- und Verhaltungsmaßregeln auch dazu dient, unsere Lebenskraft stets auf der Höhe des reifen Mannesalters zu erhalten, hilft uns bei allen Krankheitsfällen: durch die Erhöhung der Lebenskraft wird alles dem Leben Feindliche überwunden und ausgeschieden. Darum brauchen wir, wenn es zum Kampfe mit den Weißen einst kommen sollte, keine noch so schwere Verwundung zu scheuen, es sei denn, daß ein unentbehrliches Lebensorgan zerstört würde.«
»Auch bei uns«, sagte Friedrich, »sind vor hundert und zweihundert Jahren Ärzte umhergezogen, die behaupteten, sie hätten das Lebenselixir, und die auch wirklich jede Krankheit heilten; soviel ich weiß, kamen sie aus Spanien. Wenn aber ihr Vorrat aus war, bereiteten sie andere Mittel, die nichts halfen, und man glaubte ihnen nicht mehr.«
»Das ist wohl möglich,« stimmte Inka Manko bei. »Wie unser Goldpulver, so haben wir auch unser Lebenswasser einzelnen edlen Weißen geschenkt; und mit einem Fläschchen davon konnten sie lange Jahre hindurch Wunderkuren vollführen; denn wie ein Tröpflein scharfen Gifts genügt, ein Leben zu vernichten, so ist es auch bei diesem Gegenteil des Giftes: ein Tropfen in einer Flasche Wasser genügt, um viele Kranke zu heilen.
»Vielleicht kommt ihr selber einmal in die Lage, hier oben von Schwäche oder Krankheit befallen zu werden. Erklären kann ich euch die großen Geheimnisse des Lebens heute noch nicht; aber von dem Wunderelixir soll jeder von euch für alle Zufälle ein Fläschchen erhalten.«
Mit diesen Worten entfernte sich der Inka und kam nach kurzer Zeit mit drei Kristallfläschchen wieder, die eine durchsichtige Flüssigkeit enthielten, und die er den drei Deutschen überreichte.
»Wenn sich dieses Wasser bewährt,« meinte Schulze, »dann haben wir erst das Wertvollste vom Stein der Weisen: Gesundheit und Leben gehen doch über Gold und Silber!«
NUN waren unsere Freunde schon zwei Monate in Manoa; sie machten häufig Ausflüge in die Umgegend und blieben wohl auch ein bis zwei Tage fort. Dabei war es ihnen nicht bloß darum zu tun, das Land und seine Wunder eingehend kennen zu lernen, sondern sie wollten auch ihre Flucht auf diese Weise vorbereiten. War man gewohnt, sie oft tagelang nicht heimkehren zu sehen, so würde ihre heimliche Entfernung nicht so bald entdeckt werden können, und bis man ihnen etwa nachsetzen wollte, wären sie längst über alle Berge gewesen.
Aus eben diesem Grunde dehnten sie allmählich ihre Reisen weiter aus und blieben auch wohl acht bis zehn Tage fort. Friedrichs Schlangenring öffnete ihnen überall Herzen und Tore, auch vermochten sie sich bereits in der Landessprache auszudrücken.
Nachdem sie die ziemlich ausgedehnte Hochebene mit ihren Dörfern und Städten, mit all ihren Natur- und Kunstwundern, mit ihren verschiedenen Indianerstämmen, unter denen die Omagua, Tayronen und Aturen hervorragten, die Kreuz und Quere durchforscht hatten, drangen sie zuletzt bis an den Felsenwall vor, der das ganze Land umgürtete.
Sobald sie in die Nähe der Felsen gelangten, erschienen Männer von gewaltiger Körpergröße, bis gegen drei Meter hohe Gestalten, aber schön und ebenmäßig gebaut. Sie sahen die Fremdlinge mit Mißtrauen nahen und nahmen eine drohende Haltung an; sowie aber Friedrich seinen Schlangenring zeigte und den Namen Tupak Amaru aussprach, waren sie wie umgewandelt und die Freundlichkeit selbst.
Nachdem unsere Freunde die mächtigen Glieder dieser Enakskinder genügend bewundert hatten, wandten sie ihre Aufmerksamkeit dem Walle selber zu. Man sah deutlich, daß hier der Natur nachgeholfen worden war, denn die Felsen waren nach innen zu so glatt behauen wie eine Wand, und Lücken zwischen ihnen waren künstlich ausgefüllt. So bildeten sie eine mindestens drei Meter hohe ununterbrochene Brüstung, deren Krone jedoch nicht gleichmäßig abgeschnitten war wie bei einer Mauer, sondern vielmehr rauh und wildgezackt; teilweise stiegen turmhohe Felsen von ihr auf, so daß von der Ebene unten das Ganze den Eindruck natürlicher Felsbildungen machen mußte.
Die Riesen konnten, wenn sie auf kleine Felsblöcke stiegen, über die Brüstung wegsehen, wenigstens über ihre niedersten Stellen. Überall war aber die Mauer auch mit Öffnungen versehen, die sich gerade in Augenhöhe der Wächter befanden und ihnen gestatteten, das ganze Land umher weithin zu überschauen, während aus der Tiefe die verhältnismäßig geringfügigen Gucklöcher gar nicht zu bemerken waren.
»Ihr seid aber merkwürdig groß!« sagte Schulze scherzend zu einem der Riesen.

»Weiß Gott,« antwortete dieser, »wenn wir den Inka nicht gebeten hätten innezuhalten, weil wir uns vor uns selbst zu fürchten begannen, er hätte uns bis zum Himmel wachsen lassen!« und er lachte, daß die Felsen erdröhnten.
Als Friedrich den Wunsch äußerte, die Aussicht von dort oben zu genießen, hoben die Riesen bereitwilligst die drei Deutschen empor und setzten sie auf die Brüstung des Walles. Anfangs schwindelte allen dreien, als sie in die jähe Tiefe hinabblickten; bald aber gewöhnten sie sich an den Anblick. Wie sie es schon von unten bemerkt hatten, sahen sie auch hier die Felsen nach außen hin so jäh abfallen, daß eine Ersteigung einfach unmöglich sein mußte und es als eine überflüssige Vorsicht erschien, wenn der natürliche Wall mit zahlreichen losen Felsblöcken belegt war, die im Falle eines Angriffs von den Riesen auf die Stürmenden hinabgeschleudert werden konnten. Auch innerhalb des Walles hatten die Riesen noch ganze Berge von Felsblöcken aufgetürmt, so daß sie die größte Armee mit solchen Vorräten zerschmettern konnten.
Da der Umfassungswall dem ganzen Rande der Hochebene mit allen seinen Einschnitten folgte, so bot er ringsum einen unüberwindlichen Schutz; nur die Felsenschlucht mit der Guacharohöhle konnte der überhängenden Wände wegen von hier aus nicht beobachtet werden, doch lag sie ja verborgen genug, und die engen Zugänge der Schlucht, der Höhle und des weiteren Weges waren mit Leichtigkeit gegen ein ganzes Heer zu verteidigen, sobald ein solches erschienen wäre.
Eine Gefahr für die glücklichen Ansiedler hier oben schien also ausgeschlossen, wenn man auch ihr Geheimnis entdeckt und die ganze Welt einen Eroberungszug gegen sie unternommen hätte.
Unsere Freunde befanden sich am südwestlichen Ende der Hochebene, wo diese sich bei weitem nicht so hoch über das Vorgelände erhob wie im Osten und Norden; man sah sogar deutlich das Flußtal, das von dieser Seite vor Zeiten ganz allmählich zu den Höhen von Manoa emporführte, und durch das seinerzeit der Häuptling Viraratu in den See Manoa gelangt war. Nun aber waren die Quellen des Flusses abgeleitet, und die Wasser stürzten in mächtigem Fall an einer andern Stelle von der senkrechten Felswand herab. Das Tal selber war jedoch durch eine ganz natürlich aussehende Granitmauer derart abgesperrt, daß es keinen Zugang mehr bilden konnte.
Im Westen und im Süden erhob sich in geringer Entfernung die Cordillera de los Pastos, und weiter südlich erblickte man die mächtigen Schneegipfel und Vulkane von Quito. Die Aussicht war großartig! Und welch gute Wächter die Riesen waren, erfuhr Schulze zu seiner höchsten Verwunderung; denn einer der scharfsichtigen Männer, deren Sehkraft ihrer Körpergröße zu entsprechen schien, machte ihn auf einen Andenbär aufmerksam, den der Gelehrte kaum mit seinem guten Fernrohr noch wahrzunehmen vermochte.
An dieser Stelle war der Felsenwall wohl achtzig bis hundert Kilometer von Manoa entfernt, während er im Osten bis auf etwa zehn Kilometer an die Stadt herankam; unsere Freunde unternahmen die Wanderung an dem Wall entlang und schritten den Bogen aus, dessen Sehne demnach etwa neunzig bis hundertundzehn Kilometer betrug. In sechs Tagemärschen legten sie die zweihundert Kilometer dieses Bogens zurück und befanden sich nun wieder in nächster Nähe der Goldstadt, von ihr durch den »Märchenwald« getrennt. Hier konnten sie von dem Walle unmittelbar in die Schlucht hinabschauen, in der noch der von Friedrich bekämpfte Riesenwurm lag, freilich arg zerfleischt von den Zamuro. Einige Stunden gingen sie noch weiter die Felsenmauer entlang, von den überall wachestehenden Riesen stets bereitwilligst emporgehoben, wo sie nur immer Ausschau halten wollten; sie erblickten nun auch aus der Vogelschau Tompaipos und Narakatangetus Lager, ersteres mitten im Walde, letzteres am Eingange eines der zahlreichen Felsentäler, die den Fuß des Berges durchfurchten.
Dann aber kehrten sie nach Manoa zurück.
BEI all ihren Wanderungen, die sie meist ohne Begleitung unternahmen, beredeten sich unsere Freunde über ihre beabsichtigte Flucht. Der alte Inka hatte sich wieder ganz in seine Höhle zurückgezogen; Unkas fühlte sich so wohl in Manoa, daß er an den Ausflügen nur noch selten teilnahm. Tupak Amaru entfernte sich nie weit von der Hauptstadt, weil er alle Tage sein Opfer dem See darbrachte und nur ungern einen Stellvertreter hierfür ernannte, wenn er eine Besichtigungsreise durch das Reich machte.
Der junge Inka merkte wohl, daß alles Glück und alle Pracht hier oben Friedrichs Sehnsucht nach seinem Vater nicht aus dessen Herzen tilgten. Er mußte seinen jungen Freund wegen seiner Kindestreue nur umso höher schätzen; doch betrübte ihn Friedrichs Kummer, und so sprach er eines Tages zu ihm: »Ich durchschaue deine Seele, du sehnst dich hinaus. Wir dürfen es nicht gestatten, und wenn mein Vater es für möglich hielte, daß euch eine Flucht gelänge, er würde euch keine freie Wanderung mehr erlauben. Aber wie solltet ihr entkommen ohne unsern Willen? Ich kann es mir nicht denken, und doch bedrückt eine dunkle Ahnung mein Herz, als möchte die Trennungstunde schlagen, dann würdest du meine Seele mit fortnehmen, denn sie hat dich lieb. Ich weiß wohl, Patschakamak selber steht dir bei, und er, der dir den Sieg über den Wurm gab, den noch kein Sterblicher erlegt hatte, er kann seinen Liebling auf Flügeln von hier hinabtragen, um sein Gebet zu erfüllen. Wie sollten wir hindern, was Illja Tekze, der ewige Gott, beschlossen hat? Solltest du je durch ein Wunder diese Stätte verlassen, so wird dir mein Ring jedes Indianerherz geneigt machen, wenn du nur meinen Namen nennst. Daß du das Geheimnis unserer Zuflucht nie verraten wirst, dessen bin ich gewiß. Und wenn du einst wiederkehren solltest, so wirst du willkommen sein mit allen, die du mitbringen willst, so ihr ganz bei uns bleiben wollt. Wollte Gott, die Zeit wäre bald da, wo wir das Inkareich wieder aufrichten; mein Vater zögert gar zu lange; ich glaube, wir könnten es heute schon tun, doch er fürchtet, es möchte jetzt noch zu viel Blut kosten: das Geschwür der Welt ist noch nicht reif, um unblutig geschnitten werden zu können. Aber kommen wird die Zeit! Und dann soll mein Freund mir zur Seite stehen und mit mir herrschen, ich über die roten, er über die weißen Brüder. Allein ich hoffe, daß auch meine jetzige Ahnung mich trügt, daß ihr bei uns bleibet in Glück und Frieden. Bitte doch nicht Patschakamak um die Trennung von deinem Bruder! Höre meinen Rat; ihr habt den Felsenwall im Süden umgangen, machet jetzt eine Reise nach Norden an ihm hin; sie wird dreimal so lange währen, aber ihr werdet noch Schöneres und Wunderbareres schauen als bisher, und ich hoffe, das alles wird eure Seele immer mehr an dieses Land ketten, daß ihr seine Herrlichkeit und Seligkeit nicht mehr missen möget. Und deinen Vater werde ich suchen lassen, er soll auch zu uns kommen!«
Friedrich standen die Tränen in den Augen, er leugnete seine Sehnsucht nicht, und das Herz war ihm schwer bei dem Gedanken an die heimliche Trennung von dem geliebten Freunde; er erwiderte aber nur: »Überlasse es Illja Tekze, was er über uns beschlossen hat; seinem Willen werden auch wir uns fügen!«
Inzwischen war der Juni gekommen und die Aufforderung Tupak Amarus zu der langwierigen Reise in das nördliche Gebiet des Landes bot eine günstige Gelegenheit zu unbemerktem Entweichen. Unkas bat seine Herren, ihn hier oben zu lassen, wo er sich glücklich fühlte unter glücklichen Brüdern, und versprach, über die Flucht der Weißen kein Wort verlauten zu lassen. Sein Wunsch wurde ihm gewährt. Er begleitete noch unsere Freunde bis zu dem Baume, unter dessen Wurzeln der geheime Eingang in die Bergwerke mündete, dann nahm er in großer Bewegung Abschied von ihnen.
Allen, besonders aber Friedrich, tat es leid, daß sie sich von Tupak Amaru und Manko nicht verabschieden konnten; das aber ging ja nicht an, wenn sie fortkommen wollten. So stiegen sie denn hinab in den Schoß des Berges und durcheilten raschen Schrittes die funkelnden Erzgänge, als ob sie fürchteten, man verfolge sie schon.
Der leuchtende Stein, den Friedrich seinerzeit unter den Wurzeln des Riesenbaumes verborgen hatte, als er dort mit Ulrich das Tageslicht erreichte, diente ihnen wieder als Fackel, und bald hatten sie den Kamin unter den Orgelsteinen erreicht und entfernten mit vereinten Kräften die Platte, die ihn verschloß.
Nachdem sie sich überzeugt hatten, daß sie auch in der Guacharohöhle allein und unbelauscht waren, setzten sie die Platte an ihren alten Ort zurück und begaben sich an den Ausgang der Höhle, wo sie den Eintritt der Dunkelheit abwarteten, um ihren Weg weiter fortzusetzen. Lange brauchten sie nicht zu verweilen, da sie eben in Rücksicht darauf, daß sie nur bei Nacht die Höhle verlassen durften, erst am Nachmittage von Manoa aufgebrochen waren. Friedrich verbarg den Leuchtstein in seiner Tasche, damit das Licht sie nicht verrate; erst im dichtesten Walde befestigte er ihn wieder an seinem Hute.
Da zu vermuten war, daß sich Ulrich infolge seiner Flucht aus Narakatangetus Zelt und vielleicht auch sein Bruder nicht ungefährdet unter die Indianer wagen konnten, begab sich Schulze allein in das Lager und ließ sich sofort zu Tompaipo führen, den er bat, ihm zu folgen. Blitzhand war höchlichst überrascht, als er seine jungen Freunde traf, und der strahlende Stein auf Friedrichs Hut entlockte ihm einen Ausruf des Staunens.
»Zum Kuckuck, wie kommt ihr daher?« rief er aus. »Ich glaubte euch über alle Berge, und es tat mir nur leid, daß ihr französischen Abschied genommen hättet und eure Lama zurückließet. Aber freilich, ihr hattet Eile! Und wo steckte denn Friedrich die Zeit über? Nun, das nenne ich eine Überraschung! Aber an eurer Stelle wäre ich nicht zurückgekehrt. Narakatangetu kennt keinen Spaß und würde jetzt kurzen Prozeß mit euch machen nach dem, was er mit den Mestizen erleben mußte!«
»Wo wir gewesen sind, ist ein tiefes Geheimnis,« sagte Friedrich. »Nun aber müssen wir uns eiligst aus dem Staube machen, nur wären wir dem großen Häuptling der Napo dankbar, wenn er uns die Lama zusenden wollte.«
»Genehmigt!« erwiderte Tompaipo. »Aber von dem ›großen Häuptling‹ und der ›Dankbarkeit‹ will ich nichts wissen. Doch erlaubt, Herr Friedrich! Schon früher fiel mir ein Ring an Ihrer Hand auf, allein ich konnte ihn nie recht erkennen: dürfte ich ihn nicht genau betrachten? Er blitzt so eigentümlich an Ihrem Finger.«
Friedrich reichte ihm die Hand; kaum hatte Tompaipo auf der nach innen gekehrten Seite den funkelnden Kopf der Schlange erblickt, als er ganz außer sich vor Verwunderung ausrief: »Die glänzende Schlange! Dachte ich mir's doch! Aber ich konnte es nicht glauben! Wie kommen Sie zu diesem unschätzbaren Kleinod? So etwas findet man nicht auf der Straße!«
»Tupak Amaru!« sagte Friedrich einfach.
Tompaipo sah den Jüngling mit wahrer Ehrfurcht an. »Wer seid ihr, der ihr den Geheimnissen der Omagua näher steht als ein Napohäuptling und höherer Ehre gewürdigt wurdet als je ein Sterblicher vor euch? So seid ihr freilich gefeit, und Narakatangetu selber würde sich vor euch in den Staub werfen, wenn er das Kleinod erblickte, und euch kein Haar zu krümmen wagen, vielmehr in allen Dingen euch zu Diensten sein!«
»Mehr darf ich leider nicht verraten,« erwiderte Friedrich, selber erstaunt. »Den Ring habe ich von einem mächtigen Freunde, das möge genügen.«
»Wahrhaftig! Einen solchen Freund haben, das erhebt über andere Sterbliche! Doch Blitzhand weiß ein Geheimnis zu ehren, sonst wäre er kein Häuptling der Napo. Nur rate ich Ihnen, drehen Sie den Kopf der Schlange nach außen, daß jedermann ihn sehen kann, so werden Sie nicht bloß unbehelligt die Lager der wildesten Indianer durchziehen können, sondern von allen Rothäuten wie ein himmlisches Wesen verehrt werden.«
Friedrich befolgte den Rat, und darauf nahmen alle gerührten Abschied von Tompaipo; denn obgleich dieser versicherte, unter dem Schutze des Ringes hätten sie nichts mehr zu befürchten, beharrten sie darauf, noch in der Nacht weiterzureisen.
Etwa eine Stunde nach Blitzhands Entfernung erschienen zwei Indianer mit den hochbepackten Lama, auf deren Rücken auch die drei Affen saßen, und erklärten, die Weißen auf Tompaipos Befehl als Diener zu begleiten, solange sie ihrer bedürften. Der Häuptling hatte Lebensmittel und Geschenke in Menge den Lama aufbürden lassen, ein letztes Zeichen, wie lieb er seine Freunde gewonnen hatte.
Die Indianer aber bezeugten Friedrich eine Verehrung wie keinem ihrer Häuptlinge, sobald sie mit hohem Staunen den Schlangenring an seiner Hand erkannt hatten.
WIR haben gehört, daß Narakatangetu sofort nach Ulrichs Flucht und Diegos Tod die beiden überlebenden Mestizen, Alvarez und Lopez, gefangennahm. Er gedachte auch nicht lange mit ihrer Hinrichtung zu zögern und wollte ihnen nur vorher ein Geständnis erpressen, um zu erfahren, wieviel sie vom Geheimnis der Omagua wüßten, und welche Mitwisser sie etwa noch hätten.
Doch hatte er zu wenig mit der Geriebenheit seiner Gefangenen gerechnet. Diese hatten an den Fall ihrer Gefangennahme gedacht und beizeiten eine List vorbereitet, die ihnen möglicherweise zur Freiheit verhelfen sollte. Sie versicherten Narakatangetu, sie wüßten weit mehr, als er ahne, und sie könnten ihm die Männer angeben, die das Geheimnis verraten hätten, versprachen auch alles freiwillig zu gestehen, nur möchte er ihnen erlauben, zuvor den bösen Dämon zu beschwören, von dem die Enthüllung ursprünglich herstamme, und der seine Wohnung im Tale aufgeschlagen habe, an dessen Eingang sich das Lager befinde. Er müsse dann dem Dämon das Versprechen abnehmen, das Geheimnis nicht weiter auszuplaudern, sonst sei er vor Verrat zu keiner Zeit sicher.
Obgleich Narakatangetu als Heide an Dämonen glaubte, ahnte er doch hinter dieser Zumutung irgend eine List; er gab daher nur unter der Bedingung nach, daß seine Gefangenen während der Beschwörung gefesselt bleiben sollten.
Sie erklärten, daß dies wohl sein könne, da er selber nach ihrer Anweisung imstande sei, die notwendigen Handlungen vorzunehmen; er dürfe jedoch nicht mehr als drei Mann mitnehmen, und sonst solle es niemand gestattet sein, sich in der Nähe des Taleinganges aufzuhalten. Narakatangetu, entschlossen, alle Vorsicht zu gebrauchen, ging auf diese Bedingungen ein.
Am Eingang der Schlucht fand er ein kleines Häuflein dürrer Blätter und Zweige; Alvarez gab an, der Häuptling und seine drei Begleiter müßten um diesen Haufen herumstehen und ihn anzünden, dann werde der Dämon auf die Beschwörungsworte des Mestizen hin im Rauche erscheinen und ihnen in allem zu Willen sein.
Das sah aus wie eine Geisterbeschwörung nach der Art, wie sie auch sonst vorgenommen wird; dennoch wandte Narakatangetu argwöhnisch ein: »Und wenn die Napo in das Feuer schauen, entweichen ihre listigen Gefangenen.«
»Wie könnten sie fliehen, da sie an Händen und Füßen gebunden sind? Aber, daß ihr sicher seid, stellt uns zwanzig Schritte weiter hinein ins Tal, so steht ihr zwischen uns und der freien Ebene; da die Schlucht nur den einen Ausgang hat, müßten wir gebunden durch das Feuer hindurch und über euch hinweg, wenn wir entkommen wollten.«
Der Häuptling glaubte aus Vorsicht folgen zu sollen, und nun schien eine Flucht der Mestizen ein Ding der Unmöglichkeit. Alsbald stellten sich die Indianer um den Blätterhaufen und zündeten ihn an, es mußte sich ja gleich offenbaren, ob die Mestizen wahr gesprochen hatten; warum sie in dieser Sache gelogen haben sollten, konnte Narakatangetu trotz seines Mißtrauens sich nicht denken, auch schien es ihm sehr einleuchtend, daß bei dem Verrat eines durch Jahrhunderte so sorgfältig gehüteten Geheimnisses, das hier unten ihm allein bekannt war, ein böser Geist im Spiel sein müsse.
Alvarez rief mit lauter Stimme seine Beschwörungsformeln, da erfolgte ein dumpfer Knall, die Erde unter den Füßen der Indianer wurde emporgeschleudert, und eine Feuersäule schoß empor. Zwei der Indianer waren buchstäblich zerrissen, einer an den Felsen zerschmettert, der Häuptling war einige Schritte gegen den Ausgang der Schlucht geschleudert wurden, wo er anscheinend leblos liegen blieb.
Trotz ihres entfernten Standpunktes, den die Mestizen, unmerklich rückwärts rückend, möglichst weit weg vom Feuer zu verlegen gesucht hatten, warf auch sie der Luftdruck zu Boden.
»Die haben ihr Teil!« sagte Alvarez, sich aufraffend. »Es war ein guter Gedanke von dir mit der Mine, Freund Lopez!«
»Nun aber zum Messer!« sagte dieser, sich ebenfalls emporrichtend.
Mühsam kamen die beiden auf die Füße und begaben sich an eine Stelle, wo sie ein Messer mit dem Griff fest in einen Felsenspalt eingerammt hatten. Lopez rieb die Bande seiner auf den Rücken gefesselten Arme an der vorstehenden Schneide, bis sie durchschnitten waren, dann löste er das Messer aus dem Spalt und durchschnitt seine Fußfesseln, um dann auch Alvarez zu befreien.
Hierauf eilten sie über Narakatangetus Körper hinweg ins Freie. Don José versetzte dem Häuptling einen Fußtritt; hätte er geahnt, daß der regungslos Daliegende nur betäubt war, gewiß hätte er ihm zuvor den Dolch ins Herz gestoßen. Aber die beiden hatten Eile, wenn sie auch hoffen durften, daß Narakatangetus Verbot, sich der Schlucht zu nähern, trotz der weithin donnernden Sprengung von den Indianern nicht übertreten werde.
Mit aller Vorsicht begaben sich die Flüchtlinge außer Bereich des Indianerlagers, dann rannten sie, so schnell ihre Füße sie trugen, dem Rio Miguel und von dort dem Rio Aguarico zu. Sie kamen auch glücklich nach Quito, wo sie sich mit ihrem Geld, das ihnen von den Indianern nicht abgenommen worden war, neu ausstatteten. Zehn Wochen warteten sie hier, gegen Ende Mai aber zogen sie wieder vorsichtig gegen den Rio Miguel, um auszuforschen, wann die Indianer wieder ostwärts zögen, damit sie alsdann ohne Gefahr ihre Entdeckungen weiter verfolgen könnten.
Ihre in Quito angeworbenen spanischen Diener mußten die Gegend auskundschaften und berichteten bald, daß die Indianer noch immer zwischen dem Rio San Miguel und dem Putumayo lagerten; die Mestizen zogen sich daher wieder in die Berge zurück, von wo aus sie von Zeit zu Zeit die Diener auf Kundschaft aussandten.
Alvarez hatte sich in Quito mit einem guten Fernrohr versehen, mit dem er oft von den Höhen aus die Ebene gegen den San Miguel hin musterte; denn die Napo kamen hier und da nach Quito, wohin sie in hohlen Bambusstäben Goldstaub brachten, um dafür Waren einzutauschen, die sie brauchten.
Eines Tages beobachtete Don José wieder die Straße, die an den Anden heraufführte, als plötzlich ein Fluch seinen Lippen entfuhr.
»Carajo! Wenn mich nicht alles trügt, so sind es diese deutschen Hunde, die hier heraufkommen! Wahrhaftig, sie sind's! Und der gelehrte Esel mit zwei indianischen Spitzbuben ist bei ihnen. Weiß der Kuckuck, wie sie uns wieder in den Weg laufen! Aber diesmal hat ihre letzte Stunde geschlagen!«
Schnell berieten die Mestizen, wie sie am besten ihre Rache ausführen könnten. Der Weg führte stellenweise an schauerlichen Abgründen vorbei; nichts war leichter, als sich hinter Felsen zu verbergen und im Augenblick, wo die Reisenden vorbeikamen, jäh hervorzubrechen und sie in die Tiefe zu stürzen.
Ein günstiger Platz zur Ausführung dieses verbrecherischen Vorhabens war bald gefunden; nur ein Umstand machte den Mestizen Sorge: sie waren mit ihren Dienern nur zu viert; die Ankömmlinge aber zu fünft; doch hatten sie ja ihre Waffen, und wenn erst vier hinabgestürzt waren, konnten sich alle gegen den fünften wenden. Schließlich hatten sie es auch bloß auf die Weißen abgesehen, und die Indianer, von denen einer vorausging, der andere den Zug abschloß, würden nicht so töricht sein, ihr Leben für ihre Herren aufs Spiel zu setzen.
Den scharfen Augen des vorausschreitenden Indianers, die eines Fernrohrs nicht bedurften, waren jedoch die vier Gestalten am Wege nicht entgangen; ja, er glaubte in zweien von ihnen bestimmt die entflohenen Mestizen aus Narakatangetus Lager zu erkennen. Als er sah, wie sie sich hinter den Felsen verbargen, witterte er gleich Unrat und teilte seine Beobachtung seinen Begleitern mit.
Schulze schlug alsbald vor, umzukehren und einen andern Weg über das Gebirge zu wählen; Ulrich aber meinte, wegen dieser Spitzbuben wolle er keinen Umweg machen, zumal er keine Angst vor ihnen empfinde.
Der Napo, der die Feinde entdeckt hatte, entwickelte einen anderen Plan: sie sollten einander in großen Abständen folgen, vor dem Vorübergehen am Hinterhalt befestige er seinen Lasso an einem Felsen und wickle ihn im Weiterschreiten ab, so daß die etwa Hervorstürzenden, die das Manöver kaum bemerken konnten, darüber zu Fall kämen. Gegen eine Kugel decke er sich durch den Leib des Lamas, und so sollten es die andern auch machen. Dadurch, daß sie großen Abstand hielten, könnten sich die Feinde höchstens auf einen von ihnen stürzen, dem dann die andern mit ihren Feuerrohren Hilfe leisten könnten; der Angegriffene aber solle sich sofort zu Boden werfen und sich am Lasso festhalten.
Schulze war schwer zu bewegen, sich vorwärts zu wagen, der Plan schien ihm schwach und die Sachlage ungemütlich. Schließlich aber wollte er nicht feige erscheinen und gab nach. Es sollte aber gar nicht so weit kommen. Ehe die Gefährdeten noch den Hinterhalt erreicht hatten, kam von oben her auf dem gewundenen Felsenpfad eine Indianerkarawane herab, etwa zehn Mann mit ebensoviel Lama.
Der Napo gab den Leuten ein Zeichen, daß Gefahr lauere; aber schon sprang Alvarez' Diener, der mehr Mut als Verstand besaß, aus seinem Versteck hervor und umfaßte den nächsten Indianer, um ihn hinabzustürzen: er glaubte, das seien die Leute, denen die Mestizen Verderben zugedacht hatten, und wollte sich die große Belohnung verdienen, die Don José für einen kühnen, erfolgreichen Angriff versprochen hatte. Er war aber bei dem Indianer an den Unrechten gekommen. Obgleich er mit solcher Wucht hervorgebrochen war, daß er den Roten hart an den Rand des Abgrundes stieß, wahrte dieser doch sein Gleichgewicht und faßte den Spanier am Kopf. Es entspann sich ein gräßliches Ringen, dessen Ende abzusehen war und auch alsbald erfolgte: die beiden festumschlungenen Männer verloren den Halt unter den Füßen und stürzten mit einem gellen Aufschrei in die Tiefe, wo sie, auf den Felsen aufschlagend, zerschellten.
Wie die Katzen waren die übrigen Indianer an der rauhen Felswand emporgeklettert und drangen nun wütend in die Schlupfwinkel ein. Bald waren Lopez und der andere Diener erfaßt und trotz ihrer verzweifelten Gegenwehr gefesselt. Mit wildem Triumphgeheul stürzten die Indianer die Unglücklichen dann in den Abgrund.
Alvarez hatte sich vorgesehen und war entkommen. Er jagte den Felspfad hinab, vorbei an denen, die er hatte verderben wollen, und die ihn, eng an die Felsen gedrückt, unbehelligt vorüber ließen. Der vorderste Indianer tat dies nur auf Friedrichs strengen Befehl. Der andere Napo aber, der den Zug beschloß, hatte nicht verständigt werden können, denn alles spielte sich innerhalb weniger Sekunden ab. Zwar mußte auch er den Mestizen vorbeilassen, weil dieser wie der Sturmwind daherraste; aber er hatte seinen Lasso bereitgehalten, der alsbald über den Kopf des Flüchtigen sauste, und ihn im nächsten Augenblick mit gewaltigem Ruck zu Boden ritz. Der Sturz war so heftig, daß Alvarez' Körper dem Abgrunde zurollte und über den Wegrand hinabkollerte; doch hatte der Mestize Geistesgegenwart genug, seine Hände in den Felsen zu krallen, so daß er über der Leere schweben blieb.
Schon wollte der Napo ihn vollends hinabstürzen, als Friedrich ihm zurief, das Leben des Elenden zu schonen. In diesem Augenblick aber durchbohrten zwei Pfeile, von den entgegenkommenden Indianern gesandt, die krampfhaft sich festklammernden Hände des Mestizen, die sich alsbald lösten. Der Napo mußte den Lasso loslassen, um nicht mit ins Verderben gerissen zu werden; Don José de Alvarez aber folgte mit einem gräßlichen Fluch seinen Gefährten in die Tiefe, wo der zerschmetterte Leichnam gleich den ihren eine Beute der Zamuro wurde.
Tief erschüttert über diese Szenen des Entsetzens setzten unsere Freunde ihren Weg fort; der Napo aber, der sie zuerst gewarnt hatte, sagte ernst: »Sie haben, was sie verdienten: Cachimana hat ihnen das Schicksal bereitet, das sie uns zudachten, und Jolokiamo wird ihre Seelen in Empfang nehmen!«
AM Fuße des Cayambe vorbei näherten sich die Reisenden der herrlichen Hauptstadt der Provinz Imbabura in Ecuador, Ibarro. Da wurden sie unterwegs noch einmal zu einem mehrwöchigen Aufenthalte gezwungen.
Ursache war das böse Fieber, das zunächst Ulrich darnieder warf, dann aber, während der Jüngling langsam genas, den Professor so heftig schüttelte, daß er lange zwischen Leben und Tod schwebte.
Man sollte es nicht für möglich halten, daß in solcher Not keiner an das »Lebenswasser« dachte, das sich in ihren Händen befand. Und doch: die Fülle wunderbarer Ereignisse und erschütternder Zwischenfälle hatte eine Zeitlang die Erinnerung an diesen kostbaren Besitz aus aller Gedächtnis verwischt.
Wie lange war es doch schon her, daß ihnen dies Geschenk überreicht worden war! Wenn die Erlebnisse sich häufen, werden Wochen zu Jahren. Jeder hielt es seither wohl verwahrt und hatte noch keine Gelegenheit gehabt, seine Zauberkraft zu erproben, sonst wäre es freilich undenkbar gewesen, daß sie die heilkräftige Gabe vergessen hätten.
Mit Schulze schien es zu Ende zu gehen; er sprach im Fieber, und sein Kopf glühte. Alle kalten Wickel wollten nichts helfen, und vergebens wurde die ganze Umgegend nach dem Chinabaume durchforscht.
Trauernd lauschte Friedrich den wilden Fieberworten des älteren Freundes, für den er so gerne das eigene Leben geopfert hätte. Da plötzlich schlugen Worte an sein Ohr, die ihn jäh aufspringen ließen.
»Lebenselixir?« lallte Schulze. »Das ist Schwindel! Da würde sich ja alle Wissenschaft aufhören.«
»Haben wir alle das Gedächtnis verloren?« rief der Jüngling. »Daß wir vergessen konnten, was uns als die wertvollste Mitgift Manoas beständig in der Erinnerung lebendig sein sollte!«
Rasch holte er sein Fläschchen, ließ einen Tropfen seines kristallklaren Inhalts in einen Becher Wasser fallen und flößte dem Fiebernden einen Schluck des geheimnisvollen Trankes ein.
Die Wirkung war wirklich zauberhaft: der Professor wurde ruhig, und seine Bewußtlosigkeit ging in einen tiefen Schlaf über.
Als er nach einer Stunde erwachte, hatte das Fieber merklich abgenommen, und seit mehreren Tagen zum ersten Male zeigte er sich wieder bei klarem Bewußtsein.
Ein zweiter Schluck aus dem Becher erquickte ihn dergestalt, daß er ausrief: »Das ist wahrhaftig ein Lebenswasser! Freunde, ich werde gesund!« Und von nun an machte seine Genesung die raschesten Fortschritte.
Wer beschreibt die Freude seiner Begleiter, als sie sich der bangen Sorge um sein Leben ledig sahen und nun zur ganzen Erkenntnis des wertvollen Besitzes kamen, den sie in Händen hatten.
Schon dachten sie an den Aufbruch, als sie plötzlich in der Nacht von einer Horde Indianer überfallen und gefangen genommen wurden.
Beim Scheine aufblitzender Fackeln erkannten sie ihre Freunde, die Napo, die sich aber finster und durchaus feindselig zeigten.
Dies war folgendermaßen gekommen: Als nach Verlauf von vier Wochen unsere Freunde nicht wieder nach Manoa zurückgekehrt waren, fand es Tupak Amaru an der Zeit, sich nach ihrem Verbleib zu erkundigen. Bei dem vorzüglichen Posten- und Nachrichtendienste, der im Reiche Manoas eingerichtet war, hatte er schon nach drei Tagen die Gewißheit, daß die Weißen seit eben vier Wochen im ganzen Reiche nicht mehr gesehen worden waren. Es blieb ihm daher kein Zweifel, daß ihnen die Flucht geglückt sei, so rätselhaft es ihm auch erscheinen mußte, wie sie ihnen möglich geworden sein könne.
Tupak Amaru war verpflichtet, seinen Vater sofort von dem unerhörten Ereignisse zu verständigen, und dieser sandte unverzüglich Botschaft an Narakatangetu mit dem Auftrag, den Flüchtigen nachzusetzen und sie zurückzuführen, unter allen Umständen aber darüber zu wachen, daß ihnen nicht das geringste Leid zugefügt werde.
Narakatangetu ließ alsbald Tompaipo kommen und teilte ihm den Befehl mit.
»Mein Bruder weiß von der Flucht!« sagte er, da seinen scharfen Augen ein verräterisches Lächeln um die Lippen des Unterhäuptlings nicht entging.
»Tompaipo weiß, was er weiß; allein Inka Manko hat einen Umstand nicht bedacht, der selbst Narakatangetu hindert, seinen Befehl auszuführen.«
»Niemand wird den Roten Papagei hindern können, dem Befehle des großen Inka zu folgen, und wenn Jolokiamo selber es versuchte. Nur wenn der herrschende Kaiser selber einen Gegenbefehl gäbe, wäre Narakatangetu seiner Pflicht entbunden. Tompaipo aber wird Rechenschaft geben müssen, warum er die Flucht nicht hinderte, da er von ihr wußte, und warum er versäumte, seinem Oberhäuptling Anzeige zu erstatten, wie er es hätte tun müssen.«
»Tompaipo wird sich rechtfertigen,« erwiderte Blitzhand kurz und übermittelte gleich darauf seinen Untergebenen den Befehl des Oberhäuptlings, ohne Verzug aufzubrechen und den Spuren der Flüchtigen zu folgen.
Die beiden Indianerlager vereinigten sich zu einem stattlichen Heer; nur Weiber, Greise und Kinder blieben zurück; die andern jagten in Gewaltmärschen den Weißen auf dem von Tompaipo angegebenen Wege nach.
Daß es äußerst fraglich war, ob man sie bei ihrem gewaltigen Vorsprung noch einholen könne, verhehlte sich Narakatangetu nicht; allein das Menschenmögliche mußte versucht werden.
Wir wissen, welcher unfreiwillige Aufenthalt das Unternehmen gelingen ließ und unsere Freunde in die Gefangenschaft der Napo brachte.
Sobald der Anschlag gelungen war, ließ Narakatangetu sich die Gefangenen vorführen. Triumphierend blickte er Tompaipo an; denn es freute ihn, daß er zustande gebracht hatte, was Blitzhand für unmöglich hielt. Dieser aber lächelte still vor sich hin. Er hatte zuvor seine Freunde begrüßt und für die unliebsame Überraschung um Entschuldigung gebeten, zugleich Friedrich erinnert, wie er sich zu verhalten habe.
Als der Oberhäuptling die Gefangenen, die übrigens nicht gefesselt waren, vor sich sah, hub er an: »Die weißen Männer haben unrecht getan. Sie haben Geheimnisse der Napo erkundet, deren Erforschung mit dem Tode bestraft wird. Cachimana weiß, wie sie der gerechten Strafe entgingen und entfliehen konnten. Nun aber werden sie mir folgen zu den großen Richtern.«
»Nein!« erwiderte Friedrich kühn. »Sie werden dir nicht folgen, vielmehr wirst du uns sofort frei lassen, das befehle ich dir!«
Narakatangetu sah den Jüngling verblüfft an, dann aber sagte er spöttisch: »Glaubt der weiße Knabe einen grauen Häuptling der Napo durch törichte Reden einschüchtern zu können? Narakatangetu folgt dem Befehle des Inka Manko.«
»Inka Manko ist längst nicht mehr euer oberster Herr. Ich gebiete dir, uns auf der Stelle frei zu geben, im Namen des einzigen Kaisers, des Sonnensohnes, Tupak Amaru.«
Damit hielt er dem betroffenen Häuptling seine Hand mit dem Schlangenring vor die Augen.
»Bei Cachimana, der Ring der glänzenden Schlange!« mit diesem Ausruf fiel Narakatangetu in höchster Verehrung auf sein Angesicht nieder.
Blitzhand aber sprach: »Tompaipo hat es dem großen Häuptling gesagt, er werde sich rechtfertigen: hier ist seine Rechtfertigung! Diese Weißen sind Brüder des Kapak Inka Intiptschurin, wer darf es wagen, ihnen zuwider zu sein?«
Narakatangetu erhob sich und sagte demütig: »Mein weißer Gebieter verzeihe, was der Rote Papagei unwissend tat. Er hatte Befehl von Inka Manko. Ein Größerer aber steht diesem Befehl entgegen. Meine Brüder mögen in Frieden ziehen, Cachimana wird mit ihnen sein, und wenn sie etwas zu gebieten haben, Narakatangetu ist ihr Knecht.«
»Kehre heim und entbiete unsern Gruß meinem Vater Manko und meinem Bruder Tupak Amaru,« entgegnete Friedrich. »Das Geheimnis der Omagua wird sicher ruhen in unsern verschwiegenen Herzen.«
Tompaipo verabschiedete sich nochmals aufs herzlichste von den Weißen, Narakatangetu aber aufs ehrerbietigste. Dann zogen die Indianer ab, und dieser Zwischenfall war erledigt.
Unsere Freunde brachen bald hernach auf und sahen nach kurzem Marsche die Stadt Ibarro vor sich liegen. Der majestätische 4672 Meter hohe Berg Imbabura umschließt mit seinen steil abfallenden frühlingsgrünen Geländen die Stadt wie mit einem gewaltigen, prächtigen Mantel.
Aber zahlreiche Risse und Spalten im Erdreich erinnern noch an das entsetzliche Erdbeben, das im August 1868 die Stadt fast völlig vernichtete. Und unsere Freunde gedachten der vielen ähnlichen schrecklichen Ereignisse, die wie die Rache des Himmels immer wieder Tausende und aber Tausende der weißen Eindringlinge in schauervoller Weise ums Leben brachten, während die Eingeborenen in ihren leichten Hütten verschont blieben und sich wohl heimlich, oft aber auch ohne allen Hehl, des Verderbens der Räuber ihres Landes freuten.
Während sich Friedrich und Ulrich solchen Betrachtungen hingaben und auch Schulze — aber mehr mit den Augen des Gelehrten — den Erdspalten seine ganze Aufmerksamkeit widmete, erscholl plötzlich eine Stimme:
»Ah, meine Freunde, meine jungen Lebensretter! Welche Überraschung, welches Wunder! So darf ich Ihnen in Ecuador wieder die Hand drücken! Wer hätte das gedacht!«
»Wahrhaftig, Herr Professor Lemaistre!« rief Friedrich aus, den alten Bekannten von Hamburg her freudig begrüßend. »Herr Professor Schulze!« fügte er bei, nachdem Lemaistre auch Ulrich begrüßt hatte und fragend auf den ihm noch nicht bekannten Gelehrten blickte.
»Welches Vergnügen, ein deutscher Kollege! Oh, meine Herren, kommen Sie, seien Sie meine Gäste in Ibarro. Mit der Gradmessung eilt es nicht: sie schreitet langsam genug voran. Es ist ein Jammer, das Volk hat hier kein Verständnis dafür, und die Indianer wittern gar allerlei Gefahren dahinter in ihrem törichten Aberglauben. Ich sage Ihnen, die meisten Signalbauten zu unseren Messungsarbeiten fand ich schon bei meiner Ankunft zerstört, und auf Schritt und Tritt bereitet uns der Unverstand der Bevölkerung und das Mißtrauen der Wilden die unglaublichsten Schwierigkeiten. Daß man aber auch gerade in diesem tollen Lande die Vermessung vornehmen soll! Ein schönes Land im übrigen, ein herrliches Land! Nur daß kein Mensch einen versteht; man sollte Spanisch können, aber, mein Gott! diese Sprache mit ihren rrr und rrrx und xrrr zerreißt einem den Kehlkopf.«
Unter solchen Gesprächen begleitete Professor Lemaistre unsere Freunde in seine Wohnung, wo er sie aufs üppigste bewirtete, während die Lama in Stallungen untergebracht wurden.
»Übrigens was ich sagen wollte. Ich habe Herrn Friedung in Caracas getroffen ...«
»Wie? Was?! Unsern Vater?!« riefen Friedrich und Ulrich wie aus einem Munde.
»Gewiß! Es war ein merkwürdiger Zufall, ich freute mich, ihn kennen zu lernen; aber er war in Verzweiflung, ganz niedergeschmettert: er hatte erfahren, daß das Schiff, mit dem Sie und Ihre Mutter kommen sollten, mit Mann und Maus untergegangen sei. Wie wird er sich gefreut haben, der gute Mann, daß es nicht so war! Aber, wie kommen Sie nach Ecuador?«
»Ach! wir sind ja auf der Suche nach unserem Vater: sagen Sie doch, wo hält er sich auf, wo ist er?«
»Sie suchen Ihren Vater? In Ecuador?!«
»Ja, wir haben uns aus dem Schiffbruch gerettet, dem unsere arme Mutter zum Opfer fiel; da sind wir nun den Orinoko hinaufgewandert und bis an den Amazonas vorgedrungen, fanden aber die Farm unseres Vaters verwüstet, und falsche Nachrichten führten uns in diese Gegend.«
»Ja, ja! Herr Friedung erzählte, seine Farm sei von Rapoindianern verwüstet worden; er fuhr dann den Amazonas hinab und langte im Dezember gleichzeitig mit mir in Caracas an, wo ihn die Nachricht von dem schrecklichen Unglück erwartete. — Und Sie haben diese entsetzliche Reise unternommen?!«
»Gewiß! Aber ums Himmels willen, sagen Sie uns doch, wo ist unser Vater, wie geht es ihm?«
»Als ich von ihm Abschied nahm, reiste er eben nach Nordamerika, den Tod im Herzen. Er sagte, er wolle nun der früheren Einladung eines Freundes, namens Weber, folgen. Dieser Weber besitze eine Farm im Staate Montana, und dorthin wolle er sich zurückziehen, um in der Nähe des Freundes, in der Wildnis als Trapper oder dergleichen sein Leben zu beschließen.«
»Und wo befindet sich diese Farm Webers?«
»Wahrhaftig! da bin ich überfragt! So ein nordamerikanischer Staat ist freilich groß; aber, soviel Herr Friedung sagte, muß der Yellowstone Nationalpark nicht weit von der Farm liegen.«
»Also dorthin!« rief Friedrich. »Endlich haben wir doch eine sichere Spur!«
Nun mußten unsere Freunde noch die Erlebnisse ihrer wunderbaren Reisen berichten; und obgleich sie die Hauptsache verschwiegen und von Manoa und El Dorado kein Wörtlein ausplauderten, dachte der Franzose doch bei sich: »Es ist merkwürdig, welch lebhafte Phantasie diese Deutschen besitzen: Jules Verne kann nicht ärger fabeln, und das alles erzählen sie so treuherzig, als seien es wirkliche Erlebnisse!«
Er war aber zu höflich, seine Gedanken zu äußern und sagte nur, als der Bericht zu Ende war: »Wie Sie doch anschaulich und poetisch zu schildern vermögen, meine Herren! Wahrhaftig, ich glaube mehr und mehr, jeder Deutsche ist ein geborener Dichter — die Gelehrten nicht ausgenommen,« fügte er mit einer geziertigen Verbeugung gegen Schulze hinzu, da dieser auch hier und da seinen Beitrag zu den Erzählungen gegeben hatte.
So sehr Professor Lemaistre die Herren bat, ihm noch einige Tage das Vergnügen ihrer Gesellschaft zu gönnen, so konnte doch nichts mehr Ulrich und Friedrich zurückhalten.
Sie entließen die beiden Napo und schenkten ihnen die Lama und alles entbehrliche Gepäck, kauften sich zwei gute Reitpferde und reisten gleich andern Tags über Quito nach Guayaquil. Hier nahmen sie Abschied von Schulze, der nach der Heimat wollte und sich nur mit größtem Bedauern von den Gefährten trennte, mit denen er so lange Freud und Leid getragen hatte. Den Brüdern wurde der Abschied nicht minder schwer — aber es mußte sein!
Sie telegraphierten nach Puerto Cabello an Herrn Lehmann, daß sie Anfang Juli in Panama eintreffen und sich freuen würden, ihm noch einmal die Hand drücken zu können, wenn es ihm keine Umstände mache, dorthin zu kommen. Dann schifften sie sich mitsamt ihren Pferden und den drei Äffchen, die sie nicht zurücklassen mochten, ein.
Als sie in Panama anlangten, stand Lehmann bereits auf der Landungsbrücke und neben ihm sein Töchterlein, das lebhaft mit dem Taschentuche winkte.
Lehmann bezeugte eine große Freude, daß sie ihm ihre Ankunft angezeigt hatten, und bedauerte nur, daß sie sich nicht länger aufhielten und seine Hacienda nicht wieder besuchen konnten.
»Freilich,« sagte er, »sind die Zustände in Venezuela nicht einladend: ich bin überzeugt, es gibt bald einen großen Krach, und es wird eine schwere Zeit kommen.«
»Und du bist auch mitgekommen?« fragte Friedrich die liebliche Kleine.
»Ja, ich bin gekommen, meine Lebensretter zu küssen,« sagte das Kind und führte dieses Vorhaben auch alsbald mit kindlicher Zärtlichkeit aus.
Lehmann ließ sich nun von seinen jungen Freunden ihre merkwürdigen Schicksale erzählen, soweit Manuel sie ihm nicht hatte berichten können.
»Ich war immer in großer Sorge um Sie,« sagte er, »zumal, nachdem ich von Manuel erfuhr, welche Gefahren Sie schon in Nueva Valencia und Calabozo überstanden.«
Er konnte nicht genug staunen über die Abenteuer, die sie im Urwald erlebt hatten, und namentlich über die Wunder des Amazonenreiches. Doch auch er sollte nichts von Manoa und El Dorado erfahren; denn unsere Freunde wollten das Geheimnis der Omagua strengstens wahren.
Schon am folgenden Tag hatten sie Gelegenheit, sich nach San Francisco einzuschiffen, und trotz der Freude, Herrn Lehmann wiedergesehen zu haben, war ihnen dies lieb; denn sie sehnten sich danach, ihren Vater endlich zu finden.
AUCH in San Francisco hielten sich die Brüder nicht auf. Sie begaben sich sofort mit der Bahn nach Idaho, und da sie keinen anderen Anhaltspunkt hatten, als daß sich Webers Farm in der Nähe des Yellowstoneparks befinde, an der Grenze des Staates Montana, beschlossen sie, in Camas die Bahn zu verlassen und ihre Pferde wieder zu besteigen, die sie auch auf der Bahn mitgenommen hatten.
Sie ritten auf den Henryfluß zu und dann an diesem hinauf in den berühmten Park, und hatten sie nach dem, was sie in Venezuela, Brasilien und Colombia geschaut hatten, gemeint, es gäbe keine Naturwunder mehr, die ihnen Überraschung zu bieten vermöchten, so enttäuschte sie der mehrere Tage dauernde Ritt durch den einzigartigen Nationalpark aufs angenehmste; denn hier schien die Natur alles vereinigt zu haben, was sie an Lieblichem, Großartigem und Sonderbarem überhaupt aufzuweisen hat.
Die erfreulichste Überraschung aber sollte ihnen am letzten Tage ihrer Reise durch den Park zuteil werden.
In einem blühenden Wiesengrunde sahen sie an diesem Tage zwei Reiter und zwei Reiterinnen vor sich her traben.
Als sie näher kamen, hörten sie, daß diese sich in deutscher Sprache unterhielten.
»Die schönen Tage von Aranjuez sind nun zu Ende, Prinzeß!« sagte einer der Herren.
»Oho, Ernst!« erwiderte die Angeredete mit etwas englischem Klang. »So schön die Tage in meinem geliebten Parke waren, so sehne ich mich ordentlich nach unserer Farm und vor allem nach unsern Kindern zurück: dort fühle ich mich als Königin, wenn ich hier nur Prinzeß bin.«
»Johanne hat recht,« begann die andere Dame, die offenbar eine echte Deutsche war. »Mir geht es ebenso wie ihr.«
»Dann machst auch du Anspruch darauf, Königin zu sein, verehrte Herrin?« sagte der zweite Reiter mit lustigem Lachen.
»Warum nicht?« antwortete Johanne für sie. »Martha ist Königin in ihrem Reiche wie ich in dem meinen; ich glaube gar, sie versteht das Herrschen noch besser als ich. Übrigens kann es für die Herren der Schöpfung nur schmeichelhaft sein, wenn sich ihre Gattinnen als Königinnen fühlen, denn sie selber besitzen demnach die Königswürde!«
»Wenn sie nicht bloß Prinzregenten sind!« meinte Marthas Gatte heiter.
Erst jetzt bemerkten die lebhaft Plaudernden die nahenden jungen Reiter, da auf dem weichen Rasenboden der Hufschlag der Pferde wenig vernehmbar war.
»Heda! Zwei echte sonnengebräunte Cowboys!« rief der als »Ernst« bezeichnete Herr. »Kommt ihr aus der Steppe, oder von den Bergen, oder hat das Lagerfeuer der Indianer eure Gesichter so verbrannt?«
Obgleich er selber die Fremden deutsch angeredet hatte, war der Sprecher doch sichtlich verblüfft, als seine Worte nicht bloß verstanden, sondern auch in tadellosem Deutsch erwidert wurden.
»Die Sonne des Äquators hat den Bleichgesichtern die Farbe der Napo verliehen,« rief nämlich Friedrich, auf den heitern Ton eingehend.
»Beim großen Geist aller Rothäute, da habt ihr einen weiten Ritt hinter euch,« lachte der andre der Herren, der diese Behauptung für einen Scherz hielt. »Und die drei hübschen Affen habt ihr wohl im Kampfe besiegt und führt sie nun in die Sklaverei? Aber mit Verlaub, wenn wir den gleichen Weg haben, dürften wir uns kennen lernen. Wie heißen unsere Brüder von jenseits des Panamakanals?«
»Ulrich Friedung — Friedrich Friedung,« erscholl es von den jugendlichen Lippen.
Erstaunt sahen die andern einander an. Dann ergriff einer der Herren das Wort.
»Ich heiße Karl Weber, dies ist mein Bruder Ernst, hier meine Frau Martha, und dort meine Schwägerin Johanne.«
»Weber?!« riefen beide Jünglinge gleichzeitig. »Sagen Sie uns bloß, kennen Sie unsern Vater? Lebt er noch? Wie geht es ihm?«
»Mein Freund Friedung wohnt in unserer Nähe,« erwiderte Ernst Weber, »es geht ihm gut; aber euer Vater kann er nicht wohl sein, denn seine beiden einzigen Söhne, die allerdings merkwürdigerweise Ulrich und Friedrich hießen wie ihr, fielen einem Schiffbruch zum Opfer.«
»Ach, wir sind ja gerettet! Unsere arme Mutter freilich ist in den Wellen umgekommen!«
Wieder sahen sich die beiden Ehepaare an, und Karl flüsterte seinem Bruder etwas zu, der es dann an die Frauen weiter gab.
»Wenn Friedung also euer Vater ist und ihr seine totgeglaubten Söhne,« nahm Ernst wieder das Wort, »dann segne Gott diesen Tag. Niemals, seit meine Johanne mir im Urwald ihr Jawort gab, erlebte ich eine solche Freude. Mein Gott, welche Wonne, wenn ich dem armen Freunde dieses Glück verkünden darf, oder wenn ihr gleich selbst kommt und wieder Sonnenschein auf sein Antlitz zaubert! Und solche stattlichen, wackeren Söhne! Laßt euch umarmen, Burschen!« Und er umarmte sie stürmisch, und sein Bruder folgte seinem Beispiel.
»Aber wie kommt ihr in den Nationalpark, wenn ihr euren Vater sucht?« forschte Karl Weber.
»Ach! wir vernahmen nur durch einen französischen Professor Lemaistre in Ecuador, daß unser geliebter Vater, den er in Caracas traf, der Einladung seines Freundes Weber nach Montana gefolgt sei, und daß die Farm dieses Weber in der Nähe des Yellowstoneparkes liege; so ritten wir denn durch den Park nach Montana.«
»Da hättet ihr noch lange suchen können, wenn des Schicksals Fügung euch nicht in unsere Arme geführt hätte. Unsere Farmen sind von hier noch weit entfernt, und niemand hätte euch in der Umgegend Auskunft geben können, wo die entlegenen Hütten zu finden seien!«
»Ach, nun ist ja alles gut!« sagte Friedrich.
Unsere Freunde mußten nun auch den neuen Bekannten einen Abriß ihrer Erlebnisse mitteilen, während die weite Strecke bis Bozeman zurückgelegt wurde. Von dort ging es mit der Bahn nach Jocko Agency und dann wieder zu Pferd gegen den Flatheadsee, in dessen Nähe sich die benachbarten Farmen der Brüder Weber befanden. An Unterhaltung fehlte es unterwegs nicht; die Damen besonders hatten auch an den reizenden Äffchen ihre helle Freude.
Die ganze Reise nahm mehrere Tage in Anspruch; und da Ernst Webers Farm erst spät abends erreicht wurde, mußten die Jünglinge das Anerbieten annehmen, dort zu übernachten. Sie konnten zwar ihre Ungeduld kaum mehr zügeln; aber der Weg zu Friedungs Niederlassung betrug noch etwa vier Stunden, und sie hätten ihn allein nicht finden können, mochten auch nicht mitten in der Nacht ihren Vater überraschen.
Karl und Martha hatten noch eine kleine Strecke zu reiten, bis sie ihr Wohnhaus erreichten. Sie versprachen, morgen in aller Frühe mit den Kindern herüberzukommen, und verabschiedeten sich für heute.
Es war ein stattliches Blockhaus, vor dem Ernst Weber seine jungen Freunde einlud, abzusteigen. Johanne war bereits aus dem Sattel gehüpft und eilte ihren Kindern entgegen, die zu zweit unter die Türe gerannt kamen: ein etwa sechsjähriges Mädchen und ein vierjähriger Knabe, beide mit hellbraunen Lockenköpfchen, das Mädchen mit blauen, der Knabe mit treuherzigen braunen Augen. Nachdem die lieblichen Kinder auch den Vater umarmt hatten, reichten sie auch den Jünglingen aus eigenem Antriebe die Händchen. Sie schauten wohl verwundert in die fremden Gesichter, aber ohne die Scheu, die man bei solchen in der Wildnis aufgewachsenen Kleinen wohl hätte erwarten dürfen.
Kaum hatte Johanne ihr Reitkleid gegen einen bequemen Hausrock vertauscht, so zeigte sie sich als emsig besorgte Hauswirtin, die es verstand, ohne viel Umherlaufen und Aufregung ihrem Manne und ihren Gästen die gemütlichste Behaglichkeit zu verschaffen, so daß sich die Jünglinge wirklich wie zu Hause fühlten.
Es war aber auch reizend, dieses Familienleben, das sich in seiner liebewarmen Natürlichkeit durch die Anwesenheit willkommener Gäste in nichts behindern ließ. Die Kinder lachten und plauderten und spielten jauchzend mit den kleinen zahmen Affen; die Hausherrin ging ab und zu, um nach der mehrwöchigen Abwesenheit überall nach dem Rechten zu sehen, das Mahl zu bereiten, sowie die Schlafstätte der Gäste instand zu setzen. Dazwischen fand sie jedoch immer Zeit, ihr Interesse an den geführten Gesprächen zu betätigen. Der Hausvater aber widmete sich mit aller Wärme seinen Gästen, ohne jedoch seine wohlerzogenen Sprößlinge zurückzuweisen, wenn sie zwischenhinein mit einer Frage oder einem kleinen Anliegen kamen.
Mit den fremden Herren hatten die Kinder, Karl und Johanna, bald Freundschaft geschlossen; denn die verstanden es prächtig mit ihnen, und bald wiegte jeder von ihnen eines auf seinen Knien, und Friedrich erzählte den hoch auflauschenden Kleinen die »Märchen« vom Smaragdberg und vom Sonnenvogel Quezal, vom vergoldeten König und dem wunderbaren Schlangenring.
Die Abendmahlzeit war einfach, aber sie mundete köstlich; dann wurden die Kinder zu Bett gebracht, während die Eltern noch bei einer Tasse Tee mit den lieben Gästen plauderten, wobei die Herren aus kostbar geschnitzten Indianerpfeifen in einem Maße qualmten, daß Frau Johanne sagte, sie sei nur froh, daß es in ihrem »rohen« Blockhause keine Gardinen gebe.
Mit der »Roheit« des Hauses war es übrigens nicht weit her; denn Decke und Wände waren reichlich mit wertvollen Waffen und Pfeifen, grimmigen Tierköpfen, ausgestopften Vögeln, Hörnern und Geweihen geschmückt, wiesen auch hier und da kunstvolle Schnitzereien auf — so daß man wenig von den nackten Balken zu sehen bekam.
Am andern Morgen standen unsere Freunde in aller Frühe auf, noch ehe die Sonne die Wipfel des nahen Urwaldes vergoldete. Aber schon kamen Karl und Martha über den mit Pfahlwerk umzäunten Hof; voran sprangen zwei goldlockige, wunderliebliche Kinder, ein Knabe von vier und ein Mädchen von etwa zwei Jahren, Ernst und Martha genannt.
Hintendrein schritt rüstig, wenn auch gemessener, ein alter Herr mit stattlichem, weißen Schnurrbart. Diesem hochgewachsenen Greise sah man den Major oder General im Ruhestand von weitem an, ja, man hätte ihn für den alten Blücher halten können, so ähnlich sah er den Bildern des berühmten Feldmarschalls.
Martha stellte den Jünglingen ihre Kinder und ihren Vater, Major von Seldau, vor; dann drehte sich das Gespräch nur noch um Friedung, den allseits geliebten Nachbarn; jedoch kam es sowohl Friedrich als Ulrich vor, als werde ihnen irgend etwas verschwiegen: manchmal stockte das Gespräch plötzlich, während ein geheimnisvolles Lächeln über die Gesichter huschte.
Allein sie waren viel zu aufgeregt in der freudigen Erwartung, ihren Vater heute wiederzusehen, als daß sie daran gedacht hätten, sich über solche Anzeichen den Kopf zu zerbrechen.
Kaum daß sie noch ein kleines Frühstück genossen hatten, dann baten sie, man möchte ihnen den Weg zu des Vaters Farm weisen.
»Ich begleite Sie natürlich!« sagte Ernst Weber.
»Oh,« seufzte Johanne, »könnte ich nur dieses Wiedersehen belauschen! Aber in den nächsten Tagen kommen wir alle auf Besuch zu Ihnen, und dann muß sich ein lebhafter Verkehr zwischen unseren Farmen entspinnen; bisher hatten wir gar zu wenig von Herrn Friedung. Sein Schmerz machte ihm die Einsamkeit angenehmer, als uns lieb war.«
Noch ein letztes Winken, und die Reiter verschwanden im Urwald.
DURCH den Wald war ein Weg gebahnt, auf dem unsere Freunde so schnell dahinritten, daß sie in weniger als drei Stunden die Lichtung erreichten, von der aus man eine reizende Aussicht auf den Flatheadsee genoß. An seinen Ufern zeigte sich ein ausgedehntes, umzäuntes Gut, dessen Grenzen nicht zu überschauen waren. Der Urwald war hier erst in der Ausrodung begriffen, gefällte Riesenstämme lagen zu Hunderten umher; da und dort sah man ganze Reihen verkohlter Baumstümpfe, und nur ein ganz kleines Stück Land war schon zum Anbau umgebrochen.
»Hier ist Friedungs Farm,« sagte Ernst Weber, kaum seiner Rührung Herr werdend, und wies auf ein stattliches Blockhaus. »Reiten Sie nur darauf los: das erste Wiedersehen braucht keine Zeugen, so gut befreundet mir Friedung schon seit Jünglingsjahren ist. Ich jage ein Wild, und in zwei bis drei Stunden lade ich mich zum Mittagsmahle ein.«
Damit lenkte er sein Pferd ins Gebüsch.
Hochklopfenden Herzens sprengten die Jünglinge dem Pfahlzaun zu, der den Hofraum der Farm umgab. Das Tor stand offen. Sie sprangen aus den Sätteln, banden die Pferde an zwei Pfosten fest, und dann eilten sie dem Wohngebäude zu mit dem Rufe: »Vater, Vater!«
Und siehe da! Ein stattlicher Mann erschien unter dem Haustor, mit der Hand die Augen gegen die blendenden Sonnenstrahlen schützend. Zuerst schaute er verwundert nach den Ankömmlingen, dann starr, mit aufgerissenen Augen, als sehe er Gespenster. Aber schon hingen die Knaben jubelnd und weinend an seinem Hals. »Vater, Vater! Endlich haben wir dich wieder!«
Friedung war anfangs keines Wortes fähig. Er umarmte und küßte nur wieder und wieder die wiedergefundenen Söhne, während auch ihm die hellen Tränen über die Wangen liefen. Dann richtete er die Blicke gen Himmel und schickte ein stilles, inniges Dankgebet empor. Nun erst fand er die Sprache wieder. »O meine lieben, lieben Söhne, ihr längst als tot Beweinten! Ihr seid mir wahrhaftig von den Toten erweckt! Welches unaussprechliche Wunder, welches Glück in meinem Unglück! — Ach,« fügte er nach einer Pause hinzu, »daß ich gleich einen Schatten auf eure sonnige Freude werfen muß! Ihr trefft mich als einen, der im Begriffe war, seine letzte Erdenfreude zu begraben: eure Mutter liegt im Sterben!«
»Unsere Mutter?!« riefen beide Jünglinge, sich voll jähen Erstaunens aus seinen Armen losreißend. »Großer Gott! Was ist das? Sie ist doch bei unserm Schiffbruch untergegangen?!«
»Nein, nein, Kinder! Sie wurde gerettet; aber nur, um mir allzubald wieder entrissen zu werden.«
Im nächsten Augenblick standen die Söhne tief erschüttert am Bette der sterbenden Mutter. Ein Freudenglanz erleuchtete ihr fieberglühendes Antlitz. Der Anblick ihrer betrauerten Kinder sagte ihr in einem Augenblicke alles, und es bedurfte keiner Worte. Solche hätte auch keiner der Anwesenden gefunden vor Schluchzen und Weinen. Wie nahe liegen doch Glück und Unglück beieinander!
Jetzt begriffen Ulrich und Friedrich das geheimnisvolle Wesen Webers und der Seinigen: das Wiederfinden ihrer Mutter sollte ihnen eine Überraschung sein. Freilich, daß es eine traurige Überraschung wurde, ahnten Webers nicht; denn erst vor wenigen Tagen hatte das heimtückische Fieber Frau Friedung überfallen.
»Weinet und klaget doch nicht,« sagte die Kranke mit schwacher Stimme. »Oh, wie zufrieden scheide ich jetzt aus dem Leben, nachdem ich diese Freudenstunde erlebte, — wenn ich auch gerne noch bei euch bliebe; aber es geht zu Ende!« Sie war die Gefaßteste von allen.
»Mutter, du darfst nicht sterben!« rief Friedrich mit plötzlich erwachender Hoffnung. »Mit Gottes Hilfe wirst du genesen. Gott wollte uns gewiß nicht neu vereinigen, um uns so bald wieder zu trennen!«
Zugleich zog er das Kristallfläschchen hervor, das ihm der alte Inka Manko gegeben hatte, und das er immer bei sich trug, seit er es damals zu Schulzes Heilung aus seinem Gepäck hervorgeholt hatte. »Vater,« sagte er, »bringe rasch ein Glas Wasser! Ich habe hier ein wunderbares Mittel — wer weiß, es möchte helfen?«
Friedung schüttelte den Kopf, er hielt jede Hilfe für ausgeschlossen; dennoch beeilte er sich, der Bitte des Sohnes nachzukommen. Friedrich ließ nur einen Tropfen in das Wasser fallen, aus Sorge, der Trank könnte sonst für die Entkräftete zu stark werden.
Frau Friedung nahm einen Schluck der Arznei. »Ah! das kühlt, ah! das ist köstlich! »flüsterte sie; dann sank sie zurück, schloß die Augen und verfiel in Schlummer.
»Das ist eine Wohltat,« sagte Friedung freudig erstaunt. »So fest und ruhig hat sie seit Tagen nicht mehr geschlafen.« Neue Hoffnung belebte ihn, und er vermochte es jetzt, die Fragen seiner Söhne zu beantworten.
»Als meine Farm in Brasilien von heimtückischen Napo ohne jede Veranlassung meinerseits zerstört wurde,« erzählte er, »wäre ich ohne Zweifel selber den Mordbrennern zum Opfer gefallen. Aber ein Häuptling der Napo, Tompaipo mit Namen, warnte mich zuvor und ermöglichte mir daher, mein Leben und meine wertvollsten Güter zu retten. Das meiste freilich steckte in meinem Rancho. Als ich diesen später wieder heimlich aufsuchte und ihn völlig verwüstet fand, entschloß ich mich, eure Ankunft in Caracas abzuwarten und mich dann mit euch nach Nordamerika zu begeben.
»Schon früher hatte mir mein Jugendfreund Ernst Weber Lust machen wollen, zu ihm zu kommen; allein mich zog es mehr nach Südamerika. Nun wollte ich euch aber doch in eine weniger gefährliche Umgebung bringen; auch hatte ich zu Weber das Zutrauen, daß er mir in jeder Beziehung treu zur Hand gehen werde; denn er hatte Glück mit seinen Unternehmungen, ich aber besaß kaum mehr so viel, um die Reise nach Montana zu bestreiten.
»Ich fuhr den Amazonas hinab und dann übers Meer nach Caracas. Dort vernahm ich die lähmende Botschaft von dem Schiffbruch, und eingetroffene Nachrichten ließen mir keinen Zweifel, daß ihr euch eben auf dem verlorenen Schiffe befunden hattet. Völlig gebrochen unternahm ich nun allein die Reise nach Montana, um mich hier in der Wildnis zu vergraben.
»Wer beschreibt aber meine Freude, als ich auf dem Wege nach New-York in San Domingo eure Mutter fand. Sie war beim Schiffbruch in ein Rettungsboot gelangt, das aber am Felsenriff von Punta Brava, einer öden Insel, zerschellte. Alle Insassen fanden ihren Tod in den Wellen, sie allein wurde auf das Riff geschleudert, wo sie lange besinnungslos lag; mehrere Tage mußte sie auf der kleinen Insel ausharren, ihr Leben kümmerlich durch den Genuß von Austern fristend, bis endlich ein vorbeisegelndes Schiff ihre Notzeichen bemerkte und die Halbverhungerte aufnahm. Der Segler konnte seinen Kurs nicht ihretwegen ändern und landete sie daher auf San Domingo, wo sie sich mit dem Nötigsten versehen konnte, da sie Geld bei sich trug. Sie wartete auf eine Gelegenheit, sich nach Venezuela einzuschiffen, als ich eintraf und sie auf der Landungsbrücke fand.
»Sie erzählte mir, wie sie euren Untergang mit eigenen Augen habe ansehen müssen, als ihr vom Strudel des untersinkenden Schiffes verschlungen wurdet. Sie habe danach eigentlich auf den Tod gehofft, und nur der Gedanke an mich habe ihr Kraft gegeben, weiterzuleben.«
Friedrich und Ulrich berichteten nun ihrerseits in aller Kürze, wie sie den Wellen entrannen, und wie sie das Zerschellen des Bootes beobachteten, in dem sie ihre Mutter wußten, so daß sie an ihrem Tode nicht zweifeln konnten. Auch von den Mestizen und ihrem Anteil an der Zerstörung von Nueva Esperanza erzählten sie.
Aufs höchste erstaunt war der Vater, als er erfuhr, daß Blitzhand, sein edler Warner, ein biederer Schwabe sei.
»Und niemals,« sagte Friedrich, »hat der bescheidene Napohäuptling auch nur ein Wort davon zu uns gesagt, welches Verdienst er selber um die Rettung unseres Vaters hatte!«
Inzwischen war Frau Friedung erwacht und lauschte gespannt den Berichten ihrer Söhne. Friedrich bemerkte zuerst, daß sie nicht mehr schlummerte; er eilte an ihr Lager. »Wie fühlst du dich, liebes Mütterlein?«
»Es ist mir, als ob eine ganz neue, frische Lebenskraft meine Adern durchrinne; ich weiß nicht, ist es die Freude oder der Heiltrank — aber jetzt glaube ich, daß ich noch einmal gesund werde!«
Diese frisch gesprochenen Worte erhöhten die Hoffnung der Ihrigen. Frau Friedung nahm noch einen Schluck des köstlichen Lebenswassers, und als bald darauf Weber eintrat, fand er alle in fröhlicher Stimmung.
Mit lebhaftem Bedauern hörte er von Frau Friedungs schwerer Erkrankung, versicherte aber auch, man sehe ihr an, daß sie sich auf dem Wege der Genesung befinde.
»Ich habe mir übrigens gedacht,« sagte er, »daß die Herrschaften in der Freude des Wiedersehens und bei der Fülle von Mitteilungen, die sie einander zu machen haben, die Vorbereitungen zum Mittagsmahl vergessen könnten, und so habe ich gleich das Wild, das ich erbeutete, über einem Feuer gebraten. Brot und ein frischer Trunk wird ja zu haben sein: also bitte ich, meine Herrschaften, lassen Sie uns schmausen. Ich habe einen Wolfshunger, und die jungen Herren werden unter dem Äquator auch gelernt haben, einen Wildbraten ohne Umstände und ohne viele Beilagen als köstliches Festmahl für den hungrigen Magen zu betrachten.«
Er hatte recht, und beim Anblick des saftigen Bratens regte sich bei allen der bisher vergessene Hunger; sie griffen denn wacker zu, nachdem Friedung herbeigeschafft hatte, was sein Speiseschrank zum Mahle beisteuern konnte.
NACH beendigter Mahlzeit verabschiedete sich Ernst Weber mit dem Versprechen, in den nächsten Tagen mit seinem Bruder, den Frauen und Kindern zu erscheinen, wenn Friedung ihm durch einen Knecht günstige Nachricht über das Befinden seiner Gattin sende. Andernfalls werde er Johanne zur Pflege herausschicken.
»Ein edler Mensch, ein wahrhaft treuer Freund!« sagte Friedung, als Weber sich entfernt hatte. »Ja, meine Kinder! Mein ganzes Besitztum verdanke ich seiner Freundschaft. Ich gedachte, als Trapper mein Leben zu fristen und nur eine geringe Summe von ihm zu entlehnen, um mir eine Hütte zu bauen und die nötigen Gerätschaften anzuschaffen. Er aber hat mir ein ganzes Vermögen förmlich aufgedrängt, damit ich gleich eine Farm im großen betreiben könne. — Diese Schuld ist jetzt das einzige, was mich noch bedrückt. Ich weiß ja wohl, er denkt nicht daran, er hätte mir am liebsten die Summe geschenkt, wenn er nicht gewußt hätte, darauf würde ich nie eingehen. — Aber eben der Gedanke, einem so treuen Freunde so viel zu schulden, ist mir peinlich. Wie lange wird es währen, bis meine Farm überhaupt nur völlig angelegt ist und die Felder alle angebaut sind, die der Urwald noch bedeckt! Von einem Ertrage, der mir eine Abzahlung an meiner Schuld ermöglichen könnte, kann in den nächsten Jahren noch gar nicht die Rede sein: alles muß für unsere Bedürfnisse und die Rodungsarbeiten verwendet werden. Doch wie undankbar ich bin, daß solch kleinliche Sorgen mir an einem solchen Freudentage noch in den Weg kommen können!«
Friedrich und Ulrich sahen einander lächelnd an: sie wußten, daß sie die Mittel besaßen, innerhalb weniger Stunden ein Vermögen zu beschaffen, mit dem ihr Vater seine Schuld tausendfach heimzahlen konnte. Doch sie wollten ihn damit überraschen.
Der Mutter Genesung machte unglaublich rasche Fortschritte; schon am dritten Tage nach der Rückkehr ihrer Söhne konnte sie das Bett verlassen.
Inzwischen hatten unsere Freunde Zeit gefunden, so ziemlich alle ihre Erlebnisse, wenigstens im wesentlichen, den Eltern zu erzählen; nur von der Verwandlung der Metalle hatten sie noch kein Wort gesagt.
Heute aber sollte Friedung auch seiner Geldsorgen ledig werden.
»Paß einmal auf, Vater!« sagte Friedrich. »Heute sollst du etwas erleben!«
Dann wurde zusammengesucht, was die Farm an geeigneten Geräten besaß, und ein Zinnteller eingeschmelzt, trotz Frau Friedungs Einspruch.
»Ich besitze hier nichts als Holzteller,« sagte sie. »Die zwei einzigen Zinnteller, die ich habe, sind für mich ein wahrer Schatz, der Stolz meiner Haushaltung!«
»Ach was, Mutter!« sagte Ulrich. »Ich verspreche dir, du wirst tausend für einen kaufen können.«
Frau Friedung gab schließlich nach, neugierig, was da werden sollte. Aber was sie sah, sollte sie und noch mehr ihren Gatten in das höchste Erstaunen setzen. »Man glaubt sich ja in einem Märchen!« rief Friedung aus, als das Zinn, in lauteres Gold verwandelt, aus dem Tiegel erstand. Da wurde es draußen laut: die beiden Familien Weber waren eingetroffen.
»Oho!« rief Karl Weber im Eintreten lachend. »Da scheinen wir unter Alchimisten geraten zu sein!«
»Wahrhaftig!« fügte Major von Seldau bei. »Sie suchen wohl nach dem Stein der Weisen?«
»Wir suchen ihn nicht, wir haben ihn!« sagte Friedrich. »Hier dieses Lebenselixir hat meiner lieben Mutter die Gesundheit wiedergegeben.«
»Und hier,« sagte Ulrich, triumphierend einen leuchtenden Goldklumpen emporhebend, »hier haben wir soeben Zinn in Gold verwandelt!«
Die Besucher, die anfangs glaubten, es handle sich um einen Scherz, mußten sich bald überzeugen, daß hier tatsächlich eine Umwandlung der »Elemente« stattgefunden habe.
»Da haben Sie ja eine unerschöpfliche Quelle des Reichtums,« meinte Ernst Weber. »Sie können in einem Tage mehr Schätze anhäufen als unsere berühmten amerikanischen Milliardäre alle miteinander im Laufe ihres ganzen Lebens!«
»Aber gehen Sie vorsichtig um mit Ihrer Kunst,« ermahnte Karl, »insbesondere verraten Sie das Geheimnis keinem Menschen, sonst hätte es bald seinen Vorteil für Sie verloren, weil eine völlige Entwertung des Goldes die Folge sein müßte.«
»Dafür ist gesorgt,« erwiderte Friedrich, »wir haben nämlich selber keine Ahnung von dem Geheimnisse. Wir erhielten nur eine gewisse Menge des Alchimistenpulvers, die allerdings hinreicht, uns zu den reichsten Menschen der Welt zu machen, die aber doch nicht unerschöpflich ist. Da aber uns selber so wenig wie unsern Eltern am Besitze irdischer Reichtümer an und für sich viel gelegen ist, werden wir das kostbare Pulver zu Rate halten und uns jederzeit wohl überlegen, wie wir den besten Gebrauch davon machen können, damit das Gold, das so vielen zum Fluche wird, mit Gottes Hilfe in unsern Händen zu einer wirklichen Segensquelle werde für viele.«
»Brav, mein Sohn!« lobte Friedung. »Ich sehe, meine Kinder haben meine Grundsätze nicht vergessen.«
»Und bei solchen Grundsätzen wird der Besitz euch glücklich machen, indem er Glück spendet,« fügte Ernst Weber bei. »Der Reiche, der das Gold nur als Mittel zum Wohlleben ansieht, betrügt sich um sein eigenes Glück: nur ernste und stetige Arbeit und das Ringen nach edlen Zielen, die in der Ewigkeit gipfeln, gibt dauernde Befriedigung.«
IN der nächsten Zeit halfen Ulrich und Friedrich ihrem Vater fleißig bei der Urbarmachung des Gutes; mit frischen Kräften machte sich Friedung an die Arbeit, da seine Frau bald völlig genesen war und er sich nun auch eines schuldenfreien Eigentums erfreute. Vor allem aber wurde seine Arbeitsfreudigkeit dadurch gehoben, daß er nun seine so lange betrauerten Söhne als Mitarbeiter bei sich hatte.
Mit den Weberschen Farmen wurde ein lebhafter, stets genußreicher und anregender Verkehr gepflogen.
Eines Tages lief ein Brief von Schulze ein, und zwar aus Ostafrika: das war eine Freude!
Der Professor schrieb unter anderm: »Obgleich ich, aus heiliger Dankbarkeit gegen unsere Freunde in Manoa, von unserer ganzen El-Dorado-Wissenschaft kein Wörtlein sagte, fand ich doch auch mit meinen viel weniger wunderbaren Berichten über die Amazonen und das ›Fabeltier‹ einfach keinen Glauben bei meinen Kollegen; die Amazonensteine erregten zwar Aufsehen, galten aber nicht als Beweisstücke. Man hielt mich für einen Schwindler: geschieht mir ganz recht! Ich selber krankte ja früher an der gleichen wissenschaftlichen Zweifelsucht. Hätte ich wenigstens den Schädel des Drachen mitgenommen! Aber den hatten Sie allzugut unter den Felsblöcken begraben! Na! in der Verzweiflung reiste ich nach Afrika, und ich sage Ihnen, ich habe da Dinge erlebt, die trotz Manoa noch wunderbar genug waren. Könnte einen ganzen Band darüber schreiben, erzähle es Ihnen aber lieber mündlich, denn ich komme mal zu Ihnen, und zwar bald: Sie werden ja meinen Berichten Glauben schenken, und überhaupt sehne ich mich nach Ihnen. Dann aber geht es wieder in die Urwälder am Orinoko — vielleicht bis Manoa; oh, wenn Sie mitgingen!«
Die Aussicht auf Schulzes Besuch erregte allgemeine Freude, Herr und Frau Friedung, sowie Webers hatten den edelsinnigen Gelehrten aus den Erzählungen der Jünglinge herzlich liebgewonnen.
Hier und da wurde die Arbeit auf längere Zeit unterbrochen: da unternahmen Friedungs, oft in Gemeinschaft mit Webers, weitere Reisen und erforschten die Wunder der entfernteren Umgegend. Inzwischen reifte ein Plan, den Friedrich schon lange im stillen gehegt hatte.
Um ihre reichen Mittel nutzbringend anzulegen, wollten die Brüder den Republiken Venezuela und Kolombia das große, noch unerforschte Gebiet abkaufen, das sich vom Orinoko bis zu den Anden hinzieht und von dem Meta, dem Vichada und dem Guaviare mit ihren Zuflüssen durchströmt wird.
Der neuen Kolonie sollte eine patriarchalische, gesunde Verfassung auf christlicher Grundlage, jedoch mit möglichster Wahrung der persönlichen Freiheit gegeben werden. Auf eigene Kosten wollten sie an den geeignetsten Stellen Städte und Dörfer gründen und Ansiedler, namentlich aus Deutschland, heranziehen, die sich freiwillig auf die Verfassung verpflichten wollten. In vielen Punkten sollten den Gesetzen die Einrichtungen des alten Inkareiches zum Vorbild dienen. Als Ansiedler waren besonders solche Leute vorgesehen, die unverschuldet in Unglück geraten waren, oder die trotz allen Fleißes in der Heimat ihr Auskommen nicht fanden. Aber auch schuldbelastete Gewissen sollten hier eine Zuflucht finden, falls es ihnen darum zu tun war, unter günstigen Verhältnissen und brüderlicher Teilnahme ein neues Leben anzufangen.
Die strengen Bestimmungen über die gemeinsamen Arbeitspflichten, ähnlich wie im alten Sonnenreiche Tahuantinsuyu, sollten die faulen und unruhigen Elemente fernhalten oder zu edleren Zielen führen.
Vielleicht gelang es auch späterhin, freundliche Beziehungen zu Manoa anzuknüpfen und so auf friedlichem Wege das schöne Ziel anzubahnen, das sich die alten Inka dort oben gesetzt hatten.
Diese Pläne sollten nun so bald als möglich verwirklicht werden. Da Webers von den berückenden Gedanken ganz eingenommen waren, beschlossen sie, gleich Friedungs ihre Farmen an mittellose tüchtige Einwanderer abzugeben und sich im »Paradies der Zukunft« niederzulassen.
Schulzes Besuch wurde noch abgewartet; dann reiste Ernst Weber mit Ulrich nach Kolombia und Venezuela, um dort die Ankäufe und Verträge abzuschließen. Schulze aber und Friedrich kehrten in die deutsche Heimat zurück, wo sie geeignete Familien aussuchten, die das Glück des neuen Staates begründen helfen und selber dort ein glückliches Dasein finden sollten.
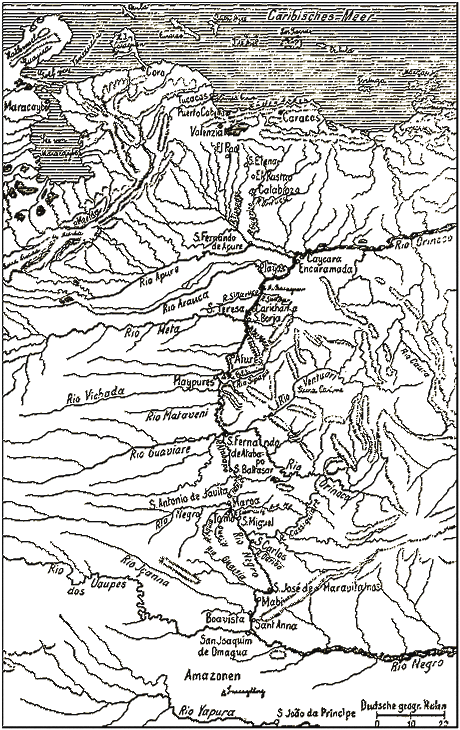
Karte zu Ulrich und Friedrich Friedungs Reise. Kapitel 7 bis 47.

Karte zu Ulrich und Friedrich Friedungs Reise. Kapitel 48 bis 77.
»DARUM mäßigen wir uns, üben wir die Resignation, daß wir auch die teuersten Probleme, die wir aufstellen, doch immer nur als Probleme geben, daß wir es hundert und hundertmal sagen: Haltet das nicht für feststehende Wahrheit, seid darauf vorbereitet, daß es vielleicht anders werde; nur für den Augenblick haben wir die Meinung, es könne so sein.«
(Rud. Virchow: »Über die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat.«)
ALS das Orakel zu Delphi den Sokrates für den weisesten aller Männer erklärt hatte, wurde der bescheidene Weise beinahe irre an der Autorität des Orakels; denn er sagte sich, daß er weder im Großen noch Kleinen weise sei, sondern so gut wie nichts wisse. Um nun zu erfahren, was der Gott gemeint haben könne, ging er zu allen denen, die für weise galten, und die er selber für solche hielt, die mehr wüßten als er, und prüfte die Weisheit dieser Leute. Zuerst wandte er sich an einen berühmten Staatsmann, und da fand er, daß von wirklicher Weisheit bei dem Manne keine Rede sei, daß er aber vielen andern Menschen, am allermeisten jedoch sich selbst sehr weise vorkomme. Und Sokrates dachte bei sich selbst: »Weiser als dieser Mann bin ich freilich. Denn es mag wohl eben keiner von uns beiden etwas Tüchtiges oder Sonderliches wissen; allein dieser meint doch etwas zu wissen, während er nichts weiß, ich aber, wie ich nichts weiß, so bilde ich es mir auch nicht ein! Ich scheine also um dieses wenige doch weiser zu sein als er, daß ich, was ich nicht weiß, mir auch gar nicht einbilde zu wissen.«
Sokrates ging nun umher bei allen, die für weise galten, bei Staatsmännern, Dichtern und Künstlern, und überall fand er die gleiche Eingenommenheit von der eigenen Weisheit, und dadurch, daß er versuchte, ihnen klar zu machen, daß sie im Grunde nichts wüßten, machte er sich diese Leute zu Todfeinden, weil er ihren hohlen Dünkel verletzte.
Schließlich gelangte Sokrates zu einer Erklärung des Orakelspruches, die wir mit seinen eigenen Worten (nach Plato) hier wiedergeben: »Und so scheint wohl, ihr Athener, der Gott weise zu sein und mit diesem Orakel zu meinen, daß die menschliche Weisheit sehr wenig nur wert ist oder gar nichts, und offenbar will er dies, nämlich, daß Sokrates der Weiseste unter den Menschen sei, nicht von Sokrates sagen, sondern nur mich zum Beispiel wählend hat er sich meines Namens bedient, wie wenn er sagte: Unter euch Menschen ist der weiseste, wer wie Sokrates einsieht, daß er in der Tat nichts wert ist, was die Weisheit anbelangt.« F1
Merkwürdig stimmt diese Erkenntnis des Sokrates überein mit allem, was die Heilige Schrift, 1. Kor. 8, 2, über menschliche Weisheit sagt.
Es ist etwas Schönes und Wertvolles um menschliche Wissenschaft, sobald wir sie beherrschen und uns nicht von ihr beherrschen lassen. Der wahrhaft Weise sieht in der Wissenschaft ein wichtiges Hilfsmittel für allen menschlichen Fortschritt, aber er bildet sich nicht ein, sie könne ihm irrtumsloses Wissen bieten. Die große Menge nicht bloß der Halbgebildeten, sondern auch vieler Hochgebildeter wird aber vom eigenen Wissen so geblendet, daß sie in der Wissenschaft eine unfehlbare Wahrheitsquelle sieht und meint, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus mit spöttischem Lächeln über Glaubenswahrheiten und Erfahrungstatsachen aburteilen zu können.
Die Jugend, der Gelegenheit geboten ist, sich so viele Errungenschaften menschlicher Wissenschaft anzueignen, soll sich mit allem Ernst und Eifer diese Schätze zu eigen machen; dabei aber bleibe sie sich stets bewußt, daß die Wissenschaft ihr nie untrügliches Wissen bietet, sondern nur Vermutungen: daß sie auch nicht das geringste bis in seine letzten Anfänge erklären kann und auch da, wo sie etwas zu erklären versucht, nur von Wahrscheinlichkeiten ausgeht, die man Hypothesen nennt, und die mit der fortschreitenden Erkenntnis beständigem Wechsel unterworfen sind.
Die Wissenschaft kann daher niemals etwas für unmöglich erklären; denn was für ihr heutiges Erkennen unmöglich erscheint, können neue Entdeckungen schon morgen als etwas Tatsächliches erweisen.
Weil aber so viele ihr Wissen nicht beherrschen, sondern wie jene Weisen zu Sokrates' Zeiten von ihrer eigenen Weisheit gar zu hoch denken, erlebt man es immer wieder, daß vom wissenschaftlichen Standpunkt aus vieles geleugnet, für unmöglich erklärt, mit Hohn oder Eifer zurückgewiesen wird, das späterhin notgedrungen auch wissenschaftlich anerkannt werden muß.
So wurden die Riesenvögel der orientalischen Märchen für Hirngespinste angesehen und die Berichte eines Marko Polo über ihr Vorhandensein als Schwindel betrachtet, bis man neuerdings auf Madagaskar ihre Eier entdeckte.
So wurden die alten Sagen von Zwergvölkern, so allgemein sie verbreitet sind, und so sehr sie miteinander übereinstimmten, ins Reich der Fabel verwiesen, und als der Afrikareisende Schweinfurth solche Völker entdeckte, fand er keinen Glauben; bis neuerdings ihr wirkliches Vorhandensein über alle Zweifel erhoben wurde.
So konnte es die französische Akademie der Wissenschaften noch vor wenigen Jahrzehnten für einen Aberglauben erklären, wenn man behauptete, es könnten Steine vom Himmel fallen. Aber ihre feierliche Erklärung wurde kurz darauf widerlegt, da ein großer Meteorsteinhagel in Frankreich niederging.
Wie es der Wissenschaft mit dem australischen Bumerang ging, möge man in Ronins »Jagden in fünf Weltteilen« nachlesen. Solcher Beispiele könnte man noch unzählige aufführen — und doch verfallen blinde Jünger der Wissenschaft immer wieder in den Fehler, an die Unfehlbarkeit der sogenannten wissenschaftlichen Ergebnisse zu glauben, die zur Zeit als feststehend gelten, und von ihrer Höhe aus über Dinge abzuurteilen, die über ihren vorläufigen Horizont hinausgehen. Sie vergessen, daß die Wissenschaft niemals abgeschlossen ist, sondern in ihren Erkenntnissen fortschreitet und dabei immer wieder als Irrtümer umstoßen muß, was ihr zuvor unfehlbar festzustehen schien.
Diese falsche Vergötterung menschlichen Wissens hindert nicht bloß den raschen Fortschritt — denn wie viele Erfindungen, wie viele Entdeckungen werden immer wieder verzögert oder verhindert, weil die Vertreter der Wissenschaft sie für unmöglich erklären F2 — nein! auch so mancher leidet an seinem Glauben Schiffbruch in dem Wahne, die Wissenschaft könne ihm Wahrheit bieten, und wo sie im Widerspruch mit der Offenbarung stehe, da sei der Offenbarungsglauben unhaltbar.
Darum, eignet euch an, was ihr von menschlicher Wissenschaft euch aneignen könnt, aber beherrschet euer Wissen in der allein vernünftigen Erkenntnis, daß es Stückwerk ist und niemals einen sicheren, unwandelbaren Boden bietet, auf den wir unsere Überzeugungen gründen könnten.
Goethe zeigt uns im Faust die Lächerlichkeit wissenschaftlicher Hohlköpfigkeit in dem Eigendünkel des Famulus Wagner, der, von seinem geringen Wissen geblendet, staunt, wie herrlich weit wir's gebracht haben, und alles wissen möchte, während er sich einbildet, schon viel zu wissen. Der wahre Weise und Gelehrte Faust hingegen erkennt genau, daß er trotz allen Studierens im Grunde so klug geblieben ist wie zuvor — er fühlt sich als einen armen Toren, so sehr man seine Gelehrsamkeit bewundert. Er steht auf dem einzig richtigen Standpunkt des Sokrates und des Paulus, daß es mit unserem Wissen nichts ist.
Daran wird man, wie zu Sokrates' Zeiten, jederzeit den wahren Weisen erkennen, daß er an das eigene Wissen nicht glaubt, sondern erkennt, daß alles, was die Wissenschaft ihm bietet, zweifelhaft ist, daß er also im Grunde gar nichts gewiß weiß. Dann kann auch die Wissenschaft nicht wider den Glauben streiten. Leider sind auch in der Gelehrtenwelt diese wahren Weisen selten, und auch hier stehen so viele auf dem geistig beschränkten Standpunkt des Famulus Wagner.
Südamerika ist ein merkwürdiges Land: während im Norden der Landenge von Panama im blutigen Kampfe mit grausamen Indianerstämmen jeder Schritt Landes von der Kultur erobert wurde und uns kaum noch die eisigen Gefilde Alaskas Unbekanntes bieten, haben wir hier noch gewaltige Länderstrecken, die keines Weißen Fuß betreten hat, und die niemand zu erforschen unternimmt: Afrika ist schon genauer bekannt als diese Urwälder und Llanos zwischen den Anden und dem Orinoko.
Und obgleich die Gegenden, in denen sich nach übereinstimmenden Kunden das Reich des Dorado finden sollte, bis heute nicht erforscht wurden, obgleich seit Hutten die Stätte nicht mehr betreten wurde, wo dieser Held die Goldstadt der Omagua erblickte, obgleich die Napo noch heute mit Goldstaub gefüllte Bambusstäbe nach Quito bringen, hält die Wissenschaft El Dorado für ein Hirngespinst, das die Eldoradosucher narrte; und man lächelt heute über jene »leichtgläubigen«, »wundersüchtigen« Abenteurer.
Trotz aller so bestimmten Erzählungen über die Amazonen, die in einer Gegend leben sollten, die ebenfalls bis heute noch nicht erforscht wurde — wer glaubt noch an ihr früheres oder jetziges Vorhandensein? Und doch wagte Humboldt selber nicht daran zu zweifeln, daß den so übereinstimmenden Berichten Tatsachen zugrunde liegen müßten.
Und die Amazonensteine? — Ihr Vorhandensein ist unleugbar, und die aus ihnen gefertigten Kunstwerke erscheinen als unerklärliche Wunder — ihre Fundorte aber sind bis heute nicht entdeckt.
Das Streben der Alchimie, unedle Metalle in Gold und Silber zu verwandeln, galt lange Zeit der aufgeklärten Wissenschaft für eine kindische Torheit; neuerdings muß die Wissenschaft ihre Übereilung einsehen und kann die Möglichkeit von Umwandlungen der Metalle nicht mehr ernstlich leugnen.
Alles in allem, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus darf einfach nichts für unmöglich erklärt werden; denn wer von der Wissenschaft nicht geblendet ist, sondern beherrschend über ihr steht, der weiß, daß des Unbekannten und Unentdeckten auf wissenschaftlichem Gebiete viel mehr, unendlich viel mehr ist als des Bekannten, und daß das Bekannte selbst zweifelhaft bleibt; jede Stunde kann durch ungeahnte neue Entdeckungen alles umwälzen und zunichte machen, was die blinden Jünger der Wissenschaft für unumstößlich, für alle Zeiten feststehend hielten. Das lehrt uns auf Schritt und Tritt die ganze Geschichte der Wissenschaft.
Und so will auch unsere Erzählung vom Dorado dem vernünftigen Leser, dem alten wie besonders dem jugendlichen, zu Gemüte führen, wie so vieles möglich, ja wahrscheinlich ist, für das so mancher in eitlem Bildungswahne nur ein mitleidiges Lächeln übrig hat, meinend: »Über diese Fabeln und Phantasien sind wir Kinder einer aufgeklärten Zeit weit hinaus!«
Es wird ja, wie bei den Geschichten eines Jules Verne, auch bei dieser Erzählung selbst der jugendliche Leser sich darüber klar sein, daß ihm in der Schilderung des Amazonenreiches und Manoas mehr Phantasie als Wirklichkeit geboten wird. Aber diese Schilderungen möchten den Eindruck erwecken, als ob sie nichts tatsächlich Unmögliches enthielten. Wir wünschten, unsere Erzählung könnte so überzeugend wirken, daß viele ihrer Leser dauernd davor bewahrt bleiben, solche blinde Anbeter der wissenschaftlichen Autorität zu werden, wie der Famulus Wagner und die weisheitstrunkenen Zeitgenossen des Sokrates. Es ist wohl ein stolzes Hochgefühl, daß die aufgeblasene Brust eines Mannes oder Jünglings schwellt, der sich einbildet, durch die Wissenschaft sich einen großen Schatz »ewiggültigen« Wissens angeeignet zu haben. Im Grunde aber ist es der lächerliche Wahn des Frosches, der seinen Tümpel für das Weltmeer hält.
Es bleibt bei der Erkenntnis des Sokrates: keiner ist wahrhaft weise, als wer die Unzulänglichkeit alles menschlichen Wissens einsieht.
Der Glaube an die Unfehlbarkeit der Wissenschaft ist nicht minder töricht und gefährlich als ein anderer krasser Aberglaube. Darum auf zu einer höheren, vernünftigeren und menschenwürdigeren Erkenntnis! Nicht aber um die Arbeit der Wissenschaft zu verachten und für entbehrlich zu halten, sondern um sie fruchtbarer zu machen dadurch, daß ihr euer Wissen beherrscht, statt seine Sklaven zu werden. Vergleiche hierzu auch das Gespräch über die Wissenschaft in Kapitel 49 dieses Buches.
Nach Platons Apologie 9, übersetzt von Dr. Max Oberbreyer. Leipzig, Philipp Reclam jun.
Die Entdeckung Amerikas wurde verzögert durch den Unglauben der damaligen Vertreter der Wissenschaft, ebenso die Erfindung des Dampfschiffs, der Gasbeleuchtung und unzählige andere. Die Erfinder wurden von wissenschaftlichen Autoritäten meist für verrückt erklärt. Wissenschaftliche Bedenken verzögerten lange die Einführung der Eisenbahnen, hinderten die Entwicklung des Unterseeboots, des Telephons und des Zeppelinschen Luftschiffes usw., usw.
ICH bin kein Freund von Anmerkungen, namentlich wenn sie als Fußnoten oder durch Nummern im Text, die den eifrigen Leser zum Nachschlagen veranlassen, das zusammenhängende Lesen unterbrechen und unangenehm stören. So hatte ich denn anfangs auf alles derartige verzichtet. Da geriet meine Handschrift vor dem Druck in die Hände eines Mannes von ganz außerordentlich umfassenden naturwissenschaftlichen Kenntnissen. Dieser stellte mehr als 70 Punkte heraus, die »ganz sicher« falsch seien. Dies veranlaßte mich, meine Hauptquellen nochmals vorzunehmen und die Belege für die beanstandeten Punkte nach Band und Seitenzahl anzugeben. Ich hatte die Genugtuung, daß sich auch nicht eine der beanstandeten Stellen als Irrtum erwies, sondern für jede sich meist mehrere Belege in einer oder mehreren der Quellen fanden.
Der Kritiker, der bisher geglaubt hatte, auf naturwissenschaftlichem Gebiete so ziemlich alles zu wissen, sah zu seiner Überraschung ein, daß die Natur Südamerikas ein besonderes Studium erfordere, um ein kritisches Urteil zu ermöglichen. Er war nun von der Einwandfreiheit meiner Darstellung überzeugt.
So sind die Nachweise zu »El Dorado« entstanden. Ich veröffentlichte sie, da ich mit der Möglichkeit rechnen mußte, daß das Buch noch anderen ähnlichen Kritikern in die Hände fallen könnte. Da die Zeit mir nicht gestattete, nochmals sämtliche Quellen durchzuarbeiten, finden sich in den Nachweisen meist nur die Hauptquellen angeführt und im wesentlichen nur die von jenem Kritiker angezweifelten Punkte.
Bei meinen späteren Erzählungen übte ich die Vorsicht, mir die Belegstellen gleich bei der Ausarbeitung anzumerken, so daß die Nachweise gründlicher ausfielen. Bei der wissenschaftlichen Unterlage meiner Erzählungen halte ich mich streng bis in die kleinsten Einzelheiten hinein an gut bezeugte Tatsachen. Unkundige Kritiker wittern oft Unwahrscheinlichkeiten und Übertreibungen, und zwar mit Vorliebe gerade da, wo die Berichte im strengsten Sinne der Wirklichkeit entnommen sind. Solchen Irrtümern können die Nachweise begegnen.
Daß da, wo die tatsächliche Forschung versagt, die Phantasie sich freien Spielraum gönnte, ohne sich, wie ich hoffe und mir bezeugt wurde, ins verworren Phantastische zu verlieren, wird kein Einsichtiger tadeln wollen. Hierher gehören die Beschreibungen des Smaragdberges, des Amazonenstaates, des Fabeltiers, Manoas und die Geheimnisse des Inkas. Aber auch da hielt ich mich an Nachrichten und Überlieferungen, soweit solche vorhanden sind. Ob diese nun für sagenhaft gehalten werden wollen, oder ob man, wie ich, überwiegend Tatsächliches dahinter vermuten will, tut nicht viel zur Sache.
Die vorzugsweise von mir benutzten Quellen sind folgende:
1. Alexander von Humboldt: Reise in den Äquinoktialgegenden des neuen Kontinents.
2. Joh. Jak. von Tschudi: Reisen durch Südamerika.
3. Karl Ferd. Appun: Unter den Tropen. Bd. I: Venezuela.
4. Prof. Dr. Otto Bürger: Reisen eines Naturforschers im tropischen Südamerika.
5. Dr. med. Karl Sachs: Aus den Llanos. Schilderungen einer naturwissenschaftlichen Reise nach Venezuela.
6. Eberhard Graf zu Erbach: Wandertage eines deutschen Touristen im Strom- und Küstengebiet des Orinoko.
7. Caldeleugh: Reisen in Südamerika.
8. Brehm: Tierleben.
9. Engel: Auf der Sierra Nevada de Merida.
10. Von den Steinen: Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens.
11. Gibbon: Exploration of the valley of the Amazon.
12. Zöller: Die Deutschen im Brasilischen Urwald.
13. Wappäus: Die Republiken von Südamerika.
14. Felix de Azara: Reise nach Südamerika.
15. Junker von Langegg: El Dorado.
16. Brehm: Das Inkareich.
17. Kolberg: Nach Ecuador.
18. Garcilasso de la Vega (Inka): Histoire des Incas, rois du Pérou.
19. Federmann: Indianische Historia.
20. Anton Göring: Vom tropischen Tieflande zum ewigen Schnee. Eine malerische Schilderung des schönsten Tropenlandes Venezuela.
21. M. Jules Humbert: La première occupation Allemande du Vénézuéla au XVIe Siècle, période dite des Welser (1528-1556). Paris 1904.
22. Verschiedene Zeitungsberichte und Artikel aus illustrierten Familienblättern und wissenschaftlichen Zeitschriften.
Ich schicke voraus, daß ich mich in nachfolgenden Anmerkungen auf den Hinweis auf diejenigen Quellen und Stellen beschränke, die für die betreffende Tatsache am charakteristischsten sind, daß in der Regel aber noch viele andere Belege angeführt werden könnten, die ich der Kürze halber nicht berücksichtige.
Zu Kap. 1. Der Niederländer J. B. van Helmont (1577-1644) vereinigte tiefes medizinisches und chemisches Wissen, und doch glaubte er fest an die Existenz des Steines der Weisen; obgleich er sich nie um seine Darstellung bemühte, war er vollkommen von der Möglichkeit der Metallverwandlung überzeugt und stellte selbst 1618 aus 8 Unzen Quecksilber mit ¼ Gran des Steines, den er von Unbekannten erhalten hatte, reines Gold dar. Bei seinen chemischen Kenntnissen ist es unbegreiflich, wie er sich täuschen konnte. »Es gehört dies Faktum zu denen, wo es einem fast ebenso schwer wird, die Möglichkeit einer Täuschung anzunehmen, als an die Wahrheit der Sache selbst zu glauben« (Kopp). Doch sind nur wenige derartige Fälle bekannt. Vgl. H. Kopp, Geschichte der Chemie. Braunschweig 1848. Bd. I und II und andere Schriften desselben Verfassers. Siehe auch Pierers Universal-Konversations-Lexikon. 6. Aufl., 1875. 1. Band unter »Alchemie«.
Im Daheim (1905 Nr. 89 S. 24) schreibt Dr. Stephan Kekule von Stradonitz (»Ein Hauptstück alchimistischer Kunst«): »Man ist heutigen Tages leicht geneigt, über die Alchimisten und ihre Bestrebungen den Stab zu brechen. Der Gedanke, ein Metall in ein anderes, ein unedles Metall in ein edles und kostbares zu verwandeln, ein Element, um es wissenschaftlich auszudrücken, in ein anderes überführen zu wollen, und zwar alles durch menschliche Einwirkung, erschien noch bis vor kurzem den Naturforschern der Neuzeit als ein derart törichter, daß sie sich schwer davon losrissen, bei den Alchimisten überall an Wahn oder Schwindel zu denken.«
Der Verfasser erinnert unter anderem daran, daß die Alchimisten sich an den Fürstenhöfen meist mit einem gelungenen Probeversuch einführten, und daß das von ihnen hergestellte künstliche Gold vielfach von Sachverständigen, das heißt Münzmeistern und dergleichen, untersucht worden und, wie noch vorhandene Akten beweisen, für echt erklärt worden ist.
Über mehrfache Umwandlung von Elementen, die dem englischen Forscher Sir William Ramsay gelang, berichtet der Chemiker Geheimrat Prof. Dr. Ostwald in der Chemiker-Zeitung (Köthen Juli 1907); siehe Pforzh. Gen.-Anz. Nr. 174 vom 29. Juli 1907.
Im Pforzh. Beobachter vom 20. Okt. 1896 finden wir einen längeren Aufsatz »Die Erfindung des Goldmachens«, der sich mit mehr oder weniger verheißungsvollen neueren Versuchen beschäftigt, Silber in Gold zu verwandeln (der Chemiker Emmens, Carey Lea, Ira Remsen, Edison, Tesla).
Kap. 5. Über die Atlantissage sah ich eine ganze Reihe besonderer Quellen durch, von den ältesten an. Durch diese wurde ich zu der Ansicht geführt, die Friedrich vertritt. Die Verlegung jener fabelhaften (?) Insel ins Mittelmeer erscheint erzwungen und unhaltbar.
Kap. 7. Korallenriffe von Patanemo, östlich von Puerto Cabello (»Bufadores«): Göring S. 6.
Kap. 10. Die Angriffe auf die Matrosen und die Valesia stimmen genau mit den Zeitungsberichten überein, abgesehen natürlich von der Beteiligung der Mestizen und der beiden Knaben:
»Der Mob in Puerto Cabello, welcher unmotiviert 50 Matrosen des Kreuzers Vineta angriff (welche von dem Handelsdampfer Valesia aufgenommen wurden), wird auf 1200 Mann geschätzt.« Daheim, 2. November 1901, Nr. 5. — Manglaren: Göring S. 6/7. — Mangle-Austern: Göring S. 7.
Kap. 11. San Esteban, Villen, zumeist Deutschen gehörig: Göring S. 7. — Canna brava: S. 10 und 11. — Paß nach Valencia, 5000 Fuß hoch: S. 8. — Campanero: S. 40.
Kap. 12. Wie die verwundete Araguatomutter ihr Junges in Sicherheit bringt, das von einer anderen aufgenommen wird, haben Appun und Sachs beobachtet. Appun S. 188/189; Sachs S. 247. — Valencia und See: Göring S. 8. — Brüllaffe: S. 26.
Kap. 13. Brand der Abhänge: Appun S. 238-240. — Mitte November: Sachs S. 84. — Im Dezember: Sachs S. 136.
Kap. 15. Die Schießkunst der Knaben muß als außerordentlich gelten, übertrifft aber nicht diejenige der Buren, von denen nicht bloß einzelne hervorragende Schützen, sondern fast alle mit fabelhafter Sicherheit die Feinde in Kopf oder Brust trafen. Über das venezolanische Militär berichteten anläßlich der venezolanischen Wirren alle illustrierten Zeitschriften. Besonders über die »Generäle« (ein Titel, der selbst Frauen verliehen wird) vgl. Sachs S. 117; Graf Erbach S. 26 und 77. (Ohne Halsbinde, ohne Hemd, den Schleppsäbel mit Bindfaden an der Schärpe befestigt.)
Kap. 17. Matapalo (Feigenart), Ficus dendroïcus: Göring S. 1213
Kap. 18. Über die in den Llanos so häufigen Luftspiegelungen vgl. Sachs S. 97 (auch aufrechte Bilder); Humboldt II S. 389; Bürger S. 283. — Weißgefleckte Rehe (Matacani): Humboldt IIS. 391. — Riesenschlangen, über 7, ja, nach älteren Berichten 10-13 Meter lange: Appun S. 290/291. — Lagune in den Llanos: Sachs S. 95. — Bad Sachs S. (120) 126/127.
Kap. 19. Irrlichter — die Seele des Tyrannen: Sachs S. 115; Humboldt I S. 233, II S. 315/316. Das Geschichtliche siehe bei Langegg. — Der belgische Chemiker Prof. Leon Dumas hat Irrlichter künstlich erzeugt, indem er in einen Schwefelwasserstoffapparat etwas Phosphorkalzium brachte und ihn im Wasser versenkte. Sobald das Gasgemisch an die Luft kam, entstand die bläuliche Irrlichtflamme. Dumas behauptete, das Irrlicht entstehe nur, wo eine Leiche im Sumpf liege (Pforzh. Gen.-Anz. Nr. 303. 28. Dez. 1909). Über den See von Guatavita, Manoa und El Dorado siehe die Nachweise zu Kap. 43.
Kap. 20. »Ein Dorf wechselt seinen Platz wie ein Lager ... Es ist vorgekommen, daß ganze Dörfer mehrere Stunden weit verlegt wurden, bloß weil der Mönch die Aussicht aus seinem Hause nicht schön oder weit genug fand.« Humboldt I S. 343.
»Die Flüsse haben einen schwachen, oft kaum merklichen Fall. So kommt es, daß beim geringsten Wind, und wenn der Orinoko anschwillt, die Flüsse, die in ihn fallen, rückwärts gedrängt werden. Im Rio Arauca bemerkt man häufig diese Strömung nach oben. Die Indianer glauben einen ganzen Tag lang abwärts zu schiffen, während sie von der Mündung gegen die Quellen fahren.« Humboldt II S. 370.
»Ich habe mehrere Beispiele dieser Verzweigungen mit Gegenströmungen, dieses scheinbaren Wasserlaufs bergan, dieser Flußgabelungen, deren Kenntnis für die Hydrographen von Interesse ist, auf einer Tafel meines Atlas zusammengestellt. Dieselbe mag ihnen zeigen, daß man nicht geradezu alles für Fabel erklären darf, was von dem Typus abweicht, den wir uns nach Beobachtungen gebildet, die einen zu unbedeutenden Teil der Erdoberfläche umfassen.« Humboldt III S. 389.
Kap. 22. Don Guancho Rodriguez: Sachs S. 135.
Kap. 23. Hato Los Tamarindos: Sachs S. 140/141. — Palmen, die Hüte, Dächer, Besen, Fächer, Filter, Bürsten usw. liefern: Sachs S. 137. — Totumo, Flaschenbaum (Crescentia Cujete): Göring S. 14. — Urwald beim Oritucu: Sachs S. 142-144. — Cariben: Appun S. 305; Sachs S. 146/147. — Tembladore: Sachs S. 149, 165, 230; Appun S. 304; Humboldt II S. 402-409. — »Unerklärt ist es, wie die Tembladore gegen die elektrischen Schläge ihres eigenen Körpers, die in voller Stärke durch ihren eigenen Körper hindurchgehen, und demnach gegen die ihrer Artgenossen unempfindlich sind. Eine Schnecke verträgt Giftpilze, ein Huhn und ein Faultier tödliche Strychningaben; aber das ist doch etwas ganz anderes.« — Sommerschlaf der Krokodile: Sachs S. 188/189; Humboldt II S. 411-413. Der Oritucu ist besonders gefährlich wegen der Wildheit seiner Krokodile (Humboldt II S. 411), wegen der zahlreichen Tembladore (Sachs schätzte die auf geringen Raum zusammengedrängten Tembladore in einem Canno des Oritucu auf mehrere Hundert! S. 196), wegen der Karibenfische und Stachelrochen; selbst die Eingeborenen meiden ihn: Sachs S. 146/147.
Kap. 24. Der Termitenhügel für Flintenkugeln undurchdringlich: Tschudi I S. 296.
Zamuro = Aasgeier: Tschudi V S. 116; Sachs S. 208/209.
Termiten: Sachs S. 138/139; in San Fernando de Apure: Sachs S. 281; von Ameisen vertilgt: Sachs S. 281.
Kampf mit den Ratten: Tschudi I S. 271/272.
Kap. 25. Das Krokodil des Orinoko, meist über sieben Meter lang: Appun S. 121; Humboldt III S. 25 und 134.
Chiguire: Humboldt III S. 27; Bürger S. 259.
Rauschen der Platten des Krokodils: Humboldt III S. 26.
Kap. 26. Nächtlicher Lärm im Urwald: Appun S. 505/506 und 506/507; Humboldt III S. 35/36; Tschudi II S. 209.
Puma: Tschudi V S. 3. — Riesenhafter Puma: Tschudi V S. 14.
Kap. 27. »So klaffen noch weite Lücken im Innern Südamerikas, größer als in Afrika und Zentralasien; die wissenschaftliche Untersuchung der Länder dieses Erdteils geht nur sehr langsam vorwärts, und in manchen Gebieten gilt es sogar, noch die erste Pionierarbeit zu verrichten.« Sievers, Süd- und Mittelamerika. Leipzig 1903. S. 24. — Bemalte Felsen und Flutsage: Humboldt III S. 61-63, IV S. 133-138.
Leuchtkäfer: »Alle diese überstrahlt Photinus, ein rein amerikanisches, gewaltiges Geschlecht ... Gleich Raketen schnellen dagegen die leuchtenden Elateriden in die Lüfte, oft von der Erde bis in die Wipfel der Urwaldriesen. Die beiden Feuer, welche sie am Halsschilde tragen, glühen so intensiv, und die Bewegung ist so heftig, daß sie eine gelbrote Linie beschreiben.« Bürger S. 106. »Zwischen den Bäumen schossen riesige Schnellkäfer wie Raketen empor, so leuchtkräftig sind die beiden Leuchtorgane, welche sie besitzen.« Bürger S. 252. Ähnlich auch bei Humboldt I S. 253. — Leuchtkäfer (Coneios), fast drei Zentimeter lang: Göring S. 14.
Kap. 28. Schmetterlinge: Bürger S. 235-242. — Käfer: Bürger S.244-250. — Wanzen: Bürger S. 250/251. — Wickelbär, Eier fressend: Bürger S. 286/287. — Die Krokodile sind im Apure und Orinoko usw. sehr zahlreich: Sachs S. 254; Humboldt III S. 24/25 (»daß auf dem ganzen Stromlauf fast in jedem Augenblick ihrer fünf oder sechs zu sehen waren«). — Das Krokodil brüllt: Sachs S. 365; Appun S. 506. — Das Krokodil schließt beim Schwimmen die Kinnladen nicht fest, wie auch der Hund, so daß ein von ihm ergriffenes Opfer, wenn es wieder loskommt, mit leichten Wunden davonkommen kann: Humboldt IV S. 212. — Das Kitzeln der Krokodile bezeugt Sachs S. 225, bestätigt durch R. Paez (»Wild Scenes« S. 66) und Emerson Tennent (»Sketches on the natural history of Ceylon« S. 284). — Das Krokodil hält seine Opfer oft lange Zeit über Wasser, ohne unterzutauchen: Sachs S. 255; Humboldt IV S. 210-212. — Das bekannte Rettungsmittel, dem Krokodil in die Augen zu greifen, ist daher leicht anwendbar, kann übrigens auch unter Wasser gelingen. Über dieses teils mit, teils ohne Erfolg angewandte verzweifelte Mittel siehe Sachs S. 255, Humboldt III S. 25 (junges Mädchen aus Uritucu), S. 26 (Isaaco, der Führer Mungo Parks, zweimal durch dieses Mittel gerettet, das auch die Neger im Innern Afrikas kennen und anwenden), IV S. 210 (Guayqueriindianer; das Krokodil läßt ihn nicht los, taucht aber im Schmerz unter, wobei der Indianer ertrinkt) usw. Auch der Afrikareisende Junker weiß davon zu berichten.
Stärke des Schwertfisches, der sogar in ein Boot ein großes Leck stoßen kann: Appun S. 525.
Kap. 29. Die Schildkröten auf den Playa: Humboldt III S. 65 bis 77; Bürger S. 363/364; Sachs S. 303-306. — Krokodilbrut: Bürger S. 264/365. — Die schreienden Krokodilseier, bestätigt durch Dr. Camborn (Hohenloher Tagblatt Nr. 247. 22. Okt. 1913), durch Prochaska (Ill. Jahrbuch der Naturkunde 1903 S. 246/247). — Höhle von Uruana: Humboldt III S. 80. — Meliponen: ebenda S. 86. — Manati: ebenda S. 44/45; Göring S. 18.
Kap. 30. Orangen und Platanen (Musa sapientum): Göring S. 14. — »Die Gürteltiere sind unbeholfen und wehrlos und wären wahrscheinlich bereits ausgerottet, wenn sie es nicht verständen, vor den Augen ihrer Verfolger im Boden zu verschwinden, so schnell vermögen sie sich in die Erde einzugraben.« Bürger S. 326.
»Der Skorpion sticht nicht mit seinem nach vorn gekrümmten Stachel einmal kräftig zu, sondern bearbeitet, wie die Nadel einer Nähmaschine, unglaublich schnell ein ganzes Feld.« Bürger S. 107. — Boa zerdrückt große Vierfüßer, verschlingt Ziegen und Rehe: Humboldt III S. 234. — Geschicklichkeit im Lassowerfen: Sachs S. 141.
Kap. 31. Mogote de Cocuyza: Humboldt III S. 111. — Indianerlager bei Pararuma: Humboldt III S. 89-97. — Guahibos: ebenda S. 129-131. — Yarumakuchen mit Fett von Käferlarven: Appun S. 471, vgl. auch Appun S. 505.
Kap. 32. Die Missionspraxis in Südamerika, getreu nach Humboldt III S. 111-113, 306, 380. Die ärgsten Schändlichkeiten der Spanier sind übrigens von den Portugiesen in Brasilien noch weit übertroffen worden; man lese Tschudi II S. 260-264!
Kap. 33. Titi und Viudita: Humboldt III S. 100-103. — Fang junger Affen: Humboldt III S. 101/102. — Felsbänke von Carichana: Humboldt III S. 118/119.
Kap. 34. Sumpfhirsche: Bürger S. 324. — Musikfelsen: Humboldt III S. 123/124. — Piedra de Paciencia: Humboldt III S. 127. — Süßwasserdelphine: Sachs S. 261/262; Humboldt III S. 301/302; Bürger S. 359.
»Kein Mensch kennt den weiten Landstrich zwischen Meta, Vichada und Guaviare weiter als auf eine Meile vom Ufer.« Humboldt III S. 261.
Humboldts Hoffnungen für die Zukunft des Stromgebiets des Orinoko und Amazonas siehe Bd. IV S. 68/69.
Kap. 35. Ameisenbär: Sachs S. 168; Tschudi II S. 201/202; Bürger S. 326/327; Göring S. 59. — Chinabaum: Bürger S. 199/200. — Vampyr (mit langem Schwanz): Humboldt III S. 47, (»ungeheuere Fledermäuse«) II S. 415.
Kap. 36. Die verschiedenen Affenarten: Bürger S. 318-323. — Affen als Nahrungsmittel erinnert an Kannibalismus (Schomburgk, Prinz Max von Wied): Bürger S. 319; Humboldt III S. 92/93.
Kap. 37. Paka: Bürger S. 324/325; Göring S. 33. — Die nicht häufige Krötenschlange (Culebra sapa) Appun S. 227. — Heilmittel gegen Schlangenbisse: Guaco morado: Humboldt III S. 325; Appun S. 217; Tschudi III S. 169; Rum: Bürger S. 69; Salmiakgeist: Tschudi III S. 163; Salmiakgeist in Rum: Appun S. 217.
Kap. 38. Raudales de Atures: Humboldt III S. 175-180; IV S. 159. — Jaguar, größer als ein indischer Tiger: Humboldt III S. 29. — Die Jaguare, bei den Katarakten sehr häufig, hausen gern in verlassenen Bauten: Humboldt III S. 140; kamen sogar in das zu Humboldts Zeiten bewohnte Dorf herein: ebenda S. 188. — Verschwinden der Aturesindianer, an deren Stelle Guahibo traten: Humboldt III S. 143. — Laxas negras: ebenda S. 146-153. — Garzones Soldatos: ebenda S. 167. — Grabstätte der Aturen: ebenda IV S. 148-154. — Raudal von Maypures: ebenda III S. 228 ff. — Keri und Quivitari: ebenda S. 235/236. — Calitamini: ebenda S. 248. — Frosch: ebenda.
Kap. 39. Die schwarzen Wasser: Humboldt III S. 262-266. — Raya: ebenda S. 255. — Zyklopen, Hundsköpfe usw.: ebenda S. 138/139. — Salvaje: ebenda S. 191-194. — El Castillito: ebenda S. 267. — Chinampa: ebenda S. 38, 159/160; IV S. 202. — Zahllose Fledermäuse: ebenda S. 267.
Kap. 40. Pirijaopalme: Humboldt III S. 281. — Wassernattern: ebenda S. 290. — Käsebaum: ebenda S. 292.
Kap. 41. Die Guahibo: Humboldt III S. 295-299.
Kap. 42. Aradore und Uzao: Humboldt III S. 304/305; Göring S. 63. — Monatelanger Regen: Humboldt III S. 307/308, 313, 370; IV S. 31. — Bezweifelte Verbindung zwischen Orinoko und Amazonas: Humboldt IV S. 38, 62-67.
Übrigens könnte auch die Ansicht aufgestellt werden, daß in uralten Kulturzeiten zur Verbindung der großen Wasserstraßen des Orinoko und Amazonas ein künstlicher Kanal gegraben wurde, der durch die Jahrhunderte das Aussehen eines natürlichen Flußlaufes gewann; haben doch schon die alten Ägypter großartige Kanalbauten ausgeführt. — Cocuy: Humboldt III S. 386.
Kap. 43. Die streng geschichtliche Schilderung der Goldfahrten der Deutschen hauptsächlich nach Langegg und Federmann. Über den Dorado und die merkwürdige Übereinstimmung aller Berichte über ihn siehe ferner: Tschudi II S. 225; Humboldt IV S. 254-298, III S. 348 und 349, 366-368, 398.
Philipp von Hutten: Humber S. 12: »Keine Gestalt ist liebenswürdiger als diejenige dieses redlichen und uneigennützigen jungen Mannes ... seine Briefe verraten einen sanften und liebevollen Charakter, eine großmütige und vertrauende Seele, einen lebhaften und erleuchteten Verstand.« Ambrosius Dalfinger, als Bruder des Georg und Heinrich Ehinger (»Eynguer«, »Ynguer«) bezeichnet — von den Spaniern »El Einger« oder »El Ynger« genannt, wurde sein Name in Alfinger und Dalfinger verketzert. (Humbert S. 6/7.)
Über El Dorado, den See von Guatavita und über Manoa siehe ferner: Münchener Neueste Nachrichten Nr. 338, 29. Juli 1903 (Das wahre »El Dorado«); Daheim Nr. 46, 13. Aug. 1904 (Moderne Schatzsucher von A. Oskar Klaußmann); Leipz. Ill. Zeitg. Nr. 3328 (Der Goldschatz der Inka); Bayrische Staatszeitung Nr. 225, 26. Sept. 1913 (Die archäologische Entdeckung von »Eldorado«); Daheim Nr. 18, 31. Jan. 1903 (El Dorado von Albert Kersting).
Kap. 44. Marimahemden: Humboldt IV S. 100/101. — Vachaco als Speise: ebenda IV S. 15; getrocknet: ebenda III S. 379; als vortreffliche Ameisenpastete: ebenda III S. 380.
Kap 45. Blattschneideameisen und ihre breiten Pfade: Bürger S. 95-99; reitende Ameisen ebenda S. 96; Akazienameisen ebenda S. 98/99. — »Im Verhältnis zu seiner Größe hat das Faultier eine so langsame Bewegung, daß es die Geduld aller Naturforscher, die seine Bewegungen messen wollten, ermüdet hat. Bei ununterbrochener Bewegung legt es in 24 Stunden höchstens 50 Schritte oder in 5 Monaten eine geogr. Meile zurück; allein es unterbricht diese Bewegung so oft und ruht sich so lange aus, daß es sich in 6 oder 7 Jahren nur um eine Meile fortbewegt.« (Geschwindigkeit. Von K. Bürger. Fürs Haus Nr. 1292, 7. Juli 1907.)
Kap. 46. Amazonensteine: Humboldt III S. 392-401, IV S. 1l2 u. 113. »So ist denn in diesem östlichen Strich von Amerika noch schöne geognostische Entdeckung zu machen, nämlich im Urgebirge ein Euphotidgestein (Gabbro) aufzufinden, das die Piedra de Macagua enthält.« Humboldt hält die Amazonensteine für eine Art Saussurit, für Nephrit. Über ihre kunstvolle Bearbeitung siehe auch die geschichtlichen Werke.
Kap. 47. Die Amazonen: Humboldt III S. 392-401. — Korallenschlangen: Bürger S. 68/69. — Die Sprache der Amazonen nach einem Indianerdialekt aus v. d. Steinen.
Kap. 49. Der Bauer im Zirkus. Es handelt sich um einen jigurlichen Bauern, der in meiner Knabenzeit mit seinem Sohne neben mir in einem Nizzaer Zirkus saß. — Der Prof. der Zoologie und vergleichenden Anatomie Fleischmann in Leipzig fordert, daß die Wissenschaft sich auf Buchung der Tatsachen beschränke, ohne irgendwelche Schlüsse zu ziehen. (Die Deszendenztheorie. Leipzig 1901.) »Was Sie über Möglichkeit und Unmöglichkeit in der Wissenschaft sagen, unterschreibe ich durchaus. Die Grenze der Möglichkeit liegt für die Wissenschaft nur in der Grenze unseres Erkenntnisvermögens. Ich halte es darin immer noch mit Du Bois-Reymonds berühmter Darlegung ›Über die Grenzen des Naturerkennens‹.« (Prof. Dr. Hans Meyer, Leipzig, in einem Briefe an den Verfasser über El Dorado.)
Kap. 51. Tompa-ipo und die anderen Indianernamen in den folgenden Kapiteln nach den Indianerdialekten aus dem Werke von v. d. Steinen gebildet. — Cachimana und Jolokiamo: Humboldt III S. 323; Parauaquiri, Poito: ebenda III S. 277. — Jaranavi, Uavemi, Pongheme: ebenda III S. 278.
Kap. 53. Guacharohöhle: Humboldt I S. 354-370; Göring S. 44/45.
Kap. 54. Das Fabeltier. Die Nachrichten über dieses rätselhafte Ungeheuer, die seinerzeit reichlich aus Brasilien kamen, gaben mir den Gedanken der ganzen Erzählung ein.
Dr. E. Budde »Naturwissenschaftliche Plaudereien«. (Berlin, Georg Reimer 1891), Kap. 8 »Festländische Kollegen der Seeschlange«, S. 46: »Der hochgeachtete Zoologe Fritz Müller in Otajahy, Südbrasilien, schrieb ... 1878 ... einen merkwürdigen Bericht über die vermutliche Existenz eines riesenmäßigen, wurmförmigen Tieres in den Südprovinzen von Brasilien (und wahrscheinlich auch in Nicaragua), wo dasselbe vom Volk ›der Minhocao‹ genannt wird ... Wer würde nicht lächeln, wenn er von einem Wurm hörte, der 50 Meter lang und 5 Meter breit sein soll, der einen Knochenpanzer trägt, mächtige Fichtenbäume umwühlt, als wären es Grashalme, Flußläufe in neue Kanäle leitet und trockenes Land in bodenlosen Morast verwandelt.« Man sieht, ich habe mein »Fabeltier« weit bescheidener geschildert, da ich ihm nur 30 statt 50 Meter Länge, und nur 2 statt 5 Meter Breite gab!
Kap. 55. Vgl. Sachs S. 157: Der Tischler Yssele in Calabozo, der nach 12jährigem Aufenthalt in Venezuela das Spanische noch mit höchst ergötzlichem schwäbischem Akzent ausspricht.
Mit dem schwäbischen Indianerhäuptling ist es mir ganz merkwürdig ergangen. Zur schwachen Rechtfertigung dieses kühnen Gedankens wußte ich in der 1. Aufl. nur obige Tatsache anzuführen nebst den Bemerkungen, die Friedrich im Texte macht. Seither aber fand ich zahlreiche Nachweise, daß Weiße, und zwar Schwaben, tatsächlich Indianerhäuptlinge wurden! Folgende Nachricht beispielsweise stimmt ganz auffallend überein mit dem, was ich von Tompaipo erzähle:
»Ein Deutscher als Indianerhäuptling. Durch Vermittlung des Senators T. P. Gore von Oklahoma hat ein Deutscher, namens Hermann Lehmann, der ein Adoptivsohn des Comanchenhäuptlings Quanah Parker ist, die Regierungsanerkennung als Indianer erhalten. Als Lehmann elf Jahre alt war, wurden er und sein Bruder von einer Apachenbande, die sich auf dem Kriegspfade befand, aus dem Heime ihrer Mutter in Texas geraubt. Bei diesem Überfall verloren viele Ansiedler ihr Leben, und die ganze Gegend wurde durch Feuer verwüstet. Bald nach der Gefangennahme gelang es Hermanns Bruder zu entfliehen und wieder zu seinen Angehörigen zurückzukehren, Hermann selbst war aber von den Rothäuten an ein Pferd gefesselt und als Gefangener zurückbehalten worden. Sein Körper war mit Wunden bedeckt, die von den Martern herrührten, mit denen ihn die Wilden peinigten. Später wurde Lehmann von den Apachen an den Comanchenstamm verhandelt, dessen Häuptling Quanah Parker an dem Jungen Gefallen fand, ihn als seinen Sohn annahm und aufzog. Als die Comanchen nach Fort Still kamen und sich dem General McKenzie ergaben, war Lehmann 19 Jahre alt. Eine Kavalleriewache brachte ihn zu seinen Angehörigen nach Texas zurück. Dort blieb er mehrere Jahre und verheiratete sich auch, doch zog es ihn wieder in die Wildnis hinaus, und so kehrte er bald wieder zu seinem Adoptivvater zurück.« (Hohenloher Bote Nr. 152, 2. Juli 1908.)
1902 erschien ein ähnlicher Bericht in der »Täglichen Rundschau« (»Der Indianer Lehmann«.)
Im Jahre 1510 nahmen die Tupiindianer der Insel Ithaparica schiffbrüchige Portugiesen gefangen und fraßen sie auf, bis auf Diego Alvares, der durch Krankheit diesem Schicksal entging. Er gelangte bei den Eingeborenen zu Ansehen, erhielt die Tochter des Häuptlings zum Weib und wurde dessen Nachfolger unter dem Namen Cararunru. Seine Gattin wurde Christin als Catharina Paraguassu. Daher entstanden freundschaftliche Beziehungen der Tupi zu den Portugiesen. Nachkommen des portugiesischen Häuptlings leben heute noch. (Bahia und seine Deutschen. Von E. C. Pleß. Gartenlaube 1912 Nr. 25.)
»Nicht selten überraschten sie auf ihren Märschen, namentlich in der oberen Halbinsel, auch eine Horde Indianer, und diese Überraschung steigerte sich einst zu beiderseitiger großer Freude, als sich in einem der Häuptlinge ein guter schwäbischer Schwarzwälder entpuppte, umgeben von seiner kupferfarbenen Familie.« Besondere Beilage des Staats-Anzeigers für Württemberg, 1880, Nr. 2, 6. Febr. (»Ein württembergischer Naturforscher im Dienste der Vereinigten Staaten von Nordamerika.« Dr. Karl Rominger.) Vgl. Staats-Anz. f. Württ. Nr. 110, 13. Mai 1907, Beilage. Es ist dies wieder ein Beweis dafür, wie die kühnste Phantasie, die Halbgebildeten den Eindruck des Unwahrscheinlichen macht, von der Wirklichkeit bestätigt, oft übertroffen werden kann.
Kap. 58. Die Beschreibung der Inkahöhle erreicht noch lange nicht die tatsächliche Pracht der Paläste und künstlichen Gärten der Inka, vgl. die genannten Werke von Brehm und Kolberg.
Kap. 60. Über das »Wachsen des Goldes« siehe Gartenlaube 1901 Nr. 21 (»Blätter und Blüten: Das Wachsen des Goldes«): »Besonders die Tatsache, daß alte, längst als erschöpft aufgegebene Bergwerke nach gewisser Zeit immer wieder Gold an Stellen enthalten, wo bestimmt keins mehr aufzufinden war, ist über jeden Zweifel erhaben.«
Kap. 63. Die Mammutbäume in Kalifornien erreichen einen Umfang von 25 und eine Höhe von über 100 Metern. Es bestehen aber auch Exemplare von 50 bis 70 Meter Umfang. Eukalyptus regnans oder amygdalyna wird bis zu 170 Meter hoch. Siehe auch Prochaskas Jahrbücher, Jahrbuch der Weltreisen 1903 S. 131: Der »Old Hercules« im Calaveraspark maß an der Wurzel 71 Meter im Umfang und war 107 Meter hoch, eine andere Sequoja gigantea (Mammutfichte) 124 Meter hoch. Nun ist kein Beispiel einer Sequoja bekannt, die eines natürlichen Todes gestorben wäre, und an einem Stumpf wurden 4000 Jahresringe gezählt. Ihr Ende erfolgt stets gewaltsam, durch Blitz, Feuer, Sturz infolge Nachgebens des Erdreichs usw. Bei ihrer gewaltigen Lebenszähigkeit und ihrer fast vollkommenen Widerstandskraft gegen Krankheiten kann eine natürliche Altersgrenze für diese Fichten überhaupt nicht festgesetzt werden.
»Als ich auf meiner ersten Reise durch den amerikanischen Kontinent nach Kalifornien kam und die Baumriesen von Calaveras und Mariposa erblickte, da hielt ich es nicht für möglich, daß sie irgendwo an Höhe und Stammumfang übertroffen werden könnten. Ich fuhr damals in einer vierspännigen Reisekutsche durch einen Tunnel, der aus dem Stamm einer vielleicht achtzig Meter hohen Sequoja gigantea herausgeschlagen worden war, und zu beiden Seiten war vom Stamm ebensoviel übrig, als der Durchmesser des Tunnels betrug ... Und doch gibt es in den Urwäldern des Oregon und im Staate Washington zahllose Nadelbäume, die Dorylo Pine und Oregon Pine, die sogar die weltberühmten Sequoja an Höhe und Mächtigkeit übertreffen.« (Hesse-Wartegg »Bei den Urwaldriesen von Washington«. Daheim Nr. 44, 5. August 1905.)
Wenn es daher nach der in Kap. 71 ausgeführten Ansicht gelänge, das Wachstum dauernd zu fördern, so wären Bäume, die das Doppelte dieser Maße erreichen, nichts Wunderbares. Übrigens sind die Größenverhältnisse der Mammutbäume, Eukalypten, Baobab usw. im Verhältnis zu den europäischen Arten so außerordentlich, daß das wirkliche Vorkommen doppelt so großer Bäume verhältnismäßig weniger wunderbar erscheinen müßte als seinerzeit die Entdeckung jener Riesenbäume.
Über den Quezal vgl. Gartenlaube 1901, S. 567 ff.
Kap. 64. Über Manoa vgl. hauptsächlich Langegg. Die Schilderung Manoas (die übrigens kaum die wirkliche Pracht der Inkastädte übertrifft), das Lebenselixir, die Verwandlung der Metalle usw. wird Leuten wie Famulus Wagner ein überlegenes Lächeln entlocken nach dem Grundsatz der Mittelmäßigkeit: »Was ich nicht weiß, gibt es nicht!« Die Schilderungen sind Phantasie, nicht ohne wissenschaftlich begründete Unterlage; sie wollen möglich erscheinen und werden für den, der mit klarem Verstand sein Wissen beherrscht, nichts enthalten, was im möglichen Fortschritt der Zeiten undenkbar erschiene.
Kap. 65. El Dorado, siehe die Nachweise zu Kap. 43.
Kap. 67. Tiahuanako: Tschudi V S. 286-295. »Wir stehen in Tiahuanako auf einem Boden voll Rätsel. Sie werden schwerlich je gelöst werden. Möchte es nur gelingen, einen Teil des dichten Schleiers zu lüften, der die geschichtliche Vergangenheit dieses Landes umhüllt« (S. 293).
Kap. 68 bis 70. Zu den (bis auf das Fortleben Mankos und Tupak Amarus) streng historischen Schilderungen vergleiche in der Hauptsache die Werke von Brehm, Garcilasso de la Vega, Langegg und Kolberg.
Kap. 71. Herstellung künstlicher Edelsteine, Türkise, Smaragde und von besonders großen Rubinen, siehe »Künstliche Edelsteine« Pforzh. Gen.-Anz. Nr. 294, 15. Dez. 1906, nach Prof. Dr. Tschermak in der »Neuen Freien Presse«.
Kap. 72. Langlebigkeit. Über die Tatsachen außerordentlich hohen Alters, oft verbunden mit Verjüngung, geben zahlreiche besondere Werke und Schriften Aufschluß. »Am 100jährigen Gedenktag der Schlacht bei Borodino »begaben sich der Kaiser und die Kaiserin von Rußland in das Invalidenhaus, wo die Zeitgenossen der Schlacht von Borodino, deren Ältester 125, der Jüngste 110 Jahre alt ist, versammelt waren«. (Staats-Anz. f. Württ. Nr. 212, 9. Sept. 1912.) — Frau Katharina Lustig, 112 Jahre alt usw. (Deutsche Reichspost Nr. 228, 30. Sept. 1910.) — 180 Jahre alt! (Deutsche Reichspost Nr. 21, 26. Jan. 1911.) — Frau Bolnice aus Cattaro in Dalmatien, 134 Jahre alt, geistig noch sehr rüstig. (Quellwasser fürs Deutsche Haus Nr. 9, 27. Nov. 1910.)
Beispiele von Verjüngung in Hufelands Makrobiotik, Prof. Ideler, Dr. Curran, Frissak: Schwäb. Frauenzeitg. Nr. 36, 9. Sept. 1900 (»Verjüngung im Greisenalter« von Dr. M. Wegener). Siehe auch Pforzh. Gen.-Anz. Nr. 10, 13. Jan. 1909 (»Zur Bekämpfung des Todes«). Prof. Metschnikoff in Paris vertritt die Ansicht, daß wir nur über die Darmbakterien Herr zu werden brauchten, um das Leben beliebig zu verlängern: Velhagen u. Klasings Monatshefte, Jan. 1912 (Prof. Dr. Friedr. Martius: »Altern und Altwerden«).
Zum Nachwort: »Indessen ist die organische Natur reich an Beobachtungen viel auffallenderer Art; es gibt wohl konstatierte Tatsachen, von denen man beim ersten Anblick glauben könnte, es seien Hirngespinste einer krankhaften Phantasie.« Sachs S. 340/341. »Auffallend war es mir, auch in diesen Urwäldern unter der brasilianischen Bevölkerung die feste Überzeugung von dem Vorhandensein eines Goldsees (lagoa dourada) tief im Innern der Waldregion zu finden.« Tschudi II S. 255.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.